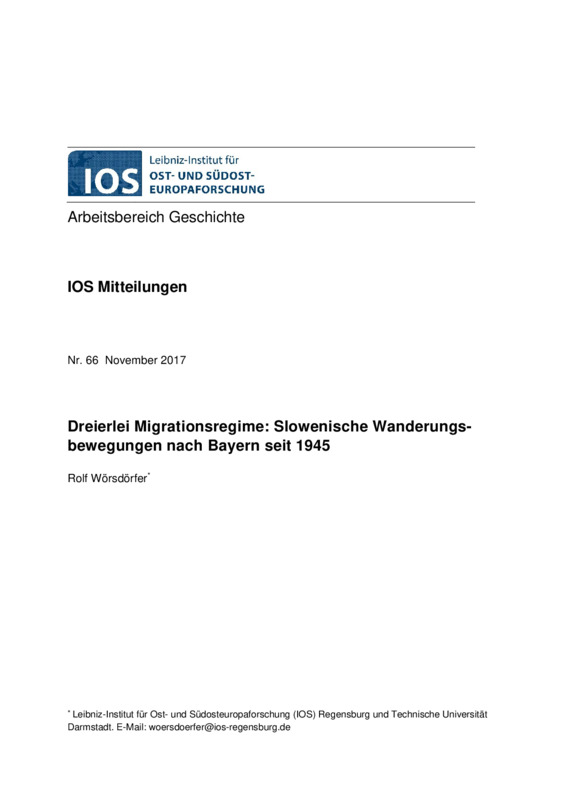https://www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_66.pdf
Media
- extracted text
-
Arbeitsbereich Geschichte
IOS Mitteilungen
Nr. 66 November 2017
Dreierlei Migrationsregime: Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Rolf Wörsdörfer*
* Leibniz-Institut
für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg und Technische Universität
Darmstadt. E-Mail: woersdoerfer@ios-regensburg.de
Landshuter Straße 4
D-93047 Regensburg
Telefon: (09 41) 943 54-10
Telefax: (09 41) 943 54-27
E-Mail: info@ios-regensburg.de
Internet: www.leibniz-ios.de
ISSN: 2363-4898
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung ............................................................................................................................ v
Die ‚Stunde Null‛ .................................................................................................................... 1
Auf der Suche nach politischem Asyl .................................................................................... 2
Werkverträge und Leiharbeit ................................................................................................. 7
Die ‚Ingolstädter Slowenen‘ ................................................................................................. 17
Konsolidierung der slowenischen Präsenz ......................................................................... 25
Die Frauen ........................................................................................................................... 29
Gewerkschaftliche Vertretung, Arbeitskämpfe und internationale Beziehungen ............ 36
Anwerbestopp ...................................................................................................................... 41
Rotation und Zuwanderungsstopp ...................................................................................... 45
Vereine ................................................................................................................................ 47
Clubs der Jugoslawen ......................................................................................................... 53
Jugoslawische Clubs nahmen eine wichtige Hürde ............................................................ 55
Initiative von unten ............................................................................................................... 57
Slowenische Vereine ........................................................................................................... 60
‚Väterchen Frost‛ oder ‚Sankt Nikolaus‛? ........................................................................... 66
Städtepartnerschaft ............................................................................................................. 71
„Ach, ich bleibe jetzt noch ein bisschen …“ ......................................................................... 76
„Mal hier – mal unten“ .......................................................................................................... 81
Finis Jugoslaviae ................................................................................................................. 86
Fazit ..................................................................................................................................... 88
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................ 89
Quellen- und Literaturverzeichnis ......................................................................................... 91
Bibliografie ............................................................................................................................ 93
iii
Kurzfassung
Das Arbeitspapier analysiert die Entwicklung slowenischer Migrationsbewegungen nach Bayern
in der Zeit seit 1945.
–
Die frühe slowenische Präsenz in Bayern geht auf Displaced Persons und Asylsuchende
zurück, die anfänglich vor allem in Lagern lebten (Landshut, Valka-Lager, Zirndorf). In
diesem Kontext entstand die slowenische katholische Mission in München, die später zum
Oberseelsorgeamt für die ganze Bundesrepublik aufgestockt wurde.
–
Als zweite Periode schließt sich die Zeit der Leiharbeit slowenischer Firmen (IMP, RUDIS)
an, die in Bayern mit verschiedenen Unternehmen kooperieren und diesen Arbeitskräfte aus
dem slowenischen Raum zur Verfügung stellen.
–
Mit dem deutsch-jugoslawischen Anwerbeabkommen von 1968 intensiviert sich die slowenische Zuwanderung nach Bayern, die vor allem auf die großen Automobilbetriebe, aber
auch auf das regionale Bau- und Gaststättengewerbe hin ausgerichtet ist. Bei Auto Union
Audi NSU in Ingolstadt arbeiten bis zum Anwerbestopp von 1973 und zum Teil weit
darüber hinaus ebenso viele Slowenen wie in einzelnen Steinkohlenzechen des Ruhrreviers
um 1900.
Abstract
The paper analyzes Slovene migrations to Bavaria since 1945.
–
The early presence of Slovenes in Bavaria is due to Displaced Persons and people seeking
asylum, who lived initially in different camps (Landshut, Valka-Lager, Zirndorf). During
this period a Slovene Catholic Mission was founded in Munich.
–
In a second period Slovene companies such as IMP and RUDIS offered subcontract workers
to Bavarian industry, most of them originating from different regions of Slovenia.
–
With the German-Yugoslav-agreement on “guestworkers” (1968) Slovene migration to Bavaria intensified, with the influx of workers directed to the big motor companies as well as
to the construction industry and to the restaurants sector. Until 1973, when official recruitment of workers in Yugoslavia ended, more than 1.000 men and women from Slovenia
worked at the Auto Union Audi NSU plant of Ingolstadt, as many as had been working in
some coal mines of the Ruhr at the beginning of 20th century.
v
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Die ‚Stunde Null‛
Auf dem Feld der slowenischen Migrationen nach Bayern lassen sich für den Zeitraum nach
1945 drei Etappen unterscheiden, die mit drei unterschiedlichen Migrationsregimes korrespondierten, sich aber zeitlich zum Teil auch überlagerten. Am Anfang stand die Suche nach dem
politischen Asyl, die mit dem deutsch-jugoslawischen Anwerbeabkommen von 1968 an Bedeutung verlor. Zwischen der Asylsuche und der sogenannten ‚Gastarbeit‛ seit 1968 ist das
weniger bekannte Kapitel der organisierten Leiharbeit angesiedelt; slowenische Firmen spielten
hier eine entscheidende Rolle.
Viele Migranten mit slowenischem Hintergrund erfuhren das Kriegsende als ‚Stunde Null‛,
die solide Überlebensstrategien erforderte und zugleich Raum für neue Optionen und Handlungsalternativen ließ. Wir finden Slowenen beiderlei Geschlechts, Einzelpersonen und Familien, in Deutschland im Mai 1945 in sehr unterschiedlichen Situationen vor: Als Evakuierte aus
den zerstörten Bergarbeitersiedlungen und Arbeitervierteln der Großstädte, als Displaced persons, zu denen man Kriegsgefangene und sogenannte Absiedler rechnen muss, als Menschen,
die nach der Evakuierung aus Slowenien zurückkehrten oder nach dem Verlust von Wohnung
und Arbeitsplatz im Ruhrgebiet gerade erst in Richtung Slowenien aufbrachen.1
Es kam zu einem Austausch der Migrantenpopulation; der Krieg hatte dazu beigetragen, dass
das Ruhrgebiet nicht mehr die einzige oder hauptsächliche Hochburg der Slowenen in Deutschland war. Absiedler und Zwangsarbeiter gab es vor allem in Franken und im Raume München;
andere Deportierte lebten über weite Teile des vormaligen Deutschen Reichs verstreut.2
Die folgenden Abschnitte versuchen, diese Aufsplitterung der Lage zu berücksichtigen und
die verschiedenen Lebenswelten der Slowenen zu rekonstruieren.3
1
Ferenc, „Absiedler“;
Hegenkötter, Moje delo.
3
Drnovšek, Izseljevanje „rakrana“, S. 270f.
2
1
IOS Mitteilung Nr. 66
Auf der Suche nach politischem Asyl
Zwischen 1955 und 1968 beantragten in der Bundesrepublik einige Tausend Menschen aus
Slowenien und insbesondere aus der Štajerska Asyl. Am Anfang des Aufenthalts stand oft die
Unterbringung im Lager – sei es, dass die Betroffenen im Verlaufe des Zweiten Weltkriegs
nach Deutschland deportiert worden waren; sei es, dass auf einen Grenzübertritt nach 1945 die
Einweisung in eines der vielen Flüchtlingslager gefolgt war.
Die Nähe der österreichischen und italienischen Zollstationen, die leichte Überwindbarkeit
der ‚grünen Grenze‛ im Alpenraum, eine gewisse kulturelle Affinität zwischen Slowenen und
Deutschen, das wirtschaftliche Gefälle zwischen beiden Räumen und schließlich die Erfahrungen aus einem halben Jahrhundert Deutschland-Migrationen trugen dazu bei, dass der Westen
und Süden des Landes von Neuem zum Migrationsziel wurden. Hinzu kommt, dass die deutsche Besatzungspolitik zwischen 1941 und 1945 den slowenischen Raum mit ihren Assimilierungskampagnen, Zwangsumsiedlungen und Kollektiveinbürgerungen überzogen hatte. So hatten die Besatzer im Rahmen ihrer Germanisierungspläne die Einführung des Deutschunterrichts
an den slowenischen Schulen forciert und zugleich ein abgestuftes Verfahren der Kollektivnationalisierung von Slowenen eingeführt.4
Slowenien war bis 1941 ein Land ohne flächendeckend verbreitete sozialistische und kommunistische Traditionen, sieht man von den Bergbaugebieten und wenigen anderen Hochburgen der
Arbeiterbewegung einmal ab. Der ‚Massenwiderstand gegen die Besatzungsmächte‛ (Peter Vodopivec) war zunächst von den etwas mehr als tausend slowenischen Kommunisten und ihren
Bündnispartnern unter den Christlichen Sozialisten und Sokol-Turnern organisiert worden.5
Teile der Bevölkerung mochten sich nicht mit der am Ende der Besatzungszeit und des innerslowenischen Bürgerkriegs als Sieger hervorgetretenen kommunistischen Partei unter Boris
Kidrič und Edvard Kardelj anfreunden, zumal diese schon während des Partisanenkampfs die
gesamte Macht innerhalb der Befreiungsbewegung an sich gezogen hatte. Als entscheidende
Wende wird von slowenischen Historikern übereinstimmend die Dolomiti-Erklärung vom Februar 1943 genannt, mit der die Bündnispartner der Kommunisten auf ihre eigenen organisatorischen Strukturen innerhalb der Befreiungsfront (Osvobodilna fronta – OF) verzichteten und
der KPS ein Machtmonopol gewährten.6
Vom Standpunkt der antikommunistischen Slowenen aus betrachtet, war das Land nur durch
eine Art Verkettung unglücklicher Umstände – den ‚Pakt‛ von 1941, den Putsch des Generals
4
Wörsdörfer, Italienische und deutsche Besatzungspolitik, S. 357–361.
Vodopivec, Anfänge nationalen Erwachens, S. 383.
6
Ebd., S. 372; Luthar, Land between, S. 438.
5
2
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Dušan Simović, die Besetzung und den Partisanenkrieg – kommunistisch geworden. Es gab
also aus ihrer Sicht genügend Gründe, einen Antrag auf politisches Asyl im Ausland und zumal
in der Bundesrepublik zu stellen. Es soll sogar Fälle gegeben haben, in denen aus dem SaveSotla-Streifen entlang der kroatischen Grenze ausgesiedelte Slowenen nach dem Krieg in Westdeutschland blieben.7
Anderseits zeigen die erhalten geblieben Asylakten auch, dass Flüchtlinge oft keine stringente Argumentation vorbrachten. Manche machten unter dem Gesichtspunkt eines positiven
Verfahrensausgangs eher kontraproduktive Angaben zu „wirtschaftlichen Gründen“ ihrer
Flucht. Am ehesten beriefen sie sich noch auf ihren katholischen Glauben und eine etwas vage
Gegnerschaft zum Kommunismus. Zum Teil griffen sie diffus Gedanken auf, wie sie von der
katholischen Slowenischen Volkspartei (SLS) am Vorabend des Zweiten Weltkriegs verbreitet
worden waren.8 Wie Egon Pelikan schreibt, litt der politische Katholizismus in Slowenien unter
seiner ideologischen Desorientiertheit; er bot keine demokratische Perspektive an und folgte
stattdessen ständisch-korporativen Modellen, die Erinnerungen an den Faschismus wachriefen.
Viele katholische Politiker orientierten sich am Spanien Francos, an der Dollfuß-Diktatur in
Österreich, am Portugal Salazars und am Ende sogar am Frankreich Marschall Petains.9
Anton Korošec, der langjährige Parteivorsitzende der SLS, war wenige Monate vor dem
deutsch-italienischen Überfall auf Jugoslawien gestorben. Die jüngeren Politiker der Slovenska
Ljudska Stranka und die meisten katholischen Kleriker vertraten auch im Exil noch lange Zeit
ständisch-korporative Positionen. Die Flüchtlingslager in Österreich, die formal der britischen
Besatzungsmacht und der UNRRA unterstanden, verfügten über ein System der Selbstverwaltung, in dem oft kroatische Ustaše federführend waren. Die slowenische Komponente bestand
aus mit den Domobranci verbundenen Priestern oder konservativen SLS-Funktionären.10
Einmal aus diesen Lagern entlassen, bevorzugten die Angehörigen der katholischen und liberalen Oppositionsgruppen, aber auch Überreste der bewaffneten Kollaborateure aus den
Kriegsjahren, Domobranci (‚Heimwehren‛) oder sogenannte Beli partizani (‚Weiße Partisanen‛), Exilländer jenseits des Atlantiks. Die kommunistische Parteiführung schätzte die Zahl
der ‚weißen‛ Emigranten 1959 auf etwa 10.000. Die meisten davon, rund 7.000, lebten in Argentinien, die übrigen verstreut auf einige weitere Länder, mit einer gewissen Schwerpunktbil-
7
Bericht des Oberseelsorgeamtes für die Slowenen in der Bundesrepublik Deutschland München, April 1966, in:
Archiv der Erzdiözese München-Freising, Ordinariat des Erzbistums München und Freising, Altreg. Kasten 0741.
8
Vgl. die Auswertung von 60 im Bundesarchiv Koblenz aufbewahrten Asylakten aus der Zeit zwischen 1955 und
1968 in Wörsdörfer, Slowenische Deutschland-Migrationen, S. 303–311.
9
Pelikan: Laibach/Ljubljana, S. 175.
10
Vgl. Švent, Slovenski begunci, S. 363f.
3
IOS Mitteilung Nr. 66
dung in den USA. Demgegenüber war das eigentliche politische Exil der Slowenen in der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere in Bayern in organisierter Form so gut wie überhaupt nicht vertreten.11
Anders als die kroatischen Migranten wurden die slowenischen nicht in das bewaffnete und
terroristische Vorgehen gegen die neue Staatsmacht hineingezogen. Ob dies umgekehrt dazu
beitrug, dass das slowenische Exil auch weniger unter den Nachstellungen der jugoslawischen
bzw. später auch der slowenischen „Verwaltung für Staatssicherheit“ (UDBA) zu leiden hatte,
bleibt zu überprüfen.12 Man kann jedenfalls nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass die Dimension des – wenn auch vorrangig mit propagandistischen Waffen ausgetragenen – Bürgerkriegs den slowenischen Migranten völlig fremd geblieben wäre. Einen Hinweis bietet die Tatsache, dass in den Gottesdiensten der Slowenischen Katholischen Missionen in Deutschland
während der Nachkriegsjahre regelmäßig für die bei den titoistischen Vergeltungsmassakern
bei Viktring (slow. Vetrinj) und im Gottscheer Hornwald umgekommenen Domobrancen gebetet wurde.13
Das Fehlen einer organisierten politischen Strömung trug dazu bei, dass die Asylanträge der
Flüchtlinge aus Slowenien oft sehr unbeholfen formuliert waren. Die slowenischen Bewerber
hatten anders als die kroatischen niemanden, der ihnen eine für den Antrag relevante politische
Tätigkeit im Herkunftsland bestätigen konnte. Freilich lässt sich auch zeigen, dass ein konservativer, antikommunistischer, die Domobrancen-Tradition adaptierender Exil-Klerus manche
Funktionen der fehlenden politischen Exilgruppen übernahm.14
Schlüsselfigur dieses Klerus, der den slowenischen Katholizismus explizit als ‚Märtyrerkirche‛ sah, war der überaus umstrittene Erzbischof von Ljubljana Gregorij Rožman. Insbesondere
agierte die Zeitschrift Naša luč lange Zeit in seinem Sinne; das Blatt erschien zehnmal im Jahr,
11
Emigracija v Nemčiji – poročilo, S. 2. Bis 1968 hatte sich die Zahl der politischen Emigranten nach Angaben
des slowenischen Außenministeriums verdoppelt (Drnovšek, Odnos Partije, S. 235.) – Einen Überblick über das
politische Exil der Slowenen gibt BA K, B 136 Bundeskanzleramt, 6491 Anlage zu 212-14/39 III 11117/53 – Die
slowenische Emigration (Angaben aus dem Jahr 1953), siehe auch ebd., 6479, Bundesamt für Verfassungsschutz,
VI B1-059-S-30 131-46/71 VS-NfD, Köln, 15.6.1971.
12
Unter den wenigen bislang einsehbaren Dokumenten des slowenischen Innenministeriums zu Fragen der
Überwachung von Migranten und Angehörigen des Exils finden sich Aufzeichnungen über katholische
Exilpriester, jugoslawische Firmen und von Jugoslawen besuchte Gaststätten in der Bundesrepublik. Vgl. AS
1931, šk 1173, Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS, S. 95–116.
13
Vgl. den Gedenkartikel zum 10. Jahrestag der Massenerschießungen von Viktring ‚Junakom na mrtvi strani‘,
NL, 6.1955, S. 1–3.
14
„Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ist der konservativste und [dem Kommunismus] feindlichste Teil des
Klerus emigriert“, heißt es in einem Dokument aus den frühen 1970er Jahren. Der Klerus sei damals als
„Kollaborateur und Reserve der Bourgeoisie“ aufgetreten, „der heimischen wie der ausländischen.“ (AS 537, šk
1149, 1285, Delovanje slovenske rimškokatoliške cerkve med izseljenci in zdomci, 9.3.1973.)
4
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
wechselte den Erscheinungsort mehrfach und wurde in Deutschland über die sukzessive eingerichteten Slowenischen Katholischen Missionen (SKM) verbreitet. Es unterlag der Überwachung durch die Sicherheitsorgane und hatte in Rodna gruda, dem regierungsnahen Organ der
Slovenska izseljenska matica, einen erbitterten Konkurrenten.15
In einem kurzen Bericht zur Lage des slowenischen Exils in Westdeutschland von 1953 heißt
es, von den etwa tausend slowenischen Emigranten in der Bundesrepublik hielten sich rund 300
in Bayern auf. Einige davon seien „den als ‚jugoslawisch‛ bezeichneten serbischen Organisationen beigetreten“, während die Slowenen über keine eigene Vereinigung verfügten; in München
bestehe allerdings eine ‚Slowenische Caritas‛ unter der Leitung des Pfarrers Franc Šeškar.16
Die slowenische Gemeinde Franc Šeškars war in einem Lager für Displaced persons, dem
Lager Höhnkaserne in Landshut, entstanden, wo der Priester zwischen August 1947 und Juli 1950
die Sonntagsmesse abwechselnd auf Slowenisch und auf Kroatisch las. Der von den Alliierten
aus dem Konzentrationslager Dachau befreite Šeškar erteilte auch Religionsunterricht in den
Volksschul- und Gymnasialklassen, die im Lager eingerichtet worden waren. Er bestritt seinen
Lebensunterhalt „nur mit Meßstipendien und gelegentlichen Unterstützungen.“17
Vor Ostern und Weihnachten besuchte Šeškar jeweils alle Lager in Deutschland, in denen
slowenische Landsleute lebten. Die Betreuung der Lager war schon seit 1945 seine Hauptaufgabe; wenig Zeit blieb ihm, die verstreut lebenden und deshalb schwer erreichbaren Slowenen
in privaten Wohnungen zu besuchen. In der Erzdiözese München-Freising lebten damals 312
Slowenen, davon 154 in München und 35 im Lager Landshut.18
Im Zusammenhang mit der anstehenden Auflösung einiger in Bayern noch bestehender Behelfsunterkünfte erhob die Bundesanstalt für Arbeit im Oktober 1952 Daten über das Regierungslager für heimatlose Ausländer in Landshut. Ziel war die Verlegung der Lagerinsassen in
andere Notquartiere oder der Bau von Wohnsiedlungen. Immerhin lebten im Freistaat zu diesem Zeitpunkt noch etwa 15.000 Ausländer in Lagern.19
15
Vgl. das Urteil des slowenischen Innenministeriums über Naša luč in Republiški sekretariat za notranje zadeve
SR Slovenije. Uprava za analitiko, Delavci, S. 60 und das Urteil Janez Zdešars über Rodna gruda, Bericht des
Oberseelsorgeamtes, S. 7.
16
Anlage zu 212-14/39 III 11117/53 – Die slowenische Emigration (Angaben aus dem Jahr 1953), BA K, B 119, 6491.
17
„Betreff: Jahresbericht über die Seelsorge für slowenische DPs und Flüchtlinge“, Schreiben von Franc Šeškar,
Seelsorger für Slowenen in Deutschland, an das Ordinariat des Erzbistums München und Freising, 9.2.1951,
Archiv der Erzdiözese München-Freising, Altreg. Kasten 0741.
18
Im Juli 1950 blieben nur noch wenig „Landsleute“ übrig, so dass Šeškar die Zahl der Messen im Lager
reduzierte (ebd.)
19
Das Lager Landshut-Höhnkaserne hatte im Herbst 1952 noch 895 Insassen, die 20 verschiedenen Nationalitäten
angehörten, darunter 49 Slowenen. Die Auflösung des Lagers erfolgte, indem man den Flüchtlingen oder
ehemaligen Deportierten Wohnungen anbot, die vielfach in neu errichteten Siedlungen lagen. (BA K, B 119, 3032,
Bd. 1, BfA Referat I a I, 27.10.1952, BA K, B 119, 3032, Bd. 1.)
5
IOS Mitteilung Nr. 66
In den 1950er und 1960er Jahren lagen die Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge aus Jugoslawien in Bayern. Erste Anlaufstelle für die geflohenen Slowenen war das Valka-Lager in Nürnberg-Langwasser, wo 1953 die Bundesdienststelle für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge eingerichtet wurde. Aus ihr ging später das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) hervor. Bis zum endgültigen Entscheid über ihren Status konnten sich die Geflohenen
mit einem Lagerausweis in der Stadt frei bewegen, durften aber keine weiten Reisen unternehmen. Nachrichten über die Slowenen in Langwasser finden sich in den Asylakten, in einem
Bericht des slowenischen Innenministeriums und – für die zweite Hälfte der 1950er Jahre – in
der Migrantenpresse.20 Anfang der 1960er Jahre setzen dann die Berichte aus dem in einer ehemaligen Kaserne eingerichteten Lager Zirndorf ein, das zur zentralen Anlaufstelle der Asylbewerber wurde.21 Von demselben Lager heißt es im Herbst 1965, dass sich dort immer weniger
Slowenen aufhielten. Viele Flüchtlinge mussten dieser Quelle zufolge nach Jugoslawien zurückkehren, andere weiterwandern, da sie in Deutschland nicht bleiben konnten. Aber auch die
Auswanderung in überseeische Länder sei erschwert worden.22
Zu Beginn der 1960er Jahre tauchte in den Debatten um die Asylfrage erstmals der Vorwurf
auf, Flüchtlinge aus Jugoslawien seien als „Wirtschaftsflüchtlinge“ anzusehen, die ihre Asylgründe nur vortäuschten. Anderseits wurde anerkannt, dass die Asylsuchenden denselben sozialen Gruppen angehörten, unter denen Vertreter deutscher Unternehmen auch zu einer aktiven
Anwerbepolitik übergegangen waren. Was lag also näher, als die Asylverfahren und den Lageraufenthalt abzukürzen, um die Flüchtlinge dauerhaft in den Arbeitsprozess einzugliedern? Aus
dem Blickfeld geriet dabei die Frage, ob es in Jugoslawien eine wirkliche Verfolgungssituation
gab oder nicht.23
Anfang der 1960er Jahre lebten in den bayerischen Diözesen insgesamt 880 auf Karteikarten
erfasste slowenische Katholiken. Noch war München die einzige Stadt im Freistaat, in der mehrere Hundert Slowenen wohnten. Binnen weniger Jahre änderte sich die Lage zunächst aufgrund der Tätigkeit slowenischer Leiharbeitsfirmen und später durch das deutsch-jugoslawische Anwerbeabkommen.24
20
So beispielsweise ein Hinweis auf einen ‚Bunten Abend‘ der Slowenen im Valka-Lager bei Nürnberg in NL, 4.
1956. Zum Valkalager vgl. AS 1931, 1173, Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS, Emigracija v Nemčiji –
poročilo, 10.9.1956 S. 1; Münch, Asylpolitik in der Bundesrepublik, S. 39; Europäische Flüchtlingsprobleme 1959,
S. 58.
21
Vgl. den Hinweis auf eine Weihnachtsmette mit slowenischen Liedern (ebd., 2. 1962 Februar, S. 16; zu Zirndorf
auch Emigracija v Nemčiji – poročilo, S. 2 und S. 12f.). Das Valka-Lager wurde 1961 geschlossen.
22
„Zirndorf“, NL, 10.1965.
23
Münch, Asylpolitik, S. 54–56. Überlegungen zu einer „Verdichtung der Arbeitsmarktbeziehungen nach
Jugoslawien hin“ gab es bei der Bundesanstalt für Arbeit seit 1959 (Rass, Institutionalisierungsprozesse, S. 446.)
24
Bericht des Oberseelsorgeamtes, S. 2.
6
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Werkverträge und Leiharbeit
Jugoslawien war vor 1968 das einzige Land ohne diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik, das bereits in nennenswertem Umfang Arbeitskräfte für den deutschen Markt bereitstellte. Angesichts des Fehlens einer zentralen Steuerung wurden Arbeitssuchende auf den unterschiedlichsten Wegen rekrutiert. Da war zunächst einmal die klassische Kettenmigration, die
ebenso auf legalem wie auf illegalem Wege erfolgen konnte: Schon ausgewanderte Menschen
berichteten Verwandten oder Bekannten in Briefen oder bei Besuchen (Urlaub im Sommer oder
am Jahresende, kürzere Fahrten in die Herkunftsregion) über die vergleichsweise günstigen
Arbeitsbedingungen und hohen Löhne in der Bundesrepublik. Auch jugoslawische Geschäftspartner deutscher Firmen fanden sich oft bereit, Arbeitskräfte zu vermitteln. Bei Besuchen des
deutschen Partners in Jugoslawien kam das Thema zur Sprache. Eine weitere Möglichkeit, nach
Deutschland zu gelangen, ergab sich mit dem Abschluss eines sogenannten Werkvertrags.25
Vor allem aber gab es eine Reihe von Wirtschaftszweigen und Branchen, die außerhalb der
Reichweite von Kommission, Bundesanstalt für Arbeit und Landesarbeitsämtern Arbeitskräfte
rekrutierten, so dass dort halb- oder illegale Praktiken florieren konnten. Außerdem bestand bis
Ende November 1972 neben der offiziellen Anwerbung durch die deutsche Kommission immer
noch die Möglichkeit der Einreise mit einem Touristenvisum.26
Gerade die vielfach obskuren Anwerbekonditionen machen es schwer, der Problematik auf
den Grund zu gehen. Illegale Praktiken hinterlassen nicht viele Spuren in den Archiven. Immerhin bestanden Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Die Bundesanstalt für Arbeit konnte,
wenn sie sich denn überhaupt einschaltete, die Erteilung einer Arbeitserlaubnis verweigern.
Auch von den DGB-Gewerkschaften gab es Vorstöße zur Bekämpfung der Leiharbeit.
Schon seit Anfang der 1960er Jahre interessierten sich deutsche Firmen wieder für jugoslawische Arbeitskräfte, und zwar nachweislich nicht nur für solche, die auf dem Wege der
politischen Asylsuche nach Deutschland gelangt waren. Dies blieb auch den Arbeitssuchenden im slowenischen Raum nicht verborgen. Deren Zahl hatte sich zwischen 1964 und 1968
um 47 Prozent erhöht.27
Einzelne Firmen gingen zur Anwerbepolitik im Lande selbst über, wo sie auf eigene Faust
und ohne Vermittler operierten. Ein bayerisches Unternehmen bemühte sich im August 1962
bei der Bundesanstalt für Arbeit darum, zur Errichtung von Trafostationen und Starkstromleitungen slowenische Arbeitskräfte einstellen zu dürfen. Die namentlich angeführten, zwischen
25
Konsulat der Bundesrepublik Deutschland Zagreb an BfA, 12.9.1962, BA K, B 119, 3027, Bd. 1.
Herbert/Hunn, Beschäftigung von Ausländern, S. 800.
27
Drnovšek, Izseljevanje „rakrana“, S. 302.
26
7
IOS Mitteilung Nr. 66
1923 und 1938 geborenen Arbeiter stammten alle aus der Gegend von Brežice. Man darf deshalb mutmaßen, dass sie auch vorher schon gemeinsam für Firmen in Jugoslawien oder
Deutschland gearbeitet hatten.28
Ein Schnellbrief der Nürnberger Bundesanstalt hatte im Juli 1962 insofern für Klarheit
gesorgt, als „Firmen, die Anwerbemaßnahmen in Jugoslawien durchzuführen beabsichtigen“,
die Zustimmung nicht mehr ohne weiteres erteilt wurde.29 Eine Vermittlung und Arbeitserlaubnis wurde nur Facharbeitern in Aussicht gestellt, die im Moment ihrer Auswahl bzw.
Bewerbung keinerlei Konkurrenz aus den Anwerbeländern zu fürchten hatten. Auch durfte
die Kontaktaufnahme nicht mittels „unzulässiger, insbesondere gewerbsmäßiger Vermittlung“ erfolgt sein.
Umgekehrt gab es aus dem jugoslawischen Raum seit Anfang/Mitte der 1960er Jahre einen
beträchtlichen Migrantenfluss in Richtung österreichische und deutsche Grenze, dessen Spuren sich in der Korrespondenz zwischen der Grenzschutzdirektion Koblenz und dem Bundesinnenministerium in Bonn wieder finden. Die von den Grenzschützern am häufigsten gerügte
Konstellation war die von Südslawen, die mit einem Durchreisevisum nach Frankreich in die
Bundesrepublik gelangten, die Reise aber dann nicht mehr bis zum angeblichen Ziel fortsetzten. Tatsächlich war Frankreich vor allem bevorzugtes Migrationsziel der Serben, die übrigen
Südslawen, also auch die Slowenen, zogen Österreich oder die Bundesrepublik Deutschland
vor.
Manche Arbeitssuchende wurden von der Grenzpolizei schon am Bahnhof Salzburg aufgegriffen und an der Weiterreise gehindert. Die Grenzschutzdirektion deklarierte all dies sofort
zu einem Problem der Inneren Sicherheit und wies unter anderem darauf hin, dass nach Angaben des bayerischen LKA von 1963 „unter den strafbar gewordenen Ausländern die Jugoslawen
an der Spitze“ standen.30
Im Januar 1963 hatte sich das deutsche Konsulat in Zagreb mit dem Wunsch an das Auswärtige Amt gewandt, bei der Vergabe von Sichtvermerken an jugoslawische Arbeiter entlastet zu werden. Es sprach sich für eine monatliche Quotierung der zuzulassenden Migranten
aus. Von der Bundesanstalt für Arbeit verlangte das Konsulat eine genaue Festlegung jener
Gruppen von Facharbeitern, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt gefragt und deshalb zuzulassen seien.31
28
Starkstromanlagen-Gemeinschaft Gruppe Süd an BfA, 10.8.1962, ebd.
BA K, B 119, 4725 Bundesanstalt Nürnberg an Landesarbeitsämter und Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
Frankfurt/M., 5.7.1962.
30
Grenzschutzdirektion an Bundesminister des Innern, 24.6.1964, BA K, B 106, 31349.
31
Konsulat Zagreb an Auswärtiges Amt, 5.12.1962, BA K, 149, 6240.
29
8
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Im deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe kursierte ein Muster-Arbeitsvertrag für Menschen aus Jugoslawien. Das demnach eingegangene Arbeitsverhältnis schloss u.a. die Bereitstellung von 350 Mark für die Rückreise vor. Der Betrag wurde vom Arbeitgeber vorgeschossen und in Raten vom Lohn des Kochs, des Kellners oder der Serviererin abgezogen.32
Mitte der 1960er Jahre dehnten einige slowenische Firmen ihr Betätigungsfeld auf die Bundesrepublik aus; es kam in diesem Zusammenhang auch zur Erteilung der Arbeitserlaubnis an
eine größere Anzahl von Arbeitnehmern, die für diese Firmen tätig waren.33 Die verschiedenen
Formen der Beschäftigung in der Bundesrepublik blieben – von lokalen oder regionalen
Schwankungen einmal abgesehen – während der Rezession von 1966/67 relativ konstant. Dies
erklärt auch einen Teil des auf der Bundesregierung um 1968 lastenden Drucks, die Immigration von Jugoslawinnen und Jugoslawen endlich zu legalisieren und zur offensiven Anwerbung
südslawischer Arbeitskräfte überzugehen.
Ein praktikabler Weg war zunächst der zeitlich begrenzte sogenannte Werkvertrag, der Anlass zu verschiedenen Missbräuchen gab. Er konnte per definitionem nur für eine vom sonstigen
Produktionsprozess in der jeweiligen Firma deutlich unterscheidbare Teilfertigung abgeschlossen werden, die en bloc zu entlohnen war. Die über den Werkvertrag beschäftigten Arbeiter
wurden arbeits- und sozialrechtlich nie mit deutschen Arbeitskräften gleichgestellt; sie unterstanden der jugoslawischen Gesetzgebung und waren im Krankheitsfalle gezwungen, Deutschland zu verlassen. „Die Leute, die hier zum Teil für zehn und mehr Jahre beschäftigt waren“,
erinnert sich ein Zeitzeuge, „wurden in Slowenien bezahlt bzw. waren dort krankenversichert.
Wenn sie krank geworden sind, mussten sie nach Slowenien fahren.“34 Zeitweise zahlten sie
sogar darüber hinaus im Herkunftsland Einkommenssteuer, eine Pflicht, die im Herbst 1963
aufgehoben wurde.35
Einige Firmen spezialisierten sich auf die Vermittlung von Arbeitskräften oder auf die Übernahme von Subaufträgen; das deutsche Konsulat Zagreb meldete dem Auswärtigen Amt im
Oktober 1962 einen exemplarischen Fall:
„Der jugoslawische Partner liefert für eine bestimmte Leistung x Arbeitskräfte. Das Honorar
für die Leistung beträgt 8.– DM/St. unter Einschluss aller Soziallasten (Reise, Urlaub, selbst
Leichenrücktransport bei tödlichen Unfällen). Eine verantwortliche Aufsichtsperson, die alle
Streitfragen mit dem Arbeitgeber regelt (auch sofortige Auswechslung unerwünschter Kräfte)
wird ebenfalls gestellt.
32
Betr. Vermittlung jugoslawischer Arbeitnehmer; hier: Arbeitsverträge, BA K, B 149, 3026, Bd. 2.
BA K, B 119, 3028, BfA, Schnellbrief an die Landesarbeitsämter, 18.1.1966.
34
Interview mit Stanislav Gajšek.
35
Konsulat Zagreb an AA, 5.12.1962, BA K, B 149, 6240.
33
9
IOS Mitteilung Nr. 66
In derartigen Werksverträgen wird häufig Schicht-, Samstags- oder Sonntagsarbeit (für die
in Deutschland nur schwer Kräfte zu finden sind) festgelegt. Ebenso wird häufig die Leistung
von 20% und mehr Überstundenarbeit vereinbart.“
Die jugoslawische Seite begrüße solche Werksverträge, „weil
1. der jugoslawische Partner durch Zahlung niederer Löhne an seine Leute das deutsche
Lohnniveau unterbietet und den Transferanteil hoch ansetzt (er ist ja der Arbeitgeber)
und
2. auch die Ersparnisüberweisung von jugoslawischer Seite kontrolliert werden kann. Damit
ist ein beträchtlicher Anteil der 8 DM-Stundenlohnkosten für die jugoslawische Nationalbank Devisenaufkommen, für den jugoslawischen Vertragspartner ergibt sich dagegen
ein hoher Gewinn daraus.“36
Leiharbeitsfirmen, die ihren Firmensitz in Slowenien hatten, waren überwiegend in Bayern
und Baden Württemberg vertreten, dehnten ihr Wirkungsfeld aber auch bis nach NordrheinWestfalen, Hamburg und Berlin aus. Es handelte sich vor allem um zwei slowenische Firmen,
den in Ljubljana, Ortomirova 6, ansässigen IMP – Industrijsko montažno podjetje [Industriemontage-Betrieb] und die RUDIS – Rudarsko industrijska skupnost [Bergbaulich-industrielle
Gemeinschaft] aus Trbovlje, Trg revolucije 7.
Da IMP und RUDIS begannen, mit deutschen Unternehmen ordnungsgemäße Werkverträge
abzuschließen, gab es zunächst von Seiten der Bundesanstalt für Arbeit auch keine Bedenken
gegen die Erteilung einer Arbeitserlaubnis für die bei ihnen beschäftigten jugoslawischen Arbeiter.37 Die ursprünglich mit Bergbauinteressen in Verbindung stehende Firma RUDIS trat als
Vermittler von Arbeitskräften für Siemens und BMW an. Der Bundesanstalt lag 1966 die Nachricht vor, die Firma sei „in München, Augsburg und Stuttgart mit jugoslawischen Arbeitnehmern tätig.“38
Die Tätigkeit von RUDIS, IMP und anderen setzte zwar Mitte der 1960er Jahre ein, erstreckte sich aber über die Zeit der wirtschaftlichen Rezession hinaus und riss auch nach dem
Abschluss des Anwerbeabkommens nicht ganz ab. Das Abkommen garantierte zumindest theoretisch die rechtliche Gleichstellung der von jugoslawischen Firmen rekrutierten Leiharbeiter
mit den durch die Deutsche Kommission angeworbenen Migranten. Aus der regionalgeschichtlichen Perspektive lässt sich zudem für einzelne Fälle konstatieren, dass die frühe Infrastruktur
36
Konsulat der Bundesrepublik Deutschland, Zagreb, an AA, 23.10.1962, in: BA, K, B 149, 6240.
BA K, B 119, 3028, LAA Nordrhein-Westfalen an Bundesanstalt Nürnberg, 13.10.1965.
38
BA K, B 119, 3029, LAA Berlin an Bundesanstalt Nürnberg, 4.1.1966.
37
10
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
der slowenischen Arbeitswanderer, die sich an bestimmten Orten konzentrierten, im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Leiharbeitsfirmen entstand.39
In einer Aussprache zwischen dem DGB und dem Jugoslawischen Gewerkschaftsbund wurde
die Zahl der Jugoslawen, die auf der Grundlage von Werkverträgen in der Bundesrepublik beschäftigt waren, auf 20.000 beziffert. Bei dieser Gelegenheit kursierte auch eine Liste der Firmen aus
Jugoslawien, die berechtigt waren, mit deutschen Geschäftspartnern Werkverträge abzuschließen.40
Für Nordbayern liegen einige Angaben über den Abschluss von Werkverträgen zwischen 13
jugoslawischen und 28 deutschen Firmen vor. Die Verträge betrafen insgesamt 1.031 Arbeitskräfte in der Bau-, Metall- und Elektroindustrie; so wurden per Werkvertrag 85 Montagearbeiterinnen und 47 Montagearbeiter (bei Siemens) eingestellt. Insgesamt warb Siemens Anfang
1969 noch 225 männliche und 513 weibliche Arbeiter in Jugoslawien an.41
In der Elektroindustrie war die Tätigkeit der Leiharbeitsfirmen auch mit einem anderen spezifischen Aspekt der Arbeitsmigration verbunden: der Frauenarbeit.42 Dies gilt vor allem für
die Siemens-Betriebe in Berlin, die Arbeitskräfte aus den Werken in München abzogen und die
zusammen mit AEG dafür sorgten, dass in den Westteil der Stadt deutlich mehr Frauen als
Männer aus Jugoslawien gelangten.43
Die Tätigkeit der jugoslawischen Firmen rief Proteste in der Öffentlichkeit hervor; daran
beteiligte sich neben den Gewerkschaften auch die Presse.44 Mitte der 1960er Jahre erwies es
sich jedenfalls als notwendig, das Auftreten der Unternehmen aus dem Südosten zu disziplinieren und den Status der für sie arbeitenden Männer und Frauen zu regeln. Diesem Zweck diente
der sogenannte ‚Schnellbrieferlass‛ der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 9.2.1966.45
39
Interview mit Stanislav Gajšek; RdErl. 73, Dienstblatt 1969, Nr. 15, S. 320–323, hier S. 323. Rass, Institutionalisierungsprozesse, S. 448.
40
AdsD, IGM-Archiv, Arbeitskreis Ausländische Arbeitnehmer, 5/IGMA260018, Vorläufiges Ergebnisprotokoll
über die 3. Sitzung der ständigen Deutsch-jugoslawischen Gewerkschaftskommission, Dubrovnik, 10.9. bis
14.9.1972, S. 2–5.
41
LAA Nordbayern, Beschäftigung, Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer, Erfahrungsbericht
1969, BA K, B 119, 3016, S. 5–7.
42
Mattes, „Gastarbeiterinnen“; Morokvašić, Jugoslawische Frauen. Vgl. die Bemerkung von Baučić (Porijeklo, S. 96),
wonach „Frauen hauptsächlich in der elektrotechnischen und in der Textil-Industrie sowie im Dienstleistungssektor
beschäftigt waren.“
43
BA K, B 119, 3013, LAA Berlin, Beschäftigung, Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer.
Erfahrungsbericht 1970, S. 4.
44
Der Mannheimer Morgen etwa berichtete im Februar 1966 ausführlich über die Präsenz einer Leiharbeitsfirma
aus Belgrad auf den Baustellen von BBC und Holzmann AG. „Tito kassiert auf Seckenheimer Baustelle“,
Mannheimer Morgen, 18.2.1966.
45
BA K, B 119, 3028, BfA an Landesarbeitsämter und Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Frankfurt 9.2.1966
(Sogenannter ‚Schnellbrieferlass‘.)
11
IOS Mitteilung Nr. 66
Darin wurden die Landesarbeitsämter angewiesen zu prüfen, ob sich Lohn- und Arbeitsbedingungen bei den ausländischen Firmen im Rahmen der bundesdeutschen sozialen Ordnung
bewegten. In Zweifelsfällen sei die Bundesanstalt einzuschalten. In einem Begleitbericht war
zu melden, ob die jugoslawischen Arbeitnehmer zu den gleichen Lohnbedingungen wie vergleichbare deutsche beschäftigt waren. Zudem verlangte die Bundesanstalt nach Informationen
zur Frage, ob die Beschäftigten bzw. die Firmen Lohnsteuer und Beiträge zur deutschen Sozialversicherung abführten. Werde festgestellt, dass eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt sei,
so könne man auch keine Arbeitserlaubnis erteilen.
Damit war die Problematik der Leiharbeit zwar von der zuständigen Behörde administrativ
einer Lösung näher gebracht, nicht jedoch endgültig rechtlich geregelt. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6.4.1967 etwa sprach sich gegen das staatliche Monopol auf Arbeitsvermittlung aus, das bis dahin die Rechtsgrundlage für die Arbeitswanderung gewesen war.
Das Urteil begünstigte so indirekt die Tätigkeit von Leiharbeitsfirmen. Gegen Ende der Anwerbephase, im August 1972, verabschiedete der Bundestag das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
welches die bis heute gültige Regelung der Leiharbeit einführte.
In der Phase zwischen dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders und der einsetzenden Rezession nahmen einige deutsche Betriebe die Dienste der von den slowenischen Firmen IMP
und RUDIS bereitgestellten Arbeiterinnen und Arbeiter in Anspruch. Dabei wurden die von der
Nürnberger Bundesanstalt im Schnellbrieferlass vorgegebenen Regeln teils strikt beachtet, teils
aber auch vernachlässigt. Ohnehin bildete die Vermittlungstätigkeit der beiden Firmen nur die
Spitze des Eisbergs. Verborgen blieben ungezählte namenlose Vermittler von Arbeiterinnen
und Arbeitern, die zu Zehntausenden unter Tarif bezahlt und gegebenenfalls ohne viel Aufhebens in das Herkunftsland zurückgeschickt wurden.46
Die Gewerkschaften verwendeten einige Energien darauf, diese Missbräuche aufzudecken;
aus gewerkschaftlichen Quellen stammt auch die höchste Angabe zur Zahl der illegal oder halblegal beschäftigten Leiharbeiter aus den Entsendeländern der Gastarbeitermigration: 300.000.47
In einer Sonderausgabe des Evangelischen Pressedienstes zur illegalen Ausländerbeschäftigung
war von 4.000 Firmen die Rede, die bei der Bundesanstalt eine Erlaubnis beantragt hatten, Arbeitskräfte zu vermitteln. Weitere 1.000 der Bundesanstalt bekannte Leiharbeitervermittler hatten
sich geweigert, einen entsprechenden Antrag einzureichen, setzten aber die Praxis des Verleihens
46
Wenn sich solche Vermittler in dem naiven Glauben an die Bundesanstalt wandten, sie könnten von dieser in
der gewählten Funktion anerkannt werden, erhielten sie aus Nürnberg einen abschlägigen Bescheid.
47
Max Diamant, Zum sozialen Problem der illegalen Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern in der
Bundesrepublik. Referat im Rahmen der 28. Konferenz für Ausländerfragen der EKD, Frankfurt/M., Juli 1973
sowie IG Metall, IG Metall Bibliothek FfM., Beratungsbericht. Zu den Fragen „Gewerkschaft und ausländische
Arbeitnehmer“, S. 4, beide in Bibliothek der IG Metall, Frankfurt/M.
12
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
von Arbeitskräften fort.48 Ein 1969 entstandener Bundesverband für Zeitarbeit, dem überwiegend
ausländische Firmen angehörten, setzte es sich zum Ziel, kurzfristig einen Marktanteil von 5 Prozent zu besetzen, wovon dann immerhin 1,2 Millionen Arbeiter und Angestellte betroffen gewesen wären.49
Der Vorsitzende des slowenischen Exekutivrates Stane Kavčič äußerte sich während eines
Ljubljana-Besuchs des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel am 16.6.1969 zufrieden
über die Tätigkeit slowenischer Baufirmen in der Bundesrepublik Deutschland. „Die diesbezügliche Zusammenarbeit habe sich in den letzten drei Jahren verzehnfacht und könne sich
nochmals verzehnfachen.“50 Vor diesem Hintergrund sollen die im Folgenden ausgewerteten
Dokumente über slowenische Leiharbeitsfirmen einige Mechanismen der Leiharbeit deutlich
machen. Immerhin bekundeten die jugoslawischen Gewerkschaften ebenfalls seit 1969 ihre Bereitschaft, in Jugoslawien selbst gegen die Praxis der Leiharbeit vorzugehen.51
Bevor die einzelnen Siemens-Unternehmen 1966 zur Siemens AG zusammengeschlossen
wurden, griffen vor allem zwei der drei Teilgesellschaften auf die Arbeit slowenischer Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter zurück. Nachdem 1949 entschieden worden war, die Firmensitze von
Siemens & Halske nach München und die von Siemens-Schuckert nach Erlangen zu verlegen,
behielten beide Firmen auch Werke in Berlin (West) bei, die einen stetigen Bedarf an Arbeitskräften, vor allem an jungen Frauen, hatten. Die Migrantinnen wurden in der Kabelindustrie und
bei Haushaltsgeräten verlangt, deren Fertigung ein entsprechendes Geschick erforderten.52
Die Niederlassung von Siemens-Schuckert in München beschäftigte im August 1965 im firmeneigenen Apparatewerk 130 Jugoslawen und etwa 100 Jugoslawinnen; die meisten stammten aus slowenischen Industriestädten (Ljubljana, Trbovlje, Kranj, Jesenice). Die von RUDIS
herangeholten Arbeiterinnen und Arbeiter unterstanden der Aufsicht von Angestellten der deutschen Firma; nur für die Betreuung außerhalb des Betriebs war eine eigene, von der Leiharbeitsfirma beschäftigte Kraft zuständig. Einen Teil ihres Lohnes erhielten die Beschäftigten von
der vermittelnden Firma in Deutschland ausgezahlt, den größten Teil jedoch in der Heimat.53
48
Hermann Ernst, Zur illegalen Beschäftigung von Ausländern, epd Sonderausgabe – Illegale Ausländerbeschäftigung, S. 5.
49
Protokoll über ein Gespräch zwischen Vertretern der Bundesanstalt für Arbeit und des DGB, Düsseldorf,
28.11.1972, AdsD, IGM Archiv, Probleme der ausländischen Arbeiter in der BRD, 5/IGMA260003.
50
Der Bayerische Staatsminister für Bundesangelegenheiten an StK, 4.7.1969, BayHStA, StK 15314.
51
AdsD, IGM Archiv, Probleme der ausländischen Arbeiter in der BRD, 5/IGMA 260017, Protokoll über die
Sitzung des Arbeitskreises „Ausländische Arbeitnehmer“ am 12. Dezember 1969 in Düsseldorf, S. 4.
52
Vgl. LAA Berlin, Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer, 20.1.1971, S.3 (BA K, B 119/3015; siehe auch
Mattes, „Gastarbeiterinnen“, S. 161f.
53
BA K, B 119, 3027, Bd. 2 „Grundvertrag“ zwischen Siemens-Schuckertwerke in München und der Firma Rudis.
Vgl. Milan Pogačnik, ‚Čimveč zaslužiti čimprej domov‘, Delo, 1.6.1965.
13
IOS Mitteilung Nr. 66
Die Firma geriet alsbald in einen Konflikt mit dem örtlichen Arbeitsamt, das feststellte, RUDIS kontrolliere in keiner Weise die Arbeitsleistung des vermittelten Personals und stelle weder
Werkzeug noch Arbeitsschutzmittel bereit. Insofern handele es sich nicht um ein Arbeitsverhältnis im Sinne des von der Bundesanstalt herausgegebenen Erlasses. Die beantragte Arbeitserlaubnis für die Jugoslawinnen und Jugoslawen sei deshalb abzulehnen.54
Im Oktober konstatierte das Arbeitsamt München noch einmal, die RUDIS-Arbeiter seien
„dem Siemens-Betrieb eingegliedert“, weshalb man auch nur zur Erteilung einer vorläufigen
Arbeitserlaubnis bereit sei.55 Im Juni 1966 benötigte Siemens-Schuckert dann weitere 55 männliche Fachkräfte und 50 Frauen, „die sämtlich neu einreisen werden“. Die Einstellung erfolgte
abermals über einen Werkvertrag mit der Firma RUDIS.56
Wiederum kritisierte die Arbeitsbehörde, die weiblichen Kräfte seien so in die „einheimische“ Belegschaft des Werkes eingebaut worden, „daß eine unterscheidbare Teilfertigung, die
Gegenstand eines Vertrages mit Rudis sein könnte, gegenüber der Gesamtfertigung des Apparatewerks München nicht auszusondern war.“
Ein Vertreter der Siemens-Hauptverwaltung kündigte daraufhin Korrekturen an. Die Beschäftigung von weiblichem Personal aus Jugoslawien sei ohnehin rückläufig. In Zukunft solle
aber eine Vermengung mit dem Stammpersonal des Werks vermieden werden.57
Nach dem Abschluss des Anwerbeabkommens vom April 1968 war Siemens vor allem bestrebt, junge Arbeiterinnen zu rekrutieren, da sie als besonders geschickt galten.58 Für den ganzen Siemens-Konzern – in Norddeutschland vor allem für die Siemens-Bauunion – arbeiteten
nach slowenischen Angaben zwischen 1968 und 1973 in sieben verschiedenen deutschen Städten 911 Slowenen, mit Schwerpunkten in München (501), Nürnberg (131) und Hamburg (148).
Die Verträge wurden des Öfteren verlängert, so dass aus der kurzfristigen Arbeits- eine mittelfristige Migrationsperspektive wurde, mit allen dazugehörigen Konsequenzen. Der schon zitierte Slowenenpfarrer aus Ingolstadt berichtet: „Viele kamen damals zu Siemens, auch nach
Erlangen. Ich kenne jemanden, der hat dreizehn Jahre in Erlangen gearbeitet und über RUDIS
alles erledigt, sogar seinen Lohnsteuerausgleich.“59
Die Tätigkeit der Leiharbeitsfirmen erstreckte sich auch auf die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, wo sie jedoch schwerer nachzuweisen ist. Einige der eingangs genannten Städte, in
54
Vgl. die Belege in Wörsdörfer, Slowenische Deutschland-Migrationen, S. 320.
Ebd.
56
Ebd.
57
Ebd.
58
Vgl. Mattes, „Gastarbeiterinnen“, S. 181f.
59
Interview mit Stanislav Gajšek.
55
14
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
denen Leiharbeitsfirmen tätig waren, gehören zu den Hauptstandorten der bayerischen Automobilindustrie. Andererseits lässt sich die Präsenz von Leiharbeitsfirmen für das Auto Union bzw.
Audi-Werk in Ingolstadt mit seinem starken slowenischen Belegschaftsanteil nicht nachweisen.
Unter den Dokumenten der Nürnberger Bundesanstalt findet sich ein Werkvertrag zwischen
BMW und RUDIS.60 In der Korrespondenz werden die bei BMW vorzunehmenden Arbeiten
definiert; es handle sich um Tätigkeiten „außerhalb der normalen Bandfertigung“, vor allem
um „Korrektur- und Abschlussarbeiten“. Dabei nehme die Arbeitsgruppe RUDIS an den vom
Band produzierten Wagen „die erforderlichen Nachbesserungs- und Finisharbeiten“ vor. Das
Werk übergebe diese Arbeiten im Ganzen an die Gruppe. Diese sei sodann in Eigenverantwortlichkeit verpflichtet, die bearbeiteten Wagen ordnungsgemäß zu übergeben. Dies sei „die von
der Rudis-Gruppe geschuldete vertragliche Leistung.“ 61 Insgesamt beschäftigte BMW zeitweise eine Gruppe von 50 aus Slowenien und vor allem aus Trbovlje stammenden Lackierern,
Autoelektrikern und Blechschlossern.62
Hier wurden einige Grundlagen für die spätere Tätigkeit slowenischer Arbeiter bei BMW
gelegt, und zwar sowohl aus Slowenien herbeigeführter wie von Audi-NSU in Ingolstadt ‚ausgeliehener‛ Metallarbeiter. Anders als bei den Betrieben der Elektrobranche und der Bauindustrie fehlen für BMW Angaben, wann die Zusammenarbeit mit der Leiharbeitsfirma endete. Ein
wichtiger Grund dafür ist, dass keine Archivalien zur Personalentwicklung der Autoindustrie
von den großen Firmen selbst zu erhalten sind. Die Beschäftigung von Slowenen in der Automobilfirma hielt über die Rezession von 1967/68 hinaus an oder wurde doch zumindest mit
dem Anwerbeabkommen wieder aufgenommen.
Letztlich bildeten die Leiharbeitsfirmen mit ihren Werkverträgen eine Brücke zwischen der
‚politischen Migration‛ von Asylbewerbern und der eigentlichen Gastarbeitermigration unter
den Vorzeichen des Anwerbeabkommens. Die Tatsache, dass sich slowenische Arbeiterinnen
und Arbeiter auf diese Form der Arbeitswanderung einließen, verweist auf das zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der slowenischen Teilrepublik bestehende Gefälle im Lebensstandard. Die massive Präsenz slowenischer Firmen wiederum kann als Indikator innerjugoslawischer Disproportionen gewertet werden. Mängel beim Arbeitsschutz wurden sowohl von
deutscher als auch von jugoslawischer Seite aus beklagt.63
60
Vgl. die Belege in Wörsdörfer, Slowenische Deutschland-Migrationen, S. 321.
Ebd.
62
Ebd.
63
Protokoll über die Besprechung der jugoslawischen Delegation des Rates der Republiks- und
Gebietsgemeinschaften für Angelegenheiten der Beschäftigung und des Vorstandes der Bundesanstalt für Arbeit,
Nürnberg, 10./11.12. 1973 und Düsseldorf, 14.12.1973, BA K, B 119, 4724, S. 7.
61
15
IOS Mitteilung Nr. 66
Mit dem Anwerbestopp des Jahres 1973 betonte die deutsche Seite, es sei nicht mehr möglich, die Kapazitäten jugoslawischer Baufirmen voll auszunutzen. Schon begonnene Arbeiten
sollten noch abgewickelt werden; Arbeitserlaubnisse für neue Vorhaben und Verträge werde es
jedoch nicht geben.64
Das Arbeitsministerium und die Bundesanstalt für Arbeit bekräftigten diesen Standpunkt im
Mai 1974 noch einmal und verlangten für Ausnahmefälle auf jeden Fall eine Berücksichtigung
der entsprechenden Klauseln des Anwerbeabkommens. Trotzdem reisten vom Zeitpunkt des
Anwerbestopps bis Mitte Juli 1974 noch 621 „Werkvertragsarbeitnehmer mit Sichtvermerk“ in
die Bundesrepublik ein.65
64
65
Protokoll Besprechung Republiks- und Gebietsgemeinschaften, S. 5.
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Rundbrief, 30.7.1974, BayHStA, MInn 62882.
16
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Die ‚Ingolstädter Slowenen‘
Die Ingolstädter Auto Union AG, der größte Industriebetrieb im mittelbayerischen Donaugebiet,
war zugleich das einzige deutsche Unternehmen, in dem nach 1968 zeitweise deutlich über 1.000
slowenische Arbeiter beschäftigt waren.66 Eine Besonderheit war die Herkunftsregion vieler Migranten: Das bis 1918 noch zum ungarischen Reichsteil der Habsburgermonarchie gehörige
Prekmurje war seit dem 19. Jahrhundert an transnationale Migrationskreisläufe angeschlossen.
„Der Urgroßvater ging nach Amerika“, berichtet eine Zeitzeugin, „der Großvater war 13 Jahre in
Frankreich und ist dann 1939, als der Krieg ausgebrochen ist, wieder zurück. Meine Mutter war
als Saisonarbeiterin in Österreich und ich bin 1969 in Deutschland gelandet.“67
In der Zwischenkriegszeit war das Übermurgebiet hauptsächliches Herkunftsgebiet landwirtschaftlicher Saisonwanderer, für die es eigene, zwischen dem Deutschen Reich und dem
Königreich Jugoslawien abgeschlossene Anwerbeabkommen gab. Diese Saisonmigration blieb
zeitlich und räumlich eng begrenzt, so dass sie in keinerlei Verbindung zu anderen Wanderungsbewegungen trat.
Seit 1968 kam ein großer Teil der slowenischen Arbeiter von Auto Union und Audi NSU dann
aus der Umgebung von Murska Sobota und aus dem auf beiden Ufern der Mur gelegenen
Pomurje.68 Das Prekmurje, zu dem neben der regionalen Hauptstadt Murska Sobota auch Zentren
wie Gornja Radgona, Lendava und Ljutomer gehören, war jahrhundertelang Teil Ungarns gewesen
und erst 1918 dem neuen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zugeschlagen worden.
Zu den Hauptmotiven für die Auswanderung gehörte, dass die Bauernhöfe des ländlichen
Gebiets zu klein waren, um alle Familienmitglieder zu ernähren. Junge Leute fanden in der
Region nur sehr schwer Arbeit, die zudem schlecht bezahlt war. Verschärfend kam hinzu, dass
die titoistische Agrarreform nur Höfe tolerierte, die weniger als 10 ha Land umfassten – das
galt für ganz Jugoslawien, mit Ausnahme der Hochgebirgsregionen. Wurde dieser Hof durch
eine Erbschaft über die 10 ha hinaus vergrößert, dann zwang das Gesetz den Bauern, die zusätzlichen Hektar „gegen Entschädigung dem Volksvermögen zu überlassen.“69
66
Die ‚Mittellage‘ Ingolstadts und des mittelbayerischen Donaugebiets rührt daher, dass dort fünf der insgesamt
sieben bayerischen Regierungsbezirke aufeinander treffen: Mittelfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern
und Schwaben.
67
Interview mit Marija Schmid. Zum ganzen Problemkomplex der Migration aus dem Pomurje auch Kuzmič,
Slovenski izseljenci; Korpič-Horvat, Zaposlovanje in deagrarizacija; Lukšič Hacin, Sesonstvo in izseljenstvo.
68
Prekmurje ist die traditionelle, vormals ungarische Landschaft jenseits der Mur. Als Pomurje bezeichnet man
demgegenüber eine nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtete Verwaltungseinheit, die neben dem Prekmuje auch
Gebiete südlich bzw. westlich der Mur umfasst.
69
Bonač, Strukturwandlungen, S. 425. Noch Grund besitzende Arbeiter erhielten weniger oder überhaupt kein
Kindergeld. Etwa zwei Drittel aller Migranten aus dem Pomurje waren 1971 Bauern (Fartek/Franko, Izseljenci iz
vasi, S. 508f.; Korpič-Horvat, Zaposlovanje in deagrarizacija, S. 89.)
17
IOS Mitteilung Nr. 66
Auch Anfang der 1980er Jahre blieb die Region sehr stark landwirtschaftlich geprägt; in der
Gemeinde Murska Sobota bestanden noch 1.500 Höfe mit Viehzucht und 2.000 für die Getreideproduktion. Neben den 50% der im Agrarsektor beschäftigten Einwohner gab es auch eine
Industriearbeiterschaft in der Metall-, Textil- und Holzbranche. Der begrenzte industrielle Aufschwung wurde u.a. durch zurückgekehrte Migranten ermöglicht.
Das Prekmurje ist die einzige Region des slowenischsprachigen Raumes, in der der Katholizismus konfessionell nicht absolut dominiert. Dementsprechend gelangten auch slowenische
Lutheraner aus der Region nach Ingolstadt, wo sie von dem für die Migrantenmission in
Deutschland verantwortlichen evangelischen Geistlichen Ludvik Jošar pastoriert wurden, der
in den 1950er Jahren u.a. in Heidelberg, Erlangen und Hamburg studiert hatte.70
Unter den Vornamen der ‚Ingolstädter Slowenen‛ finden sich „Bela“ oder „Imre“, Namen
also, die in Slowenien sonst ungebräuchlich sind und die auf die nahe Grenze zu Ungarn verweisen. Traditionell leben im Prekmurje neben den slowenischen Prekmurern (Katholiken oder
Evangelische) auch Angehörige der ungarischen Minderheit, Roma und Juden.
Einer Interviewpartnerin zufolge kam der Kontakt der Firma Auto Union zu den Arbeitern
aus dem Pomurje zustande, weil diese „zum Teil deutsch gesprochen haben und dann auch,
weil das eine landwirtschaftlich geprägte Provinz war, ohne Industrie oder mit nur sehr wenig
Industrie, wo sehr viele junge Leute ohne Perspektive waren. […]. So wurde also Murska
Sobota ausgesucht, und der Direktor des Arbeitsamtes von Murska Sobota, der sprach perfekt
deutsch. Sie haben sich also mit ihm in Verbindung gesetzt, und so ist auch die Anwerbekommission heruntergegangen, und sie haben dann Männer rekrutiert, nur Männer, die einerseits
volljährig sein mussten und zugleich nicht älter als dreißig sein durften.“71
Es lohnt, auf einige firmengeschichtliche Spezifika des Betriebs näher einzugehen: Anfang
der 1960er zählte Auto Union eher zur Nachhut der bundesdeutschen Automobilbranche; die
Hauptprodukte, DKW-Personenwagen und -Kleinlaster, galten als antiquiert, der serienmäßig
eingebaute Zweitaktmotor als nicht mehr zeitgemäß. Allmählich verlor Daimler, Inhaber von
Auto Union, das Interesse an der Tochterfirma; seit 1962 verhandelte dann Großaktionär Friedrich Flick mit der Volkswagen AG über eine Neuordnung der deutschen Automobilindustrie
mit dem Ziel, die amerikanische Konkurrenz einzudämmen, die über ihre Marken Ford und
Opel in der Bundesrepublik erhebliche Marktanteile hielt. Verhandlungsgegenstand war die
Übernahme von Auto Union durch den Volkswagenkonzern; tatsächlich schien die Ingolstädter
70
Kuzmič, Slovenski protestanti, S. 157; ‚Ludvik Jošar – upokojeni duhovnik izredno naprednih misli in odprtega
duha‘, Gorički list, 15.6.2012. Jošar hielt seit 1969 je zweimal jährlich Gottesdienste in Ingolstadt und Reinbach
bei Stuttgart. Siehe auch die Angaben in EKD, Länderinformation, S. 36f.
71
Interview mit Marija Schmid.
18
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Firma mit ihrem Spektrum an Klein- und Mittelklassewagen sowie leichten Lieferautos eher zu
den Wolfsburgern zu passen als zu den Stuttgartern, denn Daimler Benz war auf schwere Nutzfahrzeuge und hochzylindrige Limousinen spezialisiert.72
Zum Zeitpunkt des Kaufs bestand noch keine Klarheit darüber, ob Auto Union als eigenständiger Faktor erhalten bliebe, oder ob Volkswagen das Werk binnen kürzester Zeit in eine
weitere deutsche VW-Produktionsstätte (‚Werk fünf ‛) umwandelte, das dann mit negativen
Folgen für die Qualifikationsstruktur der Belegschaft in Ingolstadt. Das Problem sollte sich im
Verlauf der folgenden Jahre noch oft stellen: zunächst im Zusammenhang mit der Übernahme
durch VW, später dann abermals im Verlauf der Fusion mit NSU. Stets ging es darum, das
Ingolstädter Werk insgesamt intakt zu erhalten. Hätte VW einmal Planung, Technik, Design
und Vertrieb aus Ingolstadt abgezogen, dann bliebe der Stadt nur noch eine in sich wenig differenzierte, auf die Tätigkeit am Band reduzierte Arbeiterschaft mit großenteils ländlichen
Wurzeln, ‚Massenarbeiter‛ eben, wie es in der italienischen Terminologie der späten 1960er
Jahre hieß. Erst mit der Gründung der AUDI AG und mit der Verlegung des Firmensitzes von
Neckarsulm nach Ingolstadt im Jahr 1985 war diese Frage endgültig vom Tisch.
In den 1960er Jahren aber wurde tatsächlich ein Teil der Produktion des VW Käfers, der
sich anders als die DKW-Fahrzeuge noch einer gewissen Beliebtheit erfreute, an die Donau
verlegt, während die Techniker von Auto Union Anstrengungen unternahmen, das eigene Angebot zu modernisieren. Nachdem die Zweitakter-Produktion 1966 endgültig ausgelaufen war,
wollte man so bald wie möglich den Beweis antreten, dass in der mittlerweile vielfach belächelten Firma Leben war.
Etwa zeitgleich mit dem Eintreffen der ersten Arbeiter aus Slowenien kam die Auto Union in
Ingolstadt mit einem zunächst ohne Wissen der VW-Spitze entwickelten neuen Fahrzeug auf den
Markt. Der Autohersteller, der zuletzt vor allem Kleinwagen produziert hatte, stellte dem Publikum mit dem Audi 100 seinen ersten Wagen der gehobenen Mittelklasse vor. Das Fahrzeug erhielt von der Kritik nur die besten Noten, da es über einen leistungsfähigen Motor und eine dem
Zeitgeist entsprechende Karosserie verfügte. Zwischen 1968 und 1976 baute die Belegschaft des
Ingolstädter Werks – darunter auch etwa 1.500 Männer und Frauen aus Slowenien – insgesamt
800.000 Fahrzeuge dieses Typs. Audi hatte als Marke weithin Akzeptanz gefunden, zumal seit
einiger Zeit weitere Modelle auf den Markt gelangt waren, die sich im Gefolge des Audi-100Booms ebenfalls gut verkauften.73
Aus der firmengeschichtlichen Perspektive betrachtet trafen die slowenischen Migranten
also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ein, um Nutzen aus dem Aufschwung ziehen zu
72
73
Schlemmer, Industriemoderne in der Provinz, S. 269f.
AUDI AG/Audi Tradition, Rad der Zeit, S. 223f.; Koller, Ingolstadt plant 1966–1971, S. 36.
19
IOS Mitteilung Nr. 66
können, den die Auto Union mit dem Bau der verschiedenen Audi-Varianten verzeichnete. Umgekehrt konnte der VW-Konzern auf eine relativ kompakte Gruppe von Arbeitsmigranten, für
die Ingolstadt mehr wurde als nur ein Ort, an dem der oder die Einzelne für kurze Zeit Arbeit
gefunden hatte. Tatsächlich war die Audi-Modellpalette beachtlich und einiges deutete darauf
hin, dass man den Erfolg der Jahre 1969/70 in die Zukunft hinein fortschreiben könnte.
Andererseits fanden die slowenischen Arbeitswanderer mittelfristig eine strukturell krisenanfällige Beschäftigungssituation vor, was alle eventuell schon vorhandenen oder gerade erst frisch
diskutierten Pläne eines längerfristigen Aufenthalts an der Donau zumindest in Frage stellte. Insgesamt war die persönliche Situation der slowenischen Audi-Arbeiter wenig überschaubar: Neben der Stabilität verheißenden, immer mehr von Wolfsburg aus gesteuerten Konzernpolitik hatten sie es mit wenig kalkulierbaren ökonomischen Krisenmomenten zu tun, auf die die Werksleitung mit Kurzarbeit oder Nichtübernahme von Arbeitern mit kurzzeitigen Verträgen reagierte.
Dies war angesichts einer offensiven Anwerbepolitik des Werkes in Ingolstadt und angesichts einer ausgeprägten Vermittlungsbereitschaft der örtlichen Arbeitsverwaltung in Slowenien besonders misslich, hieß es doch, die hohen Erwartungen einer Vielzahl von Menschen
sehr rasch zu enttäuschen.
Othmar N. Haberl nennt den slowenischen Fall einen „Extremfall“, da in der nördlichen
Teilrepublik „praktisch jedem Antrag auf Abwanderung zugestimmt wurde“, während sich
etwa für Montenegro erst seit 1969 die Bereitschaft nachweisen lasse, „den Abwanderungsantrag zu genehmigen.“74
Im Folgenden ist zunächst die Frage zu diskutieren, welche Arbeitskräfte die Firma aus Ingolstadt in Slowenien überhaupt rekrutierte. Zu berücksichtigen ist dabei auch die Tätigkeit der
deutschen Anwerbekommission in Jugoslawien und speziell in der nördlichen Teilrepublik. Sie
setzte auch dann gewisse Maßstäbe für die Einstufung und Rekrutierung von Arbeitskräften,
wenn das Unternehmen wie im Falle Auto Union großenteils auf eigene Faust bzw. in Zusammenarbeit mit der regionalen Arbeitsverwaltung in Slowenien operierte.
Die deutsche Kommission in Jugoslawien teilte die zu rekrutierenden Menschen in vier
Hauptgruppen ein:
Die hochqualifizierten, d.h. fertig ausgebildeten Arbeitnehmer mit mehrjähriger Berufspraxis.
Die qualifizierten Arbeitssuchenden, die zwar über eine Ausbildung, jedoch noch nicht
über eine Berufspraxis verfügten.
74
Haberl, Abwanderung von Arbeitskräften, S. 51.
20
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Sogenannte „halbqualifizierte Arbeitskräfte“, worunter man Anlernkräfte verstand.
Die Masse der Migranten ohne jegliche berufliche Qualifikation, die laut Erfahrungsbericht von 1969 über 70% der Anzuwerbenden ausmachte.75
Bis zum Abschluss des Anwerbeabkommens und zum Teil auch noch in den Jahren danach
wurden in den nördlichen Teilrepubliken Jugoslawiens viele Facharbeiter für die deutsche Industrie angeworben. Der Anteil qualifizierter Arbeitskräfte lag bei den Jugoslawen zwischen
1968 und 1972 ohnehin besonders hoch, deutlich höher als bei den Migranten aus den anderen
Anwerbeländern. Die Strukturschwächen des Pomurje und des Prekmurje als bevorzugten Rekrutierungsfeldern der Ingolstädter Industrie verringerten allerdings die Chancen auf eine Rekrutierung fertig ausgebildeter und womöglich mit einem hohen Grad beruflicher Erfahrung ausgestatteter Arbeiter sogleich wieder.76
Und dies, obwohl in Slowenien eigentlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit bestand, die
stärker gefragten Angehörigen der beiden ersten Gruppen für deutsche Betriebe gewinnen zu
können.77 Die slowenische Regel galt also nicht für die durchschnittliche Qualifikationsstruktur
der Bevölkerung in jenen noch stark agrarisch geprägten Regionen, aus denen die meisten ‚Ingolstädter Slowenen‛ kamen. Tatsächlich sah der Bericht der Deutschen Delegation von 1969
auch in der Landwirtschaft eine „beachtliche Arbeitsmarktreserve“; er bezog sich damit vor
allem auf die südlichen Teilrepubliken Jugoslawiens, hätte aber ebenso gut kleinere Räume wie
das Murgebiet erwähnen können.78 Auf den von Ivo Baučić veröffentlichten Karten zur jugoslawischen Migration erscheint das slowenische Gebiet an der ungarischen Grenze als eine jener Landschaften, aus denen auch im gesamtjugoslawischen Maßstab betrachtet ein besonders
hoher Bevölkerungsanteil migrierte.79
Über die Deutsche Delegation wurden seit Anfang 1969 auch „Hilfskräfte und Angelernte
in größerem Umfang nach Deutschland vermittelt.“80
75
BA K, B 119, 3019, BfA, DDJ, Erfahrungsbericht 1969, S. 4.
Haberl, Abwanderung von Arbeitskräften, S. 51; Kiefer, Entwicklungspolitik in Jugoslawien, S. 56. Im Planjahrfünft
1971/75 galten in Slowenien 11 von 60 Gemeinden als ‚unterentwickelt‘, darunter waren Lendava, Ljutomer, Murska
Sobota im Pomurje/Prekmurje sowie Ormož, Šentjur pri Celju und Šmarje pri Jelcah in der Untersteiermark.
77
Die Volkszählungsdaten von 1971 zeigten, „dass der Anteil der in Slowenien beschäftigten qualifizierten Arbeiter
(27,5%) vom Anteil der im Ausland beschäftigten (42,9%) weit überflügelt wurde.“ (Drnovšek, Slowenien in
Bewegung, S. 46.) Das slowenische Innenministerium gab 1980 den Anteil der qualifizierten Arbeitskräfte unter den
Migranten aus Slowenien sogar mit 65% an (AS 1931, sk. 2322, Republiški sekretariat za notranje zadeve SR
Slovenije. Uprava za analitiko, Delavci na začasnem bivanju in delu v tujini, Dezember 1980, S. 29.)
78
BA K, B 119, 3019, BfA, DDJ, Erfahrungsbericht 1969, S. 5.
79
Vgl. Baučić, Radnici u inozemstvu, Beilage 6, wo vor allem die im Süden des Prekmurje gelegenen Kommunen
Gaberje und Lendava zusammen mit dem angrenzenden kroatischen Čakovec angeführt sind. Siehe auch Künne,
Außenwanderung jugoslawischer Arbeitskräfte, S. 95ff.
80
[BfA], Repräsentativuntersuchung, S. 66.
76
21
IOS Mitteilung Nr. 66
Wieviel lässt sich von diesen grundsätzlichen Tendenzen anhand der Quellen in Ingolstadt
selbst verifizieren?
Mitte der 1970er Jahre stellte die Ingolstädter Meldebehörde ihre Daten von der traditionellen Karteikarte auf die EDV-Erfassung um. Aus dieser Zeit sind in den Beständen des Stadtarchivs über 400 Karteikarten erhalten, die eine Annäherung an die Meldedaten der Ingolstädter
Slowenen ermöglichen. Diese Daten sind aussagekräftiger als das Material, das die Stadtverwaltung zur Lage der Slowenen im heutigen Ingolstadt bereithält. Denn die Karteikarten enthalten noch Angaben zu den Herkunftsorten, zur beruflichen Qualifikation und zur Konfession
der Slowenen, die sich in den neueren Ausdrucken nicht mehr finden.
Zwar werden die Migranten nicht explizit als ‚Slowenen‛ bezeichnet. Aber sie sind anhand
der Herkunftsorte und Namen als solche zu identifizieren. Eine erste grundsätzlich mögliche
Lektüre der Karteikarten muss vom Geschlecht und vom Beruf der Zugewanderten ausgehen:
Während für die über 150 erfassten Frauen selten eine Berufsangabe erfolgt, werden fast zwei
Drittel der Männer schlicht als „Arbeiter“ klassifiziert. Daneben gibt es einige weitere nicht
direkt mit einer Branche oder einem Industriezweig in Verbindung stehende Kategorien. So
werden 27 angelernte Arbeiter, elf Hilfsarbeiter, neun Maschinenarbeiter und zwei Lehrlinge
angeführt, von denen jeweils unklar bleibt, wo sie tatsächlich tätig waren.
Zwar könnte man mutmaßen, dass sich hinter einem Teil der „Arbeiter“ letztlich auch Facharbeiter verbargen, doch scheint die Kartei insgesamt zu bestätigen, dass ein großer Teil der
Slowenen in Ingolstadt keine eigentliche berufliche Qualifikation vorweisen konnte, während
sich eine deutliche Minderheit auf diverse Berufsgruppen verteilte. Der ländliche Charakter der
Herkunftsregion Pomurje/Prekmurje brachte es mit sich, dass viele der Angeworbenen nie zuvor einen Industriebetrieb von innen gesehen hatten. Auf der anderen Seite kam auch ein Teil
der kleinen Minderheit, die sich auf diverse Berufsgruppen und Branchen verteilte, aus der
nordöstlichen Grenzregion. An erster Stelle standen die Metallindustrie und insbesondere der
Fahrzeugbau mit Kfz-Mechanikern (fünf), Schlossern, Auto- und Maschinenschlossern (zusammen acht), Montagearbeitern, Formern, Schleifern, Schweißern und Drehern (jeweils einem) sowie Autolackierern (drei). Dahinter rangierte das Baugewerbe mit Maurern (vier),
Elektrikern (zwei), Installateuren, Schreinern, Zimmerern, Eisenanstreichern, Bauspenglern
und -helfern (jeweils einem). Vertreten waren auch Techniker und Konstrukteure (je einer) sowie einige wenige Berufe, die nicht unbedingt typisch für die Gastarbeitermigration der später
1960er und frühen 1970er Jahre waren: je ein Chemietechniker, Schriftsetzer, Metzger und
Glasmacher. Damit ist das berufliche Spektrum auch schon weitgehend ausgebreitet; auf den
Karteikarten von weiteren 34 Männern fehlte nicht nur jede genauere Zuordnung, sondern
selbst die allgemeine Bezeichnung „Arbeiter“.
22
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Bei den Frauen liegt der Anteil der nicht beruflich klassifizierten Personen erwartungsgemäß weit
höher als bei den Männern. Es ist daher nicht möglich, sogenannte ‚Nur-Hausfrauen‛ von ihren erwerbstätigen Geschlechtsgenossinnen zu unterscheiden. Eine berufliche Zuordnung findet sich nur für zwanzig aller genannten Personen, darunter sind sechs Montiererinnen und eine Löterin (Metall- oder Elektroindustrie), drei Köchinnen und eine Serviererin (Gastronomie) sowie eine Näherin (Bekleidungsindustrie). Daneben sind noch vier Arbeiterinnen und zwei Hilfsarbeiterinnen ohne weitere Spezifizierung
sowie eine Diplomökonomin angeführt. Anders als in Slowenien selbst, wo auch 1977 berufstätige
Frauen vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, in Schulen und kulturellen Einrichtungen, in der
Gastronomie, in der Tourismusbranche und in der Textilindustrie tätig waren, gab es bei Audi und AEGTelefunken in Ingolstadt Frauen durchaus bereits in sogenannten ‚Männerberufen‘.81 Deutlich wird die
Dominanz der Metallindustrie und insbesondere des Fahrzeug- und Maschinenbaus. Zu nennen ist neben dem Automobilwerk vor allem die Spinnmaschinenfabrik Schubert & Salzer, die nach Angaben der
IG Metall 1973 im Jahresdurchschnitt 3.492 Arbeiter und Angestellte beschäftigte, darunter 82 Jugoslawen, unter diesen wiederum etliche Slowenen.82
Das Landesarbeitsamt Südbayern, dem das AA Ingolstadt unterstellt war, meldete ein Jahr
nach dem Inkrafttreten der deutsch-jugoslawischen Anwerbevereinbarung, bayerische Firmen
hätten bevorzugt versucht, Fachkräfte aus Jugoslawien zu bekommen. Neben der angeblich
besseren „Berufsausbildung der jugoslawischen Arbeitskräfte“ zählten insbesondere deren
„Zuverlässigkeit, ihr Arbeitswille und ihr ruhiges Verhalten in der Freizeit [...]. Dazu kommt
noch, dass ein größerer Teil über deutsche Sprachkenntnisse verfügt.“83 Solche Kenntnisse hatten Jugoslawen beiderlei Geschlechts nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit 1972 zu 13%
in der Schule und zu 9% durch Kontakte mit Deutschen in der Freizeit erworben. Besonders
groß – 68% – war die Gruppe derjenigen, die das Deutsche am Arbeitsplatz erlernt hatten; nur
bei 3% waren die Kenntnisse das Ergebnis von Sprachkursen. 84
Offenbar gab es in Ingolstadt allerdings auch eine von geringen Deutschkenntnissen vieler Arbeiter gekennzeichnete Phase, in der es für die meisten schwer war, Kontakt zur deutschen Umgebung aufzunehmen. Einige Jahre später heißt es über die Gastarbeiterrekrutierung durch bayerische
Unternehmen, diese orientierten sich entweder „am Wunsch nach einer einheitlichen Belegschaft“
81
Alenka Puhar, ‚Slovenke ne žive več samo za dom in družino‘, Slovenski koledar 1980, S. 31–33, hier S. 32.
Der Höhepunkt der Belegschaftsentwicklung lag bei 4.000 Personen. Vgl. Tabelle „Zahlende Mitglieder –
Jahresdurchschnitt 1973“, AdsD, IGM Verwaltungsstelle Ingolstadt, 5/IGMI000 309b. Siehe auch Koller, Ingolstadt plant 1966–1971, S. 38f.; ebd., 1972–1982, S. 31f.
83
LAA Südbayern, Erfahrungsbericht 1969 über Beschäftigung, Anwerbung und Vermittlung ausländischer
Arbeitnehmer, S. 2, in: BA K, B 119, 3019.
84
[BfA], Repräsentativuntersuchung, S. 31. Vgl. den Abschnitt „Vorausbildung in den Anwerbeländern, auf Veranlassung deutscher Arbeitgeber“, in: Beschäftigung, Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer,
Entwurf, BA K, B 119, 3013.
82
23
IOS Mitteilung Nr. 66
oder „an der körperlichen Eignung für schwere Arbeit (Jugoslawen, Türken)“, darüber hinaus aber
auch an „angeblicher geistiger Beweglichkeit […] oder am Vorhandensein von Fach- oder Vorkenntnissen.“85 Im Erfahrungsbericht für das Jahr 1970 heißt es: „Das Baugewerbe stellt wegen der
stärkeren physischen Belastbarkeit bevorzugt türkische Arbeitnehmer ein, während Industriebetriebe – vor allem die Metallindustrie – versuchen, vorwiegend Jugoslawen zu gewinnen.“86
Bei Auto Union erhielten die Migranten zunächst auf ein Jahr befristete Verträge, was der im
Anwerbeabkommen vorgesehenen Regelung entsprach.87 Solange die Unternehmer mit kurzfristigen Verträgen Arbeiter einstellten, die ohnehin planten, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren,
spielte der Faktor ‚Integration‘ nur eine sehr untergeordnete Rolle. Im Zentrum standen die Disponibilität der Arbeitskraft und ihr möglichst effizienter Einsatz im Dienste des Unternehmens.
Da die Automobilarbeiter in der Regel weit davon entfernt waren, die Brücken zu ihrer Herkunftsregion abzubrechen, konnte die Werksleitung auch später noch hoffen, dass sie gegebenenfalls mit einer als ‚angemessen‘ eingeschätzten Abfindung wieder dorthin zurückkehrten.
Spätestens mit dem Einsetzen des Familiennachzugs oder mit der Familiengründung in Ingolstadt strebten allerdings auch die slowenischen Audi-Arbeiter danach, ihre vertragliche Position zu festigen, und zwar relativ unabhängig davon, für welchen Zeitpunkt die gemeinsame
Rückkehr nach Slowenien geplant war.
85
Staatsarchiv München, Arbeitsämter 1960, LAA Südbayern, Ausländische Arbeitnehmer. Beschäftigung,
Anwerbung und Vermittlung. Erfahrungsbericht 1972.
86
BA K, B 119, 3013, LAA Südbayern, Beschäftigung, Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer.
Erfahrungsbericht 1970, S. 4. Italiener galten demgegenüber unter dem Gesichtspunkt ihrer Lohnforderungen, der
häufigen Arbeitsplatzwechsel und der schlechten Arbeitsmoral allenthalben als teuer und unzuverlässig. Vgl. das
ganz ähnlich lautende Urteil des LAA Hessen, Erfahrungsbericht 1969, S. 4f. (ebd. B119, 3016.)
87
Rass, Institutionalisierungsprozesse, S. 448.
24
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Konsolidierung der slowenischen Präsenz
Als im Juli 1969 die Montage des VW-Käfers in Ingolstadt endete, gab es dort schon eine ansehnliche Gruppe slowenischer Arbeiter, die auch den nächsten Schritt in der Firmengeschichte
miterlebten: den Gründungsakt der Audi NSU Auto Union AG. Im Frühjahr 1969 kaufte Volkswagen den Traditionsbetrieb von NSU in Neckarsulm und vereinigte ihn sogleich mit Auto
Union. Öffentlich bekannt gegeben wurde die Fusion von den VW- und NSU-Unterhändlern,
ohne dass überhaupt ein Vertreter aus Ingolstadt zugegen gewesen wäre. Rückwirkend zum
ersten Januar wurden die beiden süddeutschen Firmen unter dem breiten Dach des VolkswagenKonzerns miteinander verschmolzen.88
In Ingolstadt sahen Stadtverwaltung, Werksleitung und Belegschaft den Vorgang mit einiger
Besorgnis, da man um die Eigenständigkeit des Werkes fürchtete und zudem damit rechnete,
dass das Werk in Zukunft keine oder nurmehr wenig Gewerbesteuer an die Stadt zahlen würde.
Vor allem der Betriebsrat um Fritz Böhm machte sich für die Vollendung des Fusionsprozesses
stark, nachdem Volkswagen Garantien über den Erhalt der Ingolstädter Belegschaft abgegeben
und zugleich versprochen hatte, keine Abteilungen des Ingolstädter Werks zu verlegen. Die
Kommunalpolitiker stellten darüber hinaus fest, dass die Gewerbesteuereinnahmen sich seit
dem Zusammenschluss mit Volkswagen eher erhöht hatten, weil sie nicht mehr an den lange
Zeit zweifelhaften wirtschaftlichen Erfolg des Ingolstädter Unternehmens, sondern an die Ertragslage des VW-Konzerns gebunden war. Allerdings wurde diese Regelung durch die Fusion
mit NSU hinfällig, so dass die Stadtverwaltung erneut um ihre Einnahmen fürchtete. Ein ‚Beherrschungs- und Gewinnabführvertrag‘ zwischen Volkswagen und Audi-NSU kehrte dann im
April 1971 zum Status quo ante zurück; die Stadt wurde steuerlich an den Erträgen des Gesamtkonzerns beteiligt.89
Schon im Vorfeld der Fusion mit NSU hatte Auto Union in Ingolstadt begonnen, mehr ausländische Arbeiter und Angestellte anzuwerben. Lange hatte das Ingolstädter Werk im Gegensatz zu den meisten Automobilbetrieben in Deutschland und auch zum Schwesterbetrieb in
Neckarsulm von einem breiten landwirtschaftlich geprägten Hinterland Nutzen ziehen können,
in dem es eine zunächst schier unerschöpfliche Anzahl überzähliger Arbeitskräfte gab, die bereit waren, nach Ingolstadt zu ziehen oder ein Leben als Pendler zwischen dem Heimatdorf und
der Automobilfabrik zu führen.90
88
Schlemmer, Industriemoderne in der Provinz, S. 281.
Ebd., S. 283.
90
Ende 1964 gab es schon über 30 Pendlerbuslinien, die Arbeiter aus bis zu 45 km entfernt liegenden Orten in das
Werk der Auto Union brachten. (ebd. S. 101.)
89
25
IOS Mitteilung Nr. 66
Im Grunde hatten Umzüge und Pendlerwesen aus dem Umland schon eine Weile nicht mehr
ausgereicht, das Werk mit genügend Arbeitskräften zu versorgen. Seit den frühen 1960er Jahren
hatte es auch kleinere Migrantencommunities aus verschiedenen Ländern gegeben. Die Anwerbung von Arbeitskräften aus Jugoslawien blieb allerdings problematisch, solange das Werk Personal aus Ländern mit Anwerbeverträgen bevorzugte.91 Dies gilt für die bayerische Automobilindustrie insgesamt, wenn man von den Erfahrungen der Leiharbeiter bei BMW einmal absieht.
So scheiterte im April 1967 auch ein Versuch der Arbeitsämter von Ljubljana und Maribor, der
Firma MAN im nahen Nürnberg Facharbeiter zu vermitteln.92
Der Zuzug von Slowenen kam deshalb einer betriebswirtschaftlichen, bevölkerungspolitischen und demografischen Wende gleich. Denn die Rezession von 1966/67 hatte in Ingolstadt
dafür gesorgt, dass viele dort lebende ausländische Arbeiter in ihre Herkunftsländer zurückreisten. Betroffen waren insbesondere Italiener und Spanier, die das Management ohnehin nicht
zur Stammbelegschaft rechnete. Ende 1966 lag der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte, der
1964 immerhin schon einmal 7,6 Prozent der Ingolstädter Belegschaft ausgemacht hatte, nur
noch bei 2,8 Prozent. Die ‚Demobilisierung‘ der Migranten erfolgte über das reguläre Auslaufen der zumeist kurzfristigen Verträge – eine Verfahrensweise, die im Falle der Slowenen und
der anderen Jugoslawen 1973 erneut Anwendung fand.93
Von Januar bis März 1967 ruhte die Produktion im Werk an 18 Tagen; danach wurde je nach
Abteilung bis Mitte Juli unterschiedlich kurz gearbeitet. Zeitweise standen bei Auto Union
26.000 unverkaufte Fahrzeuge auf Halde. Zwar gab es keine Entlassungen, doch auf dem Weg
der ‚normalen Fluktuation‘ fielen einige hundert Stellen weg.94
Die unter ihnen insgesamt überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit zwang viele Ausländer,
darunter neben Italienern und Spaniern auch Türken, Griechen und einige Jugoslawen, den mittelbayerischen Donauraum zu verlassen. Die so frei werdenden Arbeitsplätze wurden entweder
gestrichen oder von einheimischen Arbeitern übernommen.95 Letztlich erfüllten die Migranten in
Ingolstadt und Umgebung also die ihnen politisch zugewiesene Funktion als „Konjunkturpuffer“
(Schmuhl) oder „konjunkturelle Manövriermasse“ (Herbert/Hunn), da sie den erst wenige Jahre
zuvor übernommenen Arbeitsplatz aufgeben oder an einen Deutschen abtreten mussten.96
91
Staatsarchiv München, Arbeitsämter 1512, Ergebnisniederschrift einer Besprechung zwischen Vertretern des
AA Ingolstadt und der Ausländerbehörden des Stadt- und Landkreises, 9.11.1965.
92
BA K, B 119, 4142, LAA Nordbayern an BfA, 25.4.1967. Die Bundesanstalt reagierte am 11.5.1967 mit einem
geharnischten Brief an das Jugoslawische Bundesarbeitsamt in Belgrad und forderte dieses auf, als illegal
anzusehenden Vermittlungsversuche zu unterbinden (ebd.)
93
Schlemmer, Industriemoderne in der Provinz, S. 98 und 288.
94
[Werner], Fritz Böhm, S. 109–112.
95
‚Rund 2300 ausländische Arbeiter. Weiterhin starker Kräftebedarf‘, DK, 4.4.1969.
96
Schmuhl, Arbeitsmarktpolitik, S. 442; Herbert/Hunn, Beschäftigung von Ausländern, S. 785.
26
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Der Ruf nach ‚Gastarbeitern‘ ertönte erneut, sobald die Talsohle der Rezession durchschritten war.97 Anfang 1968 – also noch vor Abschluss des Anwerbeabkommens – verzeichneten
die Behörden in Ingolstadt bereits eine „illegale Zuwanderung“ von Arbeitskräften aus der slowenischen Untersteiermark (Štajerska).98
Tatsächlich lässt sich auch mit Hilfe des Melderegisters und einzelner Interview-Passagen nachweisen, dass es schon vor 1968 einige wenige Slowenen in Ingolstadt gab.99 Wer im Herbst 1968
an die Donau kam, fand dort nur einzelne Landsleute, aber keine bereits konsolidierte Gemeinschaft
von Slowenen, in die er sich hätte integrieren können. Jedoch gab es in Ingolstadt sehr bald eine
slowenische Mission, deren Tätigkeitsfeld über die Stadtgrenzen hinweg auf die Diözesen Eichstätt,
Bamberg und Regensburg ausgriff. Begonnen hatte alles mit regelmäßigen Besuchen Janez Zdešars
aus München; 1971 wurde dann die Mission unter Feliks Grm offiziell gegründet. Sie gehörte zu
dem neuen Netzwerk slowenisch-katholischer Einrichtungen, das in den 1950er und 1960er Jahren
die deutschen Slowenenpfarrer der ‚westfälisch-slowenischen‛ Periode abgelöst hatte.100
Im Herbst 1968 stieg dann die Präsenz slowenischer Migranten enorm an; als „aufnahmefähig“ für Migranten erwiesen sich zu diesem Zeitpunkt laut Donaukurier insbesondere der „Automobil- und Spinnereimaschinenbau und die Elektrotechnik“, Branchen also, in denen im Verlauf der folgenden Jahre zahlreiche Slowenen Arbeit finden werden.101
Präzise Erinnerungen der Zeitzeugen liegen in der Regel für die Transporte vor, die künftige
Audi-Arbeiter nach Ingolstadt brachten:
„Die erste Gruppe slowenischer Arbeiter wurde mit einem Bus im Oktober 1968 aus dem Gebiet
Murska Sobota und Ljutomer nach Ingolstadt gebracht. Und das waren überwiegend unqualifizierte Arbeiter. […] Im November kamen dann glaube ich schon zwei Busse dazu, und so kamen
immer mehr Slowenen nach Ingolstadt.“102
Der Bustransport oder die Reise in einem regulären, fahrplanmäßig verkehrenden Zug ist für
das erste Jahr nach dem Anwerbeabkommen charakteristisch. Seit Ende Juni 1969 wurden dann
97
Schlemmer, Industriemoderne in der Provinz, S. 288. Vgl. zu jugoslawischen Reaktionen auf die Rezession in
Westeuropa Haberl, Abwanderung von Arbeitskräften, S. 79–81.
98
Stadt Ingolstadt, Halbjahresbericht an Regierung von Oberbayern, 30.9.1968, in: StA Ingolstadt.
99
Interview mit Stanislav Gajšek.
100
Slowenische Katholische Mission in Ingolstadt (Merkblatt zum 30. Gründungsjubiläum); Ingolstadt. 20-letnica
slovenske župnije v Ingolstadtu, NL 10/1991, S. 26f. Stanislav (Stanko) Gajšek, der letzte Pfarrer der katholischen
Mission in Ingolstadt, ging im Dezember 2013 in Rente. Seither wird die Mission von München aus betreut. (‚Ein
Pfarrer und Freund nimmt Abschied‘, DK, 17./18.8.2013)
101
‚Rund 2300 ausländische Arbeiter‘
102
Interview mit Stanislav Gajšek. Vgl. die Darstellung von gewerkschaftlicher Seite in Archiv Betriebsrat der
Audi AG, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat, Festakt „25 Jahre slowenische Arbeitnehmer bei Audi“ – Rede
des Betriebsratsvorsitzenden Adolf Hochrein, 14.9.1993.
27
IOS Mitteilung Nr. 66
Sonderzüge eingesetzt, in denen deutsches sowie jugoslawisches Begleitpersonal Dienst tat.103
Pro Zug reisten über 800 Migranten in die Bundesrepublik ein, wobei manche Züge deutlich
überbelegt waren. Von Slowenien aus wäre es im Grunde auch möglich gewesen, die Reise mit
dem fahrplanmäßig verkehrenden Jugoslavija Ekspres zu unternehmen. Die deutsche Seite
lehnte einen entsprechenden Antrag des „Landesarbeitsamtes Ljubljana“ jedoch ab.104
Aus dem Murgebiet und speziell aus Murska Sobota gab es weiterhin auch Bustransporte.
Die enge Verbindung zwischen dem örtlichen Arbeitsamt und Auto Union, aber auch die Abgelegenheit der Region ließen es ratsam erscheinen, auf die langsame und mit mehrfachem
Umsteigen verbundene Bahnfahrt zu verzichten. Da der Reisebus ein schnelles, bequemes und
relativ preisgünstiges Verkehrsmittel darstellte, nutzten die Migranten ihn später für die Heimfahrt während der Ferien, an Feiertagen und an Wochenenden.
103
104
28
BA K, B 119, 3019, BfA, DDJ, Erfahrungsbericht 1969, S. 4; vgl. Hadžić, Titos ‚Gastarbeiter‘, S. 112.
BA K, B 119, 3019, BfA, DDJ, Erfahrungsbericht 1969, S. 4; vgl. ebd., Erfahrungsbericht 1970, S. 53.
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Die Frauen: „Mit siebzehn bin ich nach Deutschland“
Die Leiharbeitsfirmen der 1960er Jahre rekrutierten junge Arbeiterinnen, um sie per Werkvertrag Firmen wie Siemens zu überlassen. Im mittel- und nordbayerischen Raum, wo die Firma
RUDIS aus Trbovlje als Vermittler von Arbeitskräften auftrat, arbeiteten Sloweninnen in der
Textilindustrie und im Siemens-Werk von Amberg.105
Die Berichte der deutschen Kommission in Jugoslawien schildern die anfängliche Reaktion
der Frauen auf das Angebot, nach Deutschland zu gehen, als eher zurückhaltend, aber das Interesse an Arbeitsplätzen sei mit dem Voranschreiten des Jahres gewachsen.106
Auch im folgenden Jahr hieß es in einem Bericht der Anwerbekommission, die Zahl der
Bewerberinnen reiche bei weitem nicht aus, um vorhandene Vermittlungsaufträge zu realisieren. „Das größte Interesse besteht an einer Tätigkeit als Hilfsarbeiterin in der Industrie. Sobald
Vorkenntnisse oder gar Fachkenntnisse verlangt werden, gestaltet sich die Vermittlung äußerst
schwierig. Wegen angeblich zu geringer Löhne und schlechter Arbeitsbedingungen (z.B. Gaststättengewerbe) wurde die Vermittlung schon durch das Arbeitsamt abgelehnt.“107
Insgesamt wurden die Vermittlungsaufträge für Frauen eher schleppend abgewickelt, zwischen 1969 und 1970 kam es auf ganz Jugoslawien gesehen zu einem Rückgang der Anwerbungen um 10.510.108 Was hieß all dies nun für die slowenische Teilrepublik? Bis 1968 migrierten
aus Slowenien selbst gemessen an anderen jugoslawischen Republiken eher wenige Frauen. Ivo
Baučić brachte dies vorsichtig mit dem „relativ hohen Lebensstandard“ in Verbindung; es erübrige sich so, „daß Frauen unter schwierigen Umständen im Ausland Arbeit suchen.“109 Der kroatische Migrationsforscher musste sich später korrigieren: Im Jahr 1971, als Frauen etwa ein Drittel
der jugoslawischen Migranten insgesamt stellten, war ihr Anteil in der Vojvodina und in Slowenien am höchsten (42,7 bzw. 40,1 Prozent der Gesamtzahl). Die zehn jugoslawischen Gemeinden,
in denen der Frauenanteil 50 Prozent aller Abgewanderten überstieg, lagen allesamt in Slowenien
und Kroatien. Es handelte sich bei den Sloweninnen nicht nur um ‚nachziehende‛ Freundinnen
und Ehefrauen von Arbeitsmigranten.110
105
Der frühere Ingolstädter Slowenenpfarrer berichtet, dass es auch in Weiden in der Porzellanfabrik und bei
Südwolle viele Sloweninnen gab. In der Spinnerei von Südwolle bedienten Männer zwar den Maschinenpark, aber
vorwiegend arbeiteten dort Frauen (Interview mit Stanislav Gajšek.)
106
BA K, B 119, BfA, DDJ, Erfahrungsbericht 1969, S. 34.
107
Deutsche Delegation, Belgrad, Beschäftigung, Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer,
Erfahrungsbericht 1970.
108
BA K, B 119, 3013, Deutsche Delegation der BfA, Belgrad, Beschäftigung, Anwerbung und Vermittlung
ausländischer Arbeitnehmer, Entwurf, 1970.
109
Baučić, Porijeklo i struktura, S. 96.
110
Ders., Radnici u inozemstvu, S. 140. Das slowenische Innenministerium bezifferte den Anteil an Frauen unter
den Arbeitsmigranten aus Slowenien 1980 auf 40 Prozent. (Republiški sekretariat, Delavci, S. 29.)
29
IOS Mitteilung Nr. 66
Die Idee des ‚Nachziehens‘ unterstellt ohnehin, der Mann wäre immer der treibende Faktor,
während sich die Frau mehr oder weniger passiv mitziehen ließe. Aber selbst im ländlichen
Prekmurje konnte der Wunsch zur Auswanderung bei Frauen ganz unabhängig von der Beziehung zu einem Mann heranreifen, auch wenn dann am Ende die Ortswahl davon abhängig war,
wo beide einen Arbeitsplatz fanden.
„Bei mir war das anders, das ist aus der Familiengeschichte heraus zu erklären. Mein Vater ist
gestorben, als ich drei Jahre alt war. Und meine Mutter hat dann wieder geheiratet. Dann war
es aber so, dass sie mit dem Mann auf den Hof vom Vater [des Mannes] gegangen ist, und ich
bin bei den Großeltern geblieben. Und dann ist die Großmutter gestorben und der Großvater
und ich, das passte irgendwie nicht ganz. Und ich wollte weg, auf Biegen und Brechen. Da ich
dort unten aber minderjährig war, hätten sie mich in ein Heim gesteckt, wenn ich weggelaufen
wäre. Ich muss dazu sagen, dass ich eine gute Schülerin war und dass sie mir zuerst versprochen
haben, ich darf studieren. Der Stiefvater war aber dagegen und deshalb konnte ich nicht, ich
musste ja auf dem Bauernhof arbeiten. Und da wollte ich weg. Wir hatten damals viele Leute
in Australien, aber als Minderjährige konnte ich nicht nach Australien. Und dann, wie ich dann
meinen damaligen Freund kennen gelernt habe – der hatte auch nicht gerade eine Familie, wo
man sich gut verstanden hätte – da hat der dann gesagt: ‚Wir gehen nach Deutschland!‛ Das
hieß für uns dann, ja, er geht nach Deutschland und ich komm dann nach.
Ich wollte also als junges Mädchen schon nach Deutschland und hatte auch schon die Papiere, aber
dann hat meine Mutter gesagt ich darf nicht, als Minderjährige schon gar nicht, weil ich mit einem
Kind, einem unehelichen Kind nach Hause kommen könnte. Wenn, dann heiraten. Also ich habe
mit sechzehn geheiratet, was sagt man schon mit sechzehn, siebzehn: Ja, dann heirate ich. Der
Mann, den man kennt, das ist der fürs Leben. War auch aus der Perspektive, kein Geld, keine Perspektive, in die Schule durfte ich nicht gehen, und dann haben wir eben geheiratet, ich mit sechzehn,
und mit siebzehn bin ich nach Deutschland.“111
Dies alles musste überhaupt nicht heißen, dass es die klassische nachziehende Freundin oder
Ehefrau nicht gegeben hätte. Im folgenden Falle ist es der Mann, der zunächst über seinen Umzug nach Ingolstadt berichtet:
„Als ich gekommen bin, war ich ledig. Ich hatte eine Freundin unten und habe gesagt: ‚Du
Schatzi, ich geh nach Deutschland [...] und dann komm i wieder mit ‘nem Auto, mit ‘nem VW
oder so was, nach einem Jahr.‘ Da ist dann nach einem Jahr nichts draus geworden und dann ist
111
Interview mit Marija Schmid. Unverheiratete Jugendliche mit weniger als 18 Jahren erhielten das Visum nur,
wenn sie mit erwachsenen Verwandten das Land verließen (Korpić-Horvat, Zaposlovanje in deagrarizacija, S. 84.)
30
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
sie auch gekommen. Mit einem Koffer, auf einmal war sie da, obwohl sie Arbeit gehabt hat unten.
Und dann hat es Schwierigkeiten mit der Mutter gegeben, da musste sie nach Hause, da mussten
wir heiraten: ‚So geht das nicht, dass meine Tochter da in Ingolstadt lebt, ohne verheiratet zu
sein.‛ Und da haben wir halt geheiratet.“
Da wir die Geschichte nur aus der Perspektive des Mannes kennen, ist nicht einmal ganz
klar, ob die junge Frau nicht auch unabhängig von ihm Migrationspläne schmiedete, um diese
dann sofort zu realisieren, nachdem sie bemerkt hatte, dass aus seinen Rückkehrplänen vorerst
nichts wurde.
Die dominierende Stellung des Fahrzeugbaus und des Baugewerbes in Ingolstadt hatte allerdings von Vornherein zur Konsequenz, dass Frauen auf dem örtlichen Arbeitsmarkt weniger
gefragt waren als Männer.112 Zwar war die Zahl der Frauen bei Auto Union in den Jahren 1955
bis 1965 angestiegen, man fand sie insbesondere in den Büros der Chefetage oder in der Buchhaltung, später auch in der Polsterei und in der Sattlerei. Aber alles in allem blieb das Werk ein
Männerbetrieb, selbst wenn man in Rechnung stellt, dass ein Teil der neuen Arbeitskräfte seit
1968 wiederum weiblich war.113 Von einem bestimmten Zeitpunkt an scheint sich aber die Strategie von Audi gewandelt zu haben, wie auch die Zeitzeugin hervorhebt:
„Ich bin ja selber […] mit einem sogenannten Garantiebrief über meinen Freund nach Deutschland gekommen: Diesen Garantiebrief erhielten nur Frauen, deren Männer bei Audi beschäftigt
waren. Die wollten schon so etwas organisieren wie Familienzusammenführung oder so. Aber sie
wollten nicht direkt anwerben, weil die Zahl der Frauen bei Audi – jetzt ist sie vielleicht etwas
größer, weil man mehr Frauen in der Verwaltung hat – aber damals war der Frauenanteil bei Audi
immer zwischen 8 und 10 Prozent.“114
Auffällig ist, dass Jugoslawinnen bei weitem die stärkste Gruppe von Ausländerinnen bei Audi
stellten; 1976 waren es immerhin 171, mit großem Abstand gefolgt von den Türkinnen (31), den
Griechinnen, Italienerinnen und Spanierinnen.115 Die slowenischen Angaben unterscheiden bei den
Beschäftigten nicht zwischen Frauen und Männern. Auch geben die Meldedaten nur wenige Auskünfte zur Berufsklassifizierung von Sloweninnen bei Audi und in anderen Betrieben. Erwähnung
112
Im Straßenfahrzeugbau arbeiteten in Ingolstadt 1972 insgesamt 29,9 Prozent, in der Bauwirtschaft 24,2 Prozent
aller Migranten (‚Jugoslawen halten die Spitze‘, DK 18.7.1972.)
113
Vgl. Schlemmer, Industriemoderne in der Provinz, S. 97f.
114
Interview mit Marija Schmid. 1999 lag der Anteil der jungen Frauen bei den Auszubildenden bei 20 Prozent.
(Rad der Zeit, S. 245.)
115
Vorschlagsliste zur Wahl des Betriebsrates im Jahr 1975. Gruppe Arbeiter, IGM Archiv, AdsD, IGM VSt.
Ingolstadt, 5/IGM/000309.
31
IOS Mitteilung Nr. 66
finden immerhin eine Gruppe von sechs ausgebildeten Montiererinnen sowie einige weitere nicht
näher beruflich spezifizierte „Arbeiterinnen“ bzw. „Hilfsarbeiterinnen“.116
In mancherlei Hinsicht ähnelte die Situation der Frauen in Ingolstadt der schon weitgehend
erforschten Lage jugoslawischer Migrantinnen bundesweit. Zu den Gemeinsamkeiten zählt beispielsweise die Doppelbelastung durch Erwerbs- und Hausarbeit. Die Kinder einiger bei Audi
beschäftigter Sloweninnen betonten in ihren Briefen an die Vereinszeitung Lastovka, ihre Mütter arbeiteten viel, zu Hause und im Betrieb.117 Außerhalb von Audi fanden Frauen seit Mitte
der 1950er Jahre am ehesten bei Triumph und bei AEG-Telefunken eine Anstellung. TriumphMiederwaren hatte „unter improvisierten Bedingungen und in gemieteten Räumen“ mit der
Produktion begonnen, war aber dann zur Ausbildung von Näherinnen übergegangen und hatte
eine eigene Fabrik im Norden der Stadt errichtet.118
Die Belegschaft des Zweigwerks von AEG-Telefunken fertigte vor allem Teile für Fernsehgeräte; fast in jedem TV-Gerät, so fasste es die Lokalzeitung zusammen, stecke ein
„Schalter aus Ingolstadt“. 119 Der Elektrobetrieb, dessen Tagesproduktion 1974 bei 8.600
Tunern und 3.300 Speicheraggregaten lag, benötigte ähnlich wie Siemens in Berlin vor allem die „gute[n] Augen“ und die „Fingerfertigkeit“ von Frauen; dies erklärt, warum AEG
Telefunken für Ingolstadt die größte Dichte an weiblichen Beschäftigten aufwies. 1974 arbeiteten bei der Firma 1.750 Personen, davon waren 140 Angestellte. Der Anteil der ausländischen Arbeiterinnen lag bei knapp einem Drittel, also deutlich höher als der Migrantenanteil bei Audi.120
In Leitungsfunktionen waren Frauen allerdings nicht gefragt. Der Donaukurier konstatierte,
in der Fabrik mit ihren 1.400 Frauen regierten „nur die Männer“.121 1.400 Frauen und 250 Männer, das war die Situation bei AEG Telefunken Mitte der 1970er Jahre. „Meister und Abteilungsleiter sind Fachkräfte, gelernte Rundfunk- und Fernsehmechaniker. Bei den Frauen handelt es sich um angelernte Kräfte. In sechs Wochen verrichten sie volle Bandarbeit“, heißt es in
einer Stellungnahme der Werksleitung.122
Die Arbeitsbedingungen waren hart: Dicht gedrängt saßen die Frauen am Band und es kam
häufig zu Streit. Das ganze Herkunftsspektrum der Gastarbeiterinnenmigration, die Maghreb-
116
Stadtarchiv Ingolstadt, Melderegister.
Oft fügten die Mädchen und Jungen hinzu, dass sie der Mutter im Haushalt behilflich seien (‚Kotiček za male
lastovke‘, Lastovka, 22. 1982, S. 7–12.)
118
Schlemmer, Industriemoderne in der Provinz, S. 70.
119
Ebd. Siehe auch ‚Fast in jedem TV-Gerät steckt ein Schalter aus Ingolstadt‘, DK, 13.3.1974.
120
Ebd.
121
‚Im Betrieb der 1400 Frauen regieren nur die Männer‘, DK, 2.10.1974
122
Ebd.
117
32
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Länder vielleicht ausgenommen, war hier präsent. Die meisten Frauen kamen aus Jugoslawien
(253), das im Herbst 1974 mit weitem Abstand vor der Türkei lag (134). Sloweninnen waren bei
AEG-Telefunken (im Vergleich zu Audi) erst spät – im Jahr des Anwerbestopps – eingestellt
worden. Es handelte sich um 112 Frauen, von denen die meisten, nämlich 58, aus Novo mesto in
Unterkrain – slowenisch Dolenjska – viele auch aus Murska Sobota und Umgebung (52) stammten; deutlich weniger kamen aus den Gegenden von Celje, Kranj oder Nova Gorica.123
Am Arbeitsplatz brach vor allem zwischen Landsmänninnen oft ein Zwist aus, dem die
Werksleitung mit einem ebenso einfachen wie – zumindest dem Bericht des Donaukuriers zufolge – wirksamen Mittel begegnete: „Man änderte die Sitzordnung so, dass neben der gebürtigen Ingolstädterin eine Türkin zu sitzen kam, daneben eine Italienerin, eine Österreicherin,
eine Griechin, eine Portugiesin, eine Spanierin, eine Jugoslawin …“
Was zog die Frauen in den Elektrobetrieb, wenn man von den für slowenische Verhältnisse
auf jeden Fall hohen Löhnen absieht? Die Firma selbst warb mit den eigens eingerichteten „familienfreundlichen Schichten“, die es den oft mit Audi-Arbeitern verheirateten Frauen erlauben
sollten, ihrer Arbeit nachzugehen und zusätzlich die Familie zu versorgen.124 Was die unverheirateten Frauen anging, so berichtet der Donaukurier, dass etwa 60 von ihnen in einem Wohnheim der Firma AEG-Telefunken lebten, betreut von einer Frau mit dem slowenisch klingenden
Nachnamen Theodora Kuchar.125
Die Krankenquote lag laut Werksleitung von AEG-Telefunken bei den Frauen mit 11–12%
fast doppelt so hoch wie bei den Männern, doch scheint es, dass die bei Audi auftauchenden,
noch zu diskutierenden Höchstwerte in dem Elektrobetrieb weder beim weiblichen noch beim
männlichen Teil des Personals erreicht wurden. Im Vergleich zur Situation bei Audi oder Schubert & Salzer lag der Grad an gewerkschaftlicher Organisierung bei AEG-Telefunken niedrig:
Im Durchschnitt des Jahres 1973 gehörten von 1.740 Beschäftigten nur 271 der IG Metall an.126
Auch die Gewerkschaft war männerdominiert: Dass die Frauenarbeit der IG Metall in Ingolstadt insgesamt auf sehr schwachen Beinen stand, lässt sich u.a. daran ablesen, dass in den
Jahren 1972–1974 maximal 64 Personen an einer Jahresabschlussfeier und 51 Personen an einer
123
Der Donaukurier vom 2.10.1974 nennt für das Jahr 1974 die Zahl von 253 ‚Jugoslawinnen‘, die bei AEGTelefunken in Ingolstadt arbeiten. Die Sloweninnen stellten also etwa die Hälfte der jugoslawischen Beschäftigten.
124
Thomas Schlemmer – telefonische Mitteilung vom 17.11.2011. Der Donaukurier (17.1.1974) beziffert die Zahl
der bei AEG-Telefunken arbeitenden Ausländerinnen auf 500, „vornehmlich Jugoslawinnen und Türkinnen“. In
den Jahren 1972 und 1973 hatte der Betrieb jeweils 112 Lohnabhängige slowenischer Herkunft eingestellt,
wahrscheinlich überwiegend Frauen. (Pregled, S. 23)
125
DK, 17.1.1974. Vgl. die Version Teodora Kuhar in: ‚Ingolstadt‘, NL, Nr. 3 1974, S. 20. Sie wird dort als „unsere
Landsmännin“ vorgestellt.
126
Zahlende Mitglieder – Jahresdurchschnitt 1983, AdsD, IGM-Archiv, IGM VSt. Ingolstadt, 5/IGMI000309b.
33
IOS Mitteilung Nr. 66
Studienfahrt teilnahmen.127 Einer slowenischen Zeitung lässt sich entnehmen, dass im Herbst
1974 etwa 30 Arbeiterinnen von AEG-Telefunken an einem Deutschkurs teilnahmen, den der
Audi-Betriebsrat Bogdan Pualić eigens für die Sloweninnen in dem Elektrobetrieb hatte durchführen lassen.128
Zum Abschluss ist noch die Frage aufzuwerfen, ob und in welchem Umfang Frauen von
Konjunkturschwankungen und administrativen Maßnahmen zur Reduzierung der Belegschaften besonders getroffen wurden. Die Angaben zu Entlassungen bei Audi enthalten in der Regel
keinen Hinweis auf das Geschlecht der Betroffenen, so dass man im Grunde auf die Berichterstattung der Presse angewiesen ist. Aber selbst dort fehlen Nachrichten zum Thema ‚Frauen bei
Audi‘, während man für andere Betriebe manchmal fündig wird.
Zur Zeit der Ölkrise befragte der Donaukurier die Leitungen einiger kleinerer Werke, um in
Erfahrung zu bringen, welche Pläne sie im Hinblick auf ihre ausländischen Arbeitskräfte hätten.
Ein Mitglied der Werksleitung von AEG-Telefunken wies darauf hin, dass sein Betrieb verstärkt Bewerbungsschreiben deutscher Arbeitnehmer erhalte. Man sehe sich aber dadurch nicht
veranlasst, „einen Teil seiner 500 Ausländerinnen, vornehmlich Jugoslawinnen und Türkinnen,
zu ‚opfern‛. […]. Käme es wirklich zu einer einschneidenden Rezession, würden wir allein das
Leistungsprinzip gelten lassen. Wir sind mit unseren Ausländerinnen sehr zufrieden. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen und den deutschen Kolleginnen.“129
Der Angestellte von AEG-Telefunken verbreitete offenbar im Sinne des Betriebsfriedens
einen gewissen Zweckoptimismus. Zahlen aus dem Vorjahr zeigen nämlich, dass bei den damals recht wenigen arbeitslosen Migranten (1,1 Prozent) der Frauenanteil bereits sehr hoch
war: In absoluten Zahlen verbargen sich hinter dem niedrigen Prozentsatz 67 Personen, darunter
24 Männer und 43 Frauen.130 Zu einem ähnlichen, allerdings auch sehr allgemeinen Urteil gelangte 1976 eine Delegation der Jugoslawischen Arbeitsverwaltung, die der Arbeiterwohlfahrt
in Ingolstadt einen Besuch abstattete. „Besonders betroffen von den Schwierigkeiten der Arbeit
in der Bundesrepublik seien die Frauen, außerdem seien sie von der Arbeitslosigkeit weitaus
stärker betroffen als die Männer“, heißt es in einem Bericht.131 Große Probleme bereite die für
Ingolstadt geltende Zuzugssperre, die selbst den Familiennachzug verhinderte und dazu führte,
dass Ehepartner gezwungen waren, in verschiedenen Städten zu leben. Eine Zusammenführung
der Familien sei offiziell nur in sogenannten „Härtefällen“ erlaubt.
127
IG Metall, Bezirksleitung Südbayern, Geschäftsbericht 1972–1974, S. 226f.
‚Domačini o naših delavcih‘, Večer, 25.10.1974.
129
‚Arbeitsplätze für Gastarbeiter in Ingolstadt nicht gefährdet‘, DK, 17.1.1974.
130
‚Höchststand an Gastarbeitern‘, ebd., 6.4.1972.
131
‚Jugoslawen haben noch viele Probleme mit dem Gastland‘, ebd., 23.4.76.
128
34
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Zwar war die Arbeitslosigkeit dann Ende der 1970er Jahre leicht rückläufig, aber die Quote
in Ingolstadt blieb kontinuierlich „über dem Wert des bayerischen Landesdurchschnitts“ und
„der Anteil der Frauen war unverhältnismäßig hoch.“ Die Belegschaft eines klassischen ‚Frauenbetriebs‛ wie AEG-Telefunken schrumpfte bis 1980 auf rund 800 weibliche und männliche
Beschäftigte.132
132
Koller, Ingolstadt plant 1972–1982, S. 41 und S. 33.
35
IOS Mitteilung Nr. 66
Gewerkschaftliche Vertretung, Arbeitskämpfe und internationale
Beziehungen
Wer sich mit den Slowenen in einem industriellen Zentrum wie Ingolstadt befasst, der kommt
an der Frage nach ihrem Verhältnis zur Gewerkschaftsbewegung nicht vorbei. Viele Migranten,
so konstatierte Max Diamant für die IG Metall im Dezember 1969, betrachteten im Moment
ihrer Einstellung den ganzen Problemkreis ihrer „weiteren hiesigen Arbeits- und Lebensbedingungen“ als sekundäre Begleiterscheinungen eines „zeitweiligen Lebens“. Dazu trage die zeitliche Befristung des ersten Arbeitsvertrags und der Aufenthaltsgenehmigung, der eigene „Zeitund Ersparnisplan“ sowie das „Lebensprojekt“ nach einer eventuellen Rückkehr bei, immer
fördere sie unter den Migranten die Mentalität von „provisorischen Arbeitern“.133
Schon die Tatsache, dass vor allem die Slowenen aus dem Pomurje nicht individuell, sondern in geschlossenen Gruppen nach Ingolstadt gelangt waren, änderte die Situation ein wenig.
Denn parallel zum individuellen Lebensprojekt entwickelte sich die Lage der Gruppe, deren
Angehörige in vielerlei Hinsicht ähnliche Probleme und Interessen hatten. Hinzu kommt, dass
die Ingolstädter Slowenen aus einem staatssozialistischen Land kamen, in dem offiziell die
Macht in den Händen der Arbeiterklasse lag, auch wenn die Regierung von der kommunistischen Partei kontrolliert wurde. Passte der ländliche und kleinstädtische Hintergrund vieler ‚Ingolstädter Slowenen‘ nicht wirklich in dieses Schema, so fanden sie sich seit ihrem Umzug als
Lohnarbeiter in einem kapitalistischen Großbetrieb wieder. Das wiederum konnten sie bis zu
einem gewissen Grade auch als Bestätigung der Dinge ansehen, die sie auf der Schule gelernt
hatten. In diesem Zusammenhang stellte sich geradezu zwangsläufig die Frage nach der gewerkschaftlichen Interessenvertretung.
Auf die Frage, ob die Slowenen in ihrer großen Mehrheit die Gewerkschaftsarbeit innerbetrieblich mitgetragen hätten, antwortete Fritz Böhm im Interview 2011, sie seien recht bald „ein
sehr aktiver Teil“ der IGM und der Audi-Belegschaft gewesen. Er führte dies auf ihre gewerkschaftliche Schulung in Jugoslawien zurück. Das seien zwar keine freien Gewerkschaften gewesen, aber die Slowenen hätten oft den Eindruck einer sehr guten Elementarbildung erweckt.
Bei den Arbeitskämpfen seien sie oft geradezu als „Vortrupp“ aufgetreten.134
133
IGM-Bibliothek, Beratungsbericht. Zu den Fragen „Gewerkschaft und ausländische Arbeitnehmer“, S. 16f.
Böhm, ein alter Stratege des gewerkschaftlichen Kampfes, hatte eine Vorliebe für militärische Ausdrücke. Bei
Schlemmer, Industriemoderne in der Provinz, S. 118, bezeichnet er den Vertrauensleutekörper als seine „Infanterie“. Hinweise auf die Unterstützung innerbetrieblicher Kämpfe bei Audi durch die slowenische Beschäftigte
finden sich auch in Bojan Pecek, ‚Die Audi Delegation bei uns‘, Übersetzung aus dem Vestnik (Murska Sobota),
19.6.1986. Der slowenische Journalist beruft sich auf das Audi-Betriebsratsmitglied Emmeran Fischer. Der Text
im Archiv des Betriebsrats der Audi AG, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat.
134
36
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Die Slowenen bei Audi hätten sich schon bald voll in die gewerkschaftliche Arbeit integriert,
erklärte einer der Nachfolger Böhms, Betriebsratsvorsitzender Adolf Hochrein schon auf einer
Feier im September 1993.135
Bestätigung finden solche Angaben bei den von der IG Metall veröffentlichten Daten über das
gewerkschaftliche Engagement jugoslawischer ‚Gastarbeiter‛ in deutschen Großbetrieben und
bei Nachrichten über die Beteiligung von ‚Ingolstädter Slowenen‛ an Betriebsrats- und Vertrauensleutewahlen.136 Die geringsten Probleme, sich gewerkschaftlich zu betätigen, hatten jene Migranten, deren Mitgliedschaft in den jugoslawischen Arbeitnehmerorganisationen von der IG Metall sofort anerkannt wurde. Wer im Herkunftsland der Gewerkschaft schon ein Jahr angehört
hatte, konnte sich im deutschen Großbetrieb sofort zum Vertrauensmann wählen lassen.137
Aber auch für die anderen stellten sich dem Eintritt in der Berufsgewerkschaft keine Hürden
entgegen. Allgemein war der gewerkschaftliche Organisierungsgrad bei Auto Union Audi-NSU
ohnehin sehr hoch: So waren im Jahr des Anwerbestopps 91,18% der 18.020 Audi-Beschäftigten Mitglieder der IG Metall.138
Man darf also von hier aus auf die Beteiligung von Slowenen an diversen Arbeitskämpfen
schließen, deren Verlauf hier kurz zu rekapitulieren ist. Der erste dieser Streiks begann im Oktober 1970 mit einer von 8.000 Arbeitern und Angestellten unterzeichneten Protestresolution
gegen die „Verzögerungstaktik des Vereins der Bayerischen Metallindustrie (VBM) bei den
Tarifverhandlungen in Bayern“. Die Unterzeichner erwarteten von der Geschäftsleitung, dass
sie auf den VBM einwirke, damit dieser von seiner hinhaltenden Taktik abrücke und dazu beitrage, die Gespräche zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen.
Anders als im Neckarsulmer Schwesterwerk hatte es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine
Warnstreiks in Ingolstadt gegeben, aber die Arbeiter des Werks waren nach Angaben Fritz
Böhms „sehr verärgert.“139 Am 30. Oktober fand dann ein erster Warnstreik im Ingolstädter
Werk statt, an dem nach Angaben der IG Metall etwa 5.000 Beschäftigte teilnahmen. Der im
Motorenbau einsetzende Ausstand griff auf andere Abteilungen über, darunter solche, in denen
viele Slowenen arbeiteten: Rohbau, Montage, Presswerk.140
135
Ebd., Festakt „25 Jahre slowenische Arbeitnehmer bei Audi“ – Rede des Betriebsratsvorsitzenden Adolf Hochrein, 14.9.1993.
136
Die Frage, wieviel Slowenen bei Audi in dieser Zeit Gewerkschaftsmitglieder waren, beantwortete eine
Zeitzeugin mit „zwischen 95 und 100%“ (Interview mit Marija Schmid).
137
Ebd., Gesichtspunkte zur systematischen und einheitlichen Weiterentwicklung der Arbeit der ausländischen
Vertrauensleute, S. 3.
138
Zahlende Mitglieder – Jahresdurchschnitt 1983, AdsD, IGM-Archiv, IGM VSt. Ingolstadt, 5/IGMI000309b.
139
Unterschriften statt Streik, DK 29.10.1970.
140
„Die Automobilwerker standen in den fraglichen 45 Minuten untätig an ihren Arbeitsplätzen, anschließend
nahmen sie ihre Beschäftigung wieder auf.“ (Warnstreik bei Audi, DK, 31.10./1.11.1970.)
37
IOS Mitteilung Nr. 66
Die ungebremst hohe Nachfrage nach Audi-Modellen versuchte die Werksleitung im Verlauf des Jahres 1971 mit Hilfe von Sonderschichten zu decken. Vor allem die Kapazitäten der
Lackiererei hatten nicht mehr ausgereicht. Zwei der Sonderschichten sollten jeweils zehn Arbeitsstunden umfassen, außerdem sollte die Frühschicht verlängert werden.141 Andererseits verzeichnete die Audi NSU Auto Union AG wegen der Auswirkungen der Arbeitskämpfe in den
beiden ersten Dezemberwochen 1971 8.286 Kurzarbeiter.142
Im Monat zuvor war das Betriebsverfassungsgesetz novelliert worden: Ausländische Arbeitnehmer aus Drittstaaten hatten – gegen Proteste der Unternehmer – erstmals auch das passive
Wahlrecht zu den Betriebsratswahlen erhalten, das bis dahin nur Staatsbürgern von EWG-Staaten zugestanden hatte. An der Ausformulierung des Gesetzes hatte Betriebsratsvorsitzender
Fritz Böhm in seiner Rolle als sozialdemokratischer MdB einen großen Anteil.143
Man kann davon ausgehen, dass die gewerkschaftliche Praxis bei Auto Union und die Beziehungen zwischen deutschen, slowenischen, türkischen Arbeitern in dem mittelbayerischen
Großbetrieb Einfluss auf die Inhalte des Gesetzes hatten. Auf jeden Fall blieb das neue Gesetz
nicht ohne gravierende Konsequenzen für die Situation der Audi-Arbeiter. Am 18.–20. April
1972 fanden bei Audi NSU Betriebsratswahlen statt, die mit einer Aufstockung des Gremiums
von 25 (1968) auf 37 Betriebsräte einhergingen. Die IG Metall-Kandidatur wurde nur von der
DAG und der CMV herausgefordert. Bei den Arbeitern gingen 82,9%, bei den Angestellten
64,48% der Stimmen an die IG Metall, die fortan 25 Betriebsratsmitglieder stellte; die CMV
erhielt fünf, die DAG zwei Mandate.144
Auf der Liste der IG Metall wurde als erster Jugoslawe bei Audi der aus Serbien stammende
Ingenieur Bogdan Pualić gewählt, der seit 1966 in der Bundesrepublik lebte und seit 1968 im
Ingolstädter Werk arbeitete. Er erhielt so Gelegenheit, die Kandidatur weiterer Südslawen, in
diesem Falle durchweg Slowenen, zum Betriebsrat vorzubereiten. Immerhin dauerte es noch
15 Jahre, ehe mit Franc Vogrin der erste Slowene in den Audi-Betriebsrat gewählt wurde.
Bei den Betriebsratswahlen vom 9. und 10. April 1975, den ersten nach dem Anwerbestopp,
gewann die IG Metall unter den Arbeitern etwa denselben Stimmenanteil wie drei Jahre zuvor;
im Betriebsrat verfügte sie danach über ein Mitglied mehr. Unter den Angestellten verlor sie
demgegenüber 10,5 Prozent der Stimmen und stellte nur noch drei Betriebsräte, ebenso viele
wie die DAG. Der CVM war weiterhin mit fünf Mitgliedern im Betriebsrat vertreten.145
141
(Werner), Fritz Böhm, S. 132.
BayHStA, StK., Nr. 14788, Übersicht über Ankündigungen bzw. Anzeigen von beabsichtigter Kurzarbeit für
die Zeit ab Mitte Dez. 1971 bis 5. Jan. 1972.
143
Werner, Fritz Böhm, S. 133; Gastarbeiter als Betriebsrat nach dem neuen Gesetz wählbar, DK, 23.2.1972.
144
Werner, Fritz Böhm, S. 134f.
145
Werner, Fritz Böhm, S. 153.
142
38
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Die ‚Jugoslawen‘ traten mit vier Kandidaten an: Bogdan Pualić (Platz 19) Mitglied des
Betriebsrats und des Ausländerbeirats. Auf dem Werbezettel der IGM wurde er als „Organisator
vieler bekannter Aktionen und Demonstrationen in der Firma und in der Stadt“ vorgestellt. Neben
Pualić kandidierten zwei Slowenen: Der 27-jährige Automechaniker Franc Obal (Platz 38) – aus
Krog im Kreis Murska Sobota stammend – und der 49-jährige Franc Barber (Platz 46), der in
Jugoslawien seit 1948 Gewerkschaftsmitglied gewesen war und bei Auto Union – Audi NSU seit
1969 in der Presserei arbeitete; Barber war seit 1972 IGM-Vertrauensmann.
Auf Platz 57 schließlich kandidierte der 30-jährige Josip Škec aus der Karosserie-Anfertigung. Er lebte seit 1969 in Ingolstadt und gehörte zur Gruppe der Kroaten aus Varaždin. Neben
den ‚Jugoslawen‛ traten die aus der Türkei stammenden Migranten als zweitstärkste ausländische Komponente mit drei Kandidaten an.146 Gewählt wurde neben Pualić ein türkischer Kandidat, die anderen Ausländervertreter landeten auf aussichtslosen Plätzen und zogen nicht in
den Betriebsrat ein.
Drei Jahre später traten mit Bogdan Pualić (Platz 19) vier Slowenen als Kandidaten an: der
27-jährige Punktschweißer Franc Vogrin (30), die Bandarbeiterin Marija Koltaj (38), der 30jährige Nacharbeiter Ivan Kerčmar (49) und der einunddreißigjährige Maschinenarbeiter Ivan
Lebar (67). Pualić und Koltaj wurden als Sprecher bzw. Sprecherin „der jugoslawischen Kollegen im Betrieb und außerhalb“ vorgestellt. Vogrin, Koltaj, Kerčmar und Lebar waren zudem
IGM-Vertrauensleute. An der Spitze der Liste standen Fritz Böhm und der dann früh verstorbene, auch von den slowenischen Gewerkschaftern in Murska Sobota betrauerte Franz Maurer
(Jg. 1930).147
Auch 1981 blieb es bei der Kombination aus Bogdan Pualić und vier Slowenen: Franc Vogrin
„IGM-Vertrauenskörperleitung“), Marija Koltai („Sozialbetreuerin“), Alojz Cahuk („Vetrauensmann im Bereich Preßwerk“), Danica Lorenčič („Vertrauensfrau in der Elektrofertigung“.)
In den Publikationen der IG Metall vor 1991 treten slowenische Gewerkschafter grundsätzlich als ‚Jugoslawen‘ in Erscheinung, was in einem gewissen Kontrast zu den engen Beziehungen steht, die sich schon recht früh zwischen den Ingolstädter Gewerkschaften und ihrem Gegenüber in Murska Sobota herausbildeten. Sieht man einmal von den Betriebsratsvertretern ab,
die schon 1968 die Anwerbedelegation der Werksleitung nach Slowenien begleiteten, dann kam
es im Juli 1970 auf Einladung der Gewerkschaften aus dem Pomurje zur ersten Reise von AudiBetriebsräten nach Murska Sobota. Gewerkschaftlicher Gegenbesuch traf ein Jahr später in Ingolstadt ein; bei dieser Gelegenheit kam es zu einem Empfang beim Oberbürgermeister und zur
146
Vorschlagsliste zur Wahl des Betriebsrates im Jahr 1975. Gruppe Arbeiter, IGM Archiv, AdsD, IGM VSt.
Ingolstadt, 5/IGM/000309.
147
wir. Informationen der IG Metall Arbeiter. AUDI NSU, Betriebsratswahlen 1978.
39
IOS Mitteilung Nr. 66
ersten Besichtigung eines Arbeiterwohnheims. Von da an wechselten die Reisen der Gewerkschaftsdelegationen im Halbjahresrhythmus einander ab. Anlass, eine slowenische Gruppe in
Ingolstadt zu empfangen, bot insbesondere die meist im Oktober in der Werkskantine stattfindende Belegschaftsversammlung der jugoslawischen Audi-Beschäftigten, an der regelmäßig
Gäste aus Murska Sobota teilnahmen. Umgekehrt unternahmen die deutschen Gewerkschafter
Betriebsbesichtigungen bei den Firmen Agoroservis, Mura und Panonija oder besuchten kleinere Zentren des Prekmurje, aus denen Arbeiter in Ingolstadt lebten.
Einige Reisen führten auch über Ljubljana, wo Gespräche beim ‚Landesarbeitsamt‛ und
beim Slowenischen Gewerkschaftsbund anstanden; bei einer dieser Gelegenheiten wurde der
Audi-Vertrauensleutekörper 1989 mit der Goldenen Nadel der slowenischen Gewerkschafter
ausgezeichnet, und zwar – es fehlten nur noch zwei Jahre bis zur Eigenstaatlichkeit – „für die
ausgezeichnete Betreuung der slowenischen Gastarbeiter.“148
Dass im Herbst 1968 tatsächlich slowenische Arbeiter nach Mittelbayern gelangt waren, war
in Ingolstadt erstmals 1993 Anlass zu einem Fest, auf dem der Betriebsratsvorsitzende Adolf
Hochrein die Festrede hielt. Ziel des Audi-Betriebsrats, so Hochrein, sei es von Anfang an gewesen, den slowenischen Kollegen zu erklären, dass sie sich an der Donau in „gute Hände
begeben.“ Man habe versucht, die Schwierigkeiten abzufedern, die nach Auffassung der deutschen Gewerkschafter auf die slowenischen Kollegen zukämen. Schließlich befänden sie sich
„in einer ungewohnten Umgebung, in einem modernen Industriebetrieb mit Schichtarbeit, der
einiges an Leistung abverlangt.“
Der Betriebsrat sei bereit gewesen, überall mitzuhelfen: bei der Klärung der Wohnsituation,
bei der Organisation von Heimfahrten an den Wochenenden, bei der Sicherstellung des Einlebens in die Audi-Belegschaft. Er habe sich bei diesen vielfältigen Aufgaben mit den slowenischen Gewerkschaftern in Murska Sobota abgestimmt. Regelmäßige Besuche aus dem Pomurje
dienten der Kontrolle einer Situation, in der es den slowenischen Arbeitern auch nach dem
Urteil ihrer heimischen Gewerkschaftsorganisation „gut ging“.149
148
Archiv Betriebsrat der Audi AG, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat, Festakt „25 Jahre slowenische
Arbeitnehmer bei Audi“ – Rede des Betriebsratsvorsitzenden Adolf Hochrein, 14.9.1993.
149
Ebd.
40
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Anwerbestopp: „Es kam noch ein Bus – und dann war Schluss“
Insgesamt gelten die frühen 1970er Jahre bei Audi-NSU als Jahre des Aufschwungs und der
Neuorientierung; nahezu im Jahresrhythmus wurde die Belegschaft um 1.000 bis 2.000 neue
Mitglieder aufgestockt, manchmal waren es sogar noch mehr. So weit dies aus den Interviews
ersichtlich ist, ließen sich viele Arbeiter aus Slowenien vom in den Hallen kursierenden Zukunftsoptimismus mitreißen. Dies gilt insbesondere für die Frage der Rückkehr nach Slowenien, die von Jahr zu Jahr aufgeschoben wurde.
Doch im Herbst 1973 machte die Ölkrise alle kühnen Erwartungen an ein fortgesetztes Prosperieren der Firma zunichte. An den autofreien Sonntagen präsentierte sich auch Ingolstadts City
wie eine einzige Fußgänger- und Radfahrerzone. Bei Audi NSU brach die Produktion um 38
Prozent ein. Die VW-Konzernspitze entwickelte verschiedene Pläne, um der Krisensituation zu
begegnen. Die deutlichsten Konsequenzen hatte Plan S 1, der einen spürbaren Personalabbau in
allen Werken vorsah und auch vor Werksschließungen nicht Halt machen wollte. Besonders betroffen erschien Neckarsulm, wo das Werk als „das letzte Rad am Wagen des Mutterkonzerns“
kurz vor der Schließung stand. In Ingolstadt wurde über die Einsparung von 3.500 Arbeitsplätzen
diskutiert, allein in den beiden ersten Monaten des Jahres 1974 gingen 2.000 Plätze verloren.150
Das „Gespenst der Kurzarbeit“, so hieß es Mitte Dezember 1973 im Donaukurier, drohe auch
in Ingolstadt. Ohne den immer noch prosperierenden Export wäre Audi längst dort angelangt, wo
andere Autofirmen schon seit einiger Zeit angekommen seien: Ford-Köln arbeite schon seit vier
Wochen kurz, Opel-Rüsselsheim seit zwei. Bei Audi-NSU baue man zunächst auf die Betriebsferien vom 24. Dezember bis zum 7. Januar, danach wolle man weitersehen. Die Autoindustrie
habe schon seit einiger Zeit auf Halde produziert; auf den bundesdeutschen Abstellplätzen stünden 350.000 Neuwagen, was einer Zunahme um 90.000 seit Oktober gleichkomme.151
Tatsächlich ging die Produktion bei Audi im Dezember 1973 gegenüber dem Vorjahresmonat um 83 Prozent zurück.152 Unterdessen war der Anwerbestopp beschlossen, mit wenig erfreulichen Folgen für die privilegierten Beziehungen zwischen Audi und dem slowenischem
Murgebiet. In den lapidaren Worten der ehemaligen Sozialberaterin: „Es kam noch ein Bus,
nachdem schon die Zuzugssperre gegolten hat, weil die ganzen Verträge vorher schon gemacht
worden waren. Und dann war Schluss.“153
150
Endres, Macht und Solidarität, S. 43; 60 Jahre IG Metall Ingolstadt. Eine Zeitreise durch 60 Jahre Gewerkschaftsarbeit, Ingolstadt o.J. [2010]; S. 5; Werner, Fritz Böhm, S. 145ff.
151
‚Audi: Ungewissheit für 20.000 nach der letzten Schicht‘, DK, 14.12.1973.
152
Grieger, „Geplatzte Wirtschaftswundertüte“, S. 49.
153
Interview mit Marija Schmid; zum Anwerbestopp jetzt Berlinghoff, Ende, S. 250–257.
41
IOS Mitteilung Nr. 66
Der letzte Eisenbahntransport aus Jugoslawien war in Belgrad am 4.12.1973 abgefertigt worden. Zum Jahresende hin hatte die Bundesanstalt für Arbeit eine drastische Verkleinerung der
Deutschen Delegation beschlossen.154 In Slowenien rechnete man für die Ferienzeit mit der
Rückkehr einer bedeutenden Anzahl von Migranten. So verbrachten viele slowenische Familien den Jahreswechsel – ganz gleich ob in Ingolstadt oder in Murska Sobota – in banger Erwartung dessen, was noch auf sie zukommen sollte. Insbesondere aber achteten die Migranten
darauf, pünktlich aus den Weihnachtsferien zurückzukehren. Das Risiko, dass eine Verspätung
dem Verlust des Arbeitsplatzes gleichkam, war höher geworden.155
Welche Folgen hatte der Produktionsrückgang bei Audi für die slowenischen Arbeiter und
Angestellten? Über die im Gefolge der Ölkrise verordnete Kurzarbeit bei Audi liegen einander
leicht widersprechende Angaben vor.156 Im Sommer 1974 jedenfalls sollte die Produktion des
Audi 80 für fünf Wochen ganz gestoppt werden, denn an die Periode der Kurzarbeit schloss
sich der dreiwöchige Betriebsurlaub an, der mit den bayerischen Schulferien zusammenfiel.
Die Werksleitung ließ durchblicken, dass es ihr durchaus gelegen komme, wenn der eine oder
andere Migrant aus den Betriebsferien nicht wieder zurückkehre. Die Situation hatte sich dem
Vorjahr gegenüber vollständig gewandelt: Damals war die Werksleitung noch froh gewesen
um jeden Arbeiter, der seinen Dienst nach den Ferien pünktlich wieder antrat. Seit November
1973 galt im Werk die Linie die Maxime: „Wer kündigt, wird nicht ersetzt. Auslaufende
Verträge werden in der Regel nicht erneuert.“157
Anfang Juli erhielt der Betriebsrat Bogdan Pualić einen Brief des Bonner Delo-Korrespondenten, der am 19.7. in Ingolstadt mit verschiedenen Gewerkschafts-, Betriebsrats- und
Firmenvertretern zusammen kommen wollte. Sinnvoll, so hieß dort, sei auch eine Werks- und
Wohnheimbesichtigung.158
154
‚Arbeitsvermittlungsstelle geschlossen‘, FAZ, 27.11.1973; ‚Gastarbeiterstopp bedrückt Jugoslawien‘, SZ, 2.1.1974.
‚Die besten Gastarbeiter, die es je in Ingolstadt gab‘, DK 19.2.1974; Drnovšek, Izseljevanje „rakrana“, S. 305.
156
Laut Werner (Fritz Böhm, S. 147) erstreckte sich die Kurzarbeit bei Audi NSU im Jahr 1974 über insgesamt vier
Perioden: vom 22.4. bis zum 3.5.; vom 22.7. bis zum 2.8., vom 18. zum 29.11. und schließlich vom 16.12. zum 3.1.1975.
Eine Ingolstädter Gewerkschaftsdelegation, die sich im Oktober 1974 in Murska Sobota aufhielt, berichtete den
slowenischen Gastgebern, dass das Werk aus betrieblichen Gründen im Herbst zweimal, nämlich in der Zeit vom 14. bis
25. Oktober und vom 18. bis 25. November Kurzarbeit durchführen werde. (Feri Maučeč, ‚Obisk sindikalne delegacije iz
Ingolstadta‘, Vestnik, 17.10.1974 (dt. Übersetzung: Besuch der gewerkschaftlichen Delegation aus Ingolstadt.)
157
‚Audi: Auslaufende Verträge werden nicht mehr erneuert‘, DK, 31.5.1974.
158
Der Delo (dt.: Arbeit), heute eine liberale Tageszeitung, war damals das Zentralorgan der slowenischen Kommunisten. Korrespondent Rupnik hatte nie Gelegenheit, nach Ingolstadt zu fahren, „da in Bonn immer etwas
Aktuelles passiert“. Deshalb wollte er die Chance nutzen, auf dem Weg in den Urlaub an der Donau Halt zu
machen. (A. Rupnik an B. Pualić, 8.7.1974, Archiv des Betriebsrats der Audi AG, Ordner Jugoslawisches
Syndikat/Beirat.) Im Zusammenhang mit dem Besuch des jugoslawischen Außenministers wurde A. Rupnik in
Bonn eine „in der Regel objektive Berichterstattung“ bescheinigt. („Jugoslawische Presse über die Bundesrepublik
Deutschland“, BA K, B 145, Bild-, Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 11429.)
155
42
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Zwischen Ingolstadt und Murska Sobota, so bemerkte Rupnik eine Woche später im Delo, gehe
die Angst vor den blauen Briefen („modre kuverte“) um. „Bis zum kommenden Frühling können
wir allen Arbeit zusichern, die gute Arbeiter sind“, habe Fritz Boehm erklärt. Der slowenische
Journalist beeilte sich hinzuzufügen, dass die Wörter „alle“ und „gute“ zueinander in Gegensatz
ständen. Hinter den „blauen Briefen“ rangierte in der Korrespondenz Rupniks die „qualifizierte
Fluktuation“ als zweites Schlüsselwort. „Die qualifizierte Fluktuation ist eine Lösung für unseren
Zustand. Heute gilt der Leitspruch: fünf Schlechte für einen Guten!“, erklärte Betriebsratsmitglied
Franz Maurer dem slowenischen Journalisten und fügte hinzu, die slowenischen Arbeiter seien im
gleichen Ausmaß betroffen wie deutsche Arbeiter. Was aber bedeutete „qualifizierte Fluktuation“?
Das sei der sogenannte „natürliche Abfluss von Arbeitskraft“ oder, wie es Rupnik formulierte, der
„natürliche Aufbruch ausländischer Arbeiter nach Hause.“ Da der Anwerbestopp die
Neueinstellung von Arbeitern aus Drittstaaten verhinderte, verringerte sich der Ausländeranteil an
der Belegschaft auf diese Weise auch ohne Massenentlassungen.159
Unterdessen suchte die Werksleitung nach weiteren Wegen, Personal abzubauen. Auf ein
entsprechendes Angebot von Audi hin erklärten sich 150 türkische Arbeiter bereit, zu KarmannGhia zu wechseln. Für manche Slowenen und andere Jugoslawen, deren erster Einjahresvertrag
mit dem Ingolstädter Automobilwerk in den Sommermonaten 1974 auslief, bestanden solche
Möglichkeiten schon nicht mehr. Betroffen waren vor allem einige hundert im Sommer vor
dem Anwerbestopp in Slowenien und Kroatien rekrutierte Arbeiter, die gehofft hatten, in der
zweiten Hälfte des Jahres 1974 einen Arbeitsvertrag auf unbefristete Zeit zu bekommen.160
Im Vertrieb plante Audi, 500 Angestellte und 200 Arbeiter einzusparen. Klar schien: Für
200 Angestellte werde sich keine andere Beschäftigung im Konzern mehr finden. Böhm
beharrte auf dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats und riet möglicherweise von
Entlassungen betroffenen Kollegen, sich an das Arbeitsgericht zu wenden.161
Slowenen, die bei Audi entlassen wurden, behielten zunächst die Aufenthaltserlaubnis und
hatten Anrecht auf das Arbeitslosengeld. Aber auch hier gab es Einschränkungen: Wer als
„schlechter Arbeiter“ oder „undisziplinierter“ Ausländer entlassen wurde, den unterstützte
auch der Audi-Betriebsrat nicht mehr. So wurde die Zahl der ausländischen Lohnabhängigen
nach und nach von 3.700 auf 2.800 gesenkt. Etliche wurden durch die Personalabteilung bei
Daimler Benz in Stuttgart, bei MAN, bei MBB und – wie schon erwähnt – bei Karmann in
159
Bislang seien noch keine Abfindungsangebote wie bei VW im Gespräch, erklärte Betriebsratsvorsitzender Fritz
Böhm. Geldangebote könnten nicht die Lösung sein. Der Betriebsrat bestehe auf der Weiterbeschäftigung Aller.
In jedem Falle müsse die Abfindung, falls sie dann doch kommen sollte, individuell berechnet werden und deutlich
höher liegen als die von VW. (Rupnik, ‚Naši v Ingolstadtu. Strah pred ovojnico‘, Delo, 31.7.1974.
160
„Wahrscheinlich“, erklärte Fritz Böhm, „erhalten davon weniger als früher unbefristete Arbeitsverträge.“
(Böhm: ‚Kein Audi-Mitarbeiter darf an die Luft gesetzt werden‘, DK, 15./16./17.6.1974.)
161
Außerdem baute der Betriebsratsvorsitzende auf die Vermittlertätigkeit des Präsidenten des Landesarbeitsamts. (Ebd.)
43
IOS Mitteilung Nr. 66
Osnabrück untergebracht. Auf diese Weise zählte man in Ingolstadt selbst alle vier Wochen
150 ausländische Arbeiter weniger; allerdings war auch der Gesamtpersonalbestand um rund
2.000 geschrumpft.162
Auf Belegschaftsversammlungen erhob sich Protest gegen das Weiterverleihen von
Arbeitern, die seit einem oder zwei Jahren in der Stadt lebten und zum Teil ihre Familie dort
gegründet oder zusammengeführt hatten. 163 Eine deutsche Gewerkschaftsdelegation rechtfertigte demgegenüber in Murska Sobota die Vermittlung von 150 jugoslawischen AudiArbeitern an andere Firmen „aus betrieblichen Gründen“: Alle vermittelten Arbeitnehmer
hätten 700 Mark erhalten, was als 13. Monatslohn zu verstehen sei, den sie bei den neuen
Firmen nicht bekämen.164
Audi zahlte auch keine Abfindungen, sondern stockte lediglich das Arbeitslosengeld bis zur
Höhe des Nettogehalts auf. Das war für die Arbeiter von Vorteil: Eine Abfindung verhinderte
die Auszahlung von Arbeitslosengeld. Nur das Arbeitsamt sparte in diesem Falle.165
Tatsächlich kam es bis Anfang Dezember 1974 auch zu Entlassungen, deren Gesamtzahl auf
2.200 stieg. Die Betroffenen waren zur Hälfte türkische Arbeiter, die zum Teil vom Arbeitsamt
auf andere Stellen im Bundesgebiet weiter vermittelt wurden.166 Zum Jahresende stand fest,
dass die Belegschaft von Audi NSU von 33.800 auf 28.600 zurückgegangen war. Zwar waren
Massenentlassungen vermieden worden, aber das gesamte Spektrum an Maßnahmen von
Frühverrentung, Aufhebungsvertrag bis zur Weitervermittlung an andere Firmen war eingesetzt
worden. Entlassungen in einer Größenordnung von unter 50 pro Monat, die dem Landesarbeitsamt nicht gemeldet werden mussten, wurden vorgenommen, wenn es an der Person des zu
entlassenden Arbeiters festmachbare Kündigungsgründe gab.167
Es war jedoch nicht allein die Personalpolitik des Automobilkonzerns, die den Slowenen in
Ingolstadt Sorgen bereitete; im Umfeld der Krise tauchten auch Forderungen auf, die
Bewegungsfreiheit der ‚Gastarbeiter‘ einzuschränken.
162
Rupnik: ‚Naši v Ingolstadtu‘.
Schlemmer, Industriemoderne, S. 290.
164
Feri Maučeč, ‚Obisk sindikalne delegacije iz Ingolstadt‘, Vestnik, 17.10.1974; siehe auch ‚Domačini o naših
delavcih‘, Večer, 25.10.1974. (dt. Übersetzungen: ‚Besuch der gewerkschaftlichen Delegation aus Ingolstadt‘
bzw. ‚Gastgeber über unsere Arbeiter‘, alle in: Archiv Betriebsrat, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat.)
165
‚Personal um 10% abgebaut‘, DK 25.9.74.
166
‚Als Weihnachtsgeschenk bei Audi keine Entlassungen‘, DK, 3.12.1974.
167
Werner, Fritz Böhm, S. 152.
163
44
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Rotation und Zuwanderungsstopp
So kündigte das Landesarbeitsamt Südbayern im März 1975 an, in Ingolstadt keine Aufenthaltsund Arbeitsgenehmigungen für Ausländer aus Drittstaaten mehr auszustellen. Dieser absolute
Zuwanderungsstopp sei allerdings auf ein Jahr begrenzt, erklärte Alfred Kohl, Präsident des
LAA. Der Nachzug von Familienangehörigen habe die Zahl der Migranten „inzwischen wieder
auf über 10 000 ansteigen lassen“, wobei die Jugoslawen mit rund 3 500 die größte Gruppe
stellten, gefolgt von den Türken mit über 3000. Von den Jugoslawen heißt es, sie würden den
Sommer großenteils „auf Heimaturlaub fahren, jedoch die Familien voraussichtlich nicht mit
nach Ingolstadt bringen, da die Schul- und Wohnsituation dort problematisch sei.“168
Den Anfang mit dem ‚Zuzugsstopp‘ hatte schon im Januar 1974 die bayerische Landeshauptstadt gemacht; Überfremdungsängste – „Türkisch und Serbokroatisch übertönen in einzelnen Straßenzügen bayerische Mundart“ – wurden ebenso mobilisiert wie die Furcht vor einer
‚Zerstörung der Bausubstanz einzelner Straßenzüge‘, vor einer ‚kritischen Zuspitzung der hygienischen Lage‘ und vor der wachsenden Kriminalität, allesamt Themen, die unter dem
Schlagwort ‚Ghettobildung‘ abgehandelt wurden.169
In Ingolstadt wurde zum 1. April 1975 ein Anwerbestopp verhängt. Insgesamt bestätigte sich,
dass Bayern unter den deutschen Bundesländern dasjenige war, in dem Migranten wie in keinem
anderen unter dem Druck standen, „ihre Anwesenheit als zeitlich befristet zu verstehen.“170
Für die Lage bei Audi interessierte sich auch das Landesamt für Verfassungsschutz. Einem
Bericht an das bayerische Innenministerium zufolge waren in Ingolstadt seit Ende Februar 1975
insgesamt 385 jugoslawische und 300 türkische Arbeiter erwerbslos gemeldet. Das waren über
zwei Drittel der insgesamt 1.004 arbeitslosen Ausländer. Die allgemeine Arbeitslosenquote lag
bei 9,3%. Hartnäckig hielten sich Gerüchte über das Risiko einer Betriebsschließung. Die zumeist
aus Gebieten ohne eigene Industrie stammenden Südslawen werden als „nicht rückkehrwillig“
beschrieben. Die Arbeitslosenunterstützung in Deutschland sei für sie attraktiver als die Arbeit in
der Landwirtschaft zu Hause. Die Arbeiter blieben daher, solange dies möglich sei.171
Am 14. April 1975 beschloss der Aufsichtsrat der Volkswagen AG, im Werk Ingolstadt 1.700
und in Neckarsulm 4.700 Stellen zu streichen. Eine Woche später billigte auch der Aufsichtsrat
von Audi NSU den Plan, allerdings mit einer sehr knappen Mehrheit. Die anstehenden Stellenkürzungen riefen Unruhe und Besorgnis unter den ausländischen Arbeitern hervor. Die Firmen-
168
‚Ab April für Ausländer keine Arbeitsgenehmigung mehr‘, DK 21.3.1975
‚München fürchtet Ghettos‘, Welt am Sonntag, 6.1.1974.
170
Boos-Nünning, Muttersprachliche, S. 57. Koller, Ingolstadt plant, 1972–1982, S. 40.
171
BayLfV an BayMInn, 17.3.1975, in: BayHSTA, MInn 97572; Koller, Ingolstadt plant 1972–1982, S. 40.
169
45
IOS Mitteilung Nr. 66
leitung reagierte mit dem Angebot, eine Prämie zwischen 3.000 und 7.000 Mark zu zahlen, abhängig von der Stellung des Beschäftigten im Betrieb und von den Dienstjahren bei Audi NSU.
Diese Zahlung war allerdings an die Bedingung geknüpft, dass der Empfänger das Arbeitsverhältnis sofort auflöste und im Laufe von drei Tagen in sein Herkunftsland zurückkehrte. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich: Angeblich wurde das Angebot von 112 Jugoslawen und 300
weiteren, meist aus der Türkei stammenden Migranten angenommen.172
Es kam aber auch zu Beschwerden und zur Einberufung einer Krisensitzung, an der Vertreter
der Audi-Firmenleitung, des Betriebsrats, der Stadtverwaltung und der involvierten Arbeitsämter in Deutschland, Slowenien und Kroatien teilnahmen. Die ursprünglich bis Ende Mai geplante „Entlassungs- und Abfindungsaktion“ wurde bis zum Ende der Gespräche unterbrochen.173 Bis zu den Betriebsferien im Hochsommer war der Personalabbau bei Audi dann weitgehend abgeschlossen. Im Herbst stieg der Absatz wieder, u.a. durch die Öffnung des Volkswagen-Vertriebsnetzes für die Fahrzeuge von Audi.174
Laut Aussage Böhms bestand noch ein ‚Überhang‘ von 200 Arbeitern, die aber nicht entlassen werden, sondern Aufhebungsverträge erhalten sollten. Auch wollte die Werksleitung in der
neuen Lage die ‚Fluktuation‛ nicht automatisch aufheben. Der Bau von schon bestellten zusätzlichen 8.000 Audi 80 sollte nicht durch Neueinstellungen, sondern durch Sonderschichten in
den Monaten September-Dezember ermöglicht werden. Die Belegschaft war einverstanden,
aber der Betriebsrat machte seine Zustimmung vom Entgegenkommen der Geschäftsleitung
abhängig.175
Am Jahresende sicherte sich die Belegschaft einen Anteil an der verbesserten Ertragslage in
Form einer Sonderzuwendung, bei deren Berechnung auch die zwei Lohn- und Gehaltserhöhungen von 1974 (Februar und November) zugrunde gelegt wurden.176
172
Interessenausgleich und Sozialplan, AdsD, IGM-Archiv, 5/IGMA 170008; hiervon etwas abweichende Zahlen
in: Grieger, ‚Geplatzte Wirtschaftswundertüte‘, S. 69. BayLfV an BayMInn, 17.3.1975, in: BayHSTA, MInn
97572. Werner, (Fritz Böhm, S. 153) nennt für die Prämien sogar eine Obergrenze von 11.000 DM.
173
BayLfV an BayMInn, 7.5.1975, BayHSTA, MInn 97572.
174
Problem einer koordinierten Beschäftigungspolitik, AUDI/(NSU (Kollege Böhm) 1.9.75, in: IG Metall Archiv,
VSt Ingolstadt, AdsD, 5/IGMA160211.
175
Ebd.; Grieger, ‚Geplatzte Wirtschaftswundertüte‘, S. 73.
176
Werner, Fritz Böhm, S. 157f.
46
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Vereine: Vom Jugoslawischen Club zum Slowenischen Kultur- und
Bildungsverein Lastovka
Auf dem Feld der Geselligkeit und des Vereinswesens der slowenischen Arbeiter trafen nach
1968 sehr unterschiedliche Interessen aufeinander. In Ingolstadt organisierte die Katholische
Mission die ersten Deutschkurse für die neu eingetroffenen Migranten. Das Beisammensein
fand oft unter sehr schlichten Bedingungen statt.177
Die Vereinsgründung wurde nach einigen Jahren zu einer Frage des kulturellen Überlebens
in der fremden Umgebung und es waren auch nach 1968 zum Teil wieder dieselben Institutionen, die in einen Wettbewerb um den Konsens und das Engagement der Arbeitswanderer traten.
1) An erster Stelle ist noch einmal die katholische Kirche zu nennen, vertreten durch die
Slowenischen Missionen, denen jeweils ein aus Slowenien oder aus dem katholischen
Exil stammender Kleriker vorstand.
2) Sodann suchten die Generalkonsulate und Konsulate nach Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Vereinsgründungen im Sinne der jugoslawischen Außenpolitik. In den
konsularischen Vertretungen betätigte sich auch der Bund der Kommunisten Jugoslawiens, die alleinige Regierungspartei der jugoslawischen Föderation, die ansonsten im
Ausland organisatorisch ziemlich bedeutungslos war.178
3) Es folgte der seit 1953 bestehende ‚Sozialistische Bund der Werktätigen‘ (SZDL) Jugoslawiens mit seinen zentralen Organen und insbesondere einem Migrationsreferat (srbkr.
‚Matica iseljenika‘; slow. ‚Izseljenska matica‘), das die offizielle Parteilinie weitgehend
umsetzte, auch wenn daneben noch diverse Parallelinstanzen mit Problemen der Migranten
befasst waren. 179 Unter der Leitung des SZDL trafen im Dezember 1974 verschiedene
gesellschaftliche Organisationen, darunter Gewerkschafts-, Jugend- und Sportverbände,
ein Abkommen über die Kulturarbeit unter den Migranten, die Gründung von Vereinen und
Clubs, ein kulturelles Veranstaltungsprogramm. Der Sozialistische Bund organisierte die
europäischen Vereinstreffen und Aussprachen zwischen den Vereinsvorsitzenden.180
177
‚Ingolstadt‘, in: NL, Nr. 4, 1973.
AS 1589/IV, AE 274, CK ZKS, Seja pooblaščenstva PZKJ – 23.5.1973, vabilo in zapisnik.
179
B.R., Socialistična zveza delovnega ljudstva, in: Drnovšek, Slovenska kronika, S. 197. In der Ära Kavčič
verfolgte der „Sozialistische Bund“, in dem Massenorganisationen wie Gewerkschaften, Frauen- und Jugendverbände zusammengeschlossen waren, einen zaghaften Unabhängigkeitskurs gegenüber dem Bund der Kommunisten, wie die Parteiorganisation seit dem Kominformkonflikt hieß. Hoffnungen auf einen größeren Pluralismus
innerhalb der slowenischen Gesellschaft zielten gerade auf die Möglichkeit, bei den Wahlen nicht für eine
Einheistliste abstimmen zu müssen, sondern beispielsweise zwischen einem kommunistischen Parteimitglied und
einem parteilosen Repräsentanten des Sozialistischen Bundes wählen zu können. (Vgl. Franc Šetinc, Mnenja in
kritika. Volitve 1969 v Jugoslaviji, in: RG, 7–8. 1969, S. 280.)
180
AS 537, 1149, 1285, Osnutek družbenega dogovora o nudenju pomoči pri samoorganizuiranjuprirejanju
kulturnih prireditev za naše delavce na začasnem delu v tujini, 9.12.1974; Ebd., 1170, 1348, Teze za razgovor
predsednikov, oziroma predstavnikov slovenskih društev in klubov, dne 12.6.1976 v Frankfurtu.
178
47
IOS Mitteilung Nr. 66
4) In Ingolstadt kamen regionale Gremien des Sozialistischen Bundes aus dem Pomurje hinzu,
die eine Art Patenschaft über das Vereinswesen der Migranten anstrebten. Als wichtiges
Argument führten sie ins Feld, die meisten Arbeitswanderer bei Audi NSU stammten aus
der nordöstlichen Grenzregion Sloweniens; folglich sollten sie auch am besten einen
eigenen ‚Club der Pomurer‘ gründen. 181 Um 1980 trug der SZDL von Murska Sobota
finanziell die Betreuung der Vereine und der muttersprachlichen Lehrerin in Ingolstadt. Er
finanzierte bilaterale Treffen und das sogenannte ‚Neujahrstreffen in der Heimat‘.182
5) Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit der jugoslawische Geheimdienst UDBA, der
seit Ende der 1960er Jahre immer mehr in eine Reihe von Intelligence-Organisationen
auf der Ebene der Einzelrepubliken zerfiel, versuchte, in die Migrantenszene
hineinzuarbeiten. Die nicht sehr zahlreichen in der Dokumentation aufleuchtenden Fälle
sollen benannt werden.183
6) Umgekehrt sollte auch die Initiative einzelner Migranten nicht unterschätzt werden, die
ihr privates Hobby in eine Vereinsform gossen und andere Slowenen (oder allgemeiner:
Jugoslawen) um sich sammelten. Zu den Protagonisten zählten auch Vertreter der
Gewerkschaften wie Betriebsräte und Vertrauensleute, die ihren innerbetrieblichen
Einfluss auf die kommunale Ebene ausweiteten, indem sie im Vereinswesen tätig wurden.
7) Zu nennen sind aber auch deutsche Stellen, die beispielsweise in einer gemeinsamen
Entschließung des bayerischen und des slowenischen Ministerpräsidenten im Juni 1976
aufgefordert wurden, die Vereinstätigkeit der Migranten im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu unterstützen.184
181
Insbesondere versprach man sich im Pomurje davon ‚eine positive Wirkung auf die produktive Leistung unserer
Arbeiter‘ bei Audi; die slowenischen Arbeiter ‚hätten weniger Heimweh und andere Sorgen‘ als die, die
normalerweise unter Migranten verbreitet seien. Pomurski Medobčinski svet SZDL (Zwischengemeindeausschuss
des Sozialistischen Bundes der Werktätigen) an den Audi Betriebsrat in Ingolstadt, 27.8.1976, Archiv des
Betriebsrats der Audi AG, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat. Angekündigt wird eine Delegation zur
Gemeindeversammlung in Ingolstadt, der auch Milan Kučan als „Sekretär der Republik- Konferenz SZDL
Slowenien“ angehören soll. Analog zum ›Fall Ingolstadt‹ übernahm der Sozialistische Bund von Ptuj die
Schirmherrschaft über den Sava-Verein in Frankfurt (Republiski sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije.
Uprava za analitiko, Delavci.) Es gab weitere Patronate slowenischer Städte über Migrantenvereine.
182
Vgl. AS 537, 1709 OK SZDL Murska Sobota an KO SZDL Ljubljana, 7.1.1980 (mit detaillierten Angaben
über die Subventionierung der Arbeit mit den Migranten durch den Sozialistischen Bund.)
183
Bekannt wurde beispielsweise, dass die UDBA gegen den Klagenfurter Hermagoras Verlag (slow. Mohorjeva
družba) vorging, in dem u.a. die konservativ-katholische Migrantenzeitschrift Naša luč erschien. Den politischen
Kontext der Überwachung beleuchtet von slowenisch-offizieller Seite ein im Dezember 1980 entstandener Bericht
des Innenministeriums in Ljubljana (Republiški sekretariat, Delavci na začasnem bivanju in delu v tujini, AS 1931,
šk. 2322, S. 29.)
184
Alfons Goppel an Andrej Marinc, Beilage, Gemeinsame Beschlüsse und Empfehlungen anläßlich des Besuches
des Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern in der SR Slowenien, 14.6.1976, BayHStA, StK 16237.
48
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
In den beiden ersten Jahren ihrer Anwesenheit in Ingolstadt waren die slowenischen und auch
alle übrigen jugoslawischen Arbeiter mit einem säkularen Mangel konfrontiert: Dem Fehlen einer
sozialen Infrastruktur, etwa in Form eines jugoslawischen Zentrums. So verfügten bis 1969 in der
Industriestadt nur die italienischen und spanischen Migranten über eigene Freizeiträume.185
Auch wenn man den Slowenen später oft attestiert hat, ihre Integration sei im Wesentlichen ohne
Reibungen erfolgt, muss klar sein, dass die Anfänge für die meisten gastarbajterji schwer waren.
Kontakte zwischen slowenischen und deutschen Familien blieben rar; Deutsch sprachen die meisten Migranten allenfalls im Kollegenkreis während der Arbeit und in den Pausen. Ansonsten blieben sie aufgrund ihrer spärlichen Sprachkenntnisse auf die Gemeinschaftsunterkunft verbannt.
Es gab zu wenig Dolmetscher und Betreuer für die Arbeiterinnen und Arbeiter; man baute
deshalb zunächst auf jugoslawische Sozialarbeiter aus München, die in regelmäßigen Abständen Ingolstadt besuchen sollten.186 Immerhin betrieb allein der Caritasverband Ende 1970 in
der Landeshauptstadt neun Betreuungsstellen für ‚Gastarbeiter‛, darunter zwei für Kroaten und
eine für Slowenen.187 Einige Jahre später kamen sechs Freizeitheime hinzu, eines davon für
Kroaten und eines für Slowenen.188
Auf der anderen Seite war die Eigeninitiative der Migranten gefordert; der Ruf danach kam
vor allem aus Jugoslawien selbst, wo mit der gesamtgesellschaftlichen Orientierung auf die
Arbeiterselbstverwaltung eine Art Aufbruchstimmung einherging, die auch das individuelle
Engagement förderte.189 Zum Kongress der Arbeiterselbstverwaltung lud der JGB 23 Vertreter
aus der Bundesrepublik ein, die als Mitglieder der DGB-Gewerkschaften zu Vertrauensleuten
gewählt worden waren.190
Im Juli 1976 fand in Dubrovnik ein Seminar für Betreuer jugoslawischer Arbeiter aus ganz
Europa statt, an dem auch ein Sozialberater aus Ingolstadt teilnahm.191 Ziel der zum Teil von
185
BA Koblenz, B 119, 3019, LAA Südbayern, Erfahrungsbericht 1969 über Beschäftigung, Anwerbung und
Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer, S. 5.
186
‚Jugoslawischer Alltag bei uns‘, DK 11./12.4.1970.
187
BA Koblenz, B 119/3015, LAA Südbayern, Erfahrungsbericht 1970, S. 26.
188
StA München, Arbeitsämter 1960, LAA Südbayern, Erfahrungsbericht 1972, S. 37f.
189
Ein Auszug aus dem Bulletin Nr. 11 vom November 1976 – ausgegeben vom Zentrum für Migrationsforschung –
Zagreb, Jugoslawien, S.1f., in: IGM Vorstand, Länderakten Jugoslawien, IGM Archiv, AdsD, 5/IGMA0800063.
190
AdsD, Archiv der IG Metall, Ausländische Arbeitnehmer, 5/IGMA260019, Ergebnisprotokoll der Sitzung der
Ständigen Kommission des Jugoslawischen Gewerkschaftsbundes und des Deutschen Gewerkschaftsbundes am
26. und 27. Februar 1971 in Hamburg, S. 15.
191
Beilage zu 2020/32-18, 28.7.1976, BayHStA, MInn 97572. Später führte das Bundesbüro für Beschäftigungsangelegenheiten in Belgrad solche Seminare durch. „Die Informationen, die dort über neue Gesetze, politische und
soziale Entwicklungen in Jugoslawien vermittelt werden sowie der Austausch mit Verantwortlichen aus Jugoslawien,
z.B. aus dem Bereich der Sozialversicherung, haben sich als sehr hilfreich für die Arbeit der Sozialberater erwiesen. Die
Arbeiterwohlfahrt unterstützt daher die Teilnahme ihrer Sozialberater für Jugoslawien an diesen Seminaren, indem sie
ihnen dafür – mindestens alle zwei Jahre – Dienstbefreiung gewährt.“ (Archiv der Arbeiterwohlfahrt. Ordner Seminar
in Jugoslawien, 21.–23.10.1987. Arbeiterwohlfahrt, Bundesverband an Finanzamt Gelsenkirchen-Süd, 27.6.1989.)
49
IOS Mitteilung Nr. 66
hohen Regierungsvertretern gehaltenen Vorträge war die Immunisierung der Migranten gegen
Gruppen des kroatischen und allgemeiner jugoslawischen Exils (Ustaša-Nachfolgegruppen, sogenannte „Kominformisten“.) Daneben befasste man sich mit der Zukunft des jugoslawischen
Club- und Vereinswesens in Westeuropa, wobei auch eine Tendenz zur Respektierung der
kulturellen Eigenständigkeit von Slowenen, Makedoniern, Kroaten u. a. durchschien.192 Die
Angst vor den kroatischen Faschisten saß tief: Anfang 1966 beklagte der jugoslawische
Generalkonsul in München, dass viele Migranten bei ihrer Ankunft auf dem Bahnhof „den
Ustaschas in die Fänge“ gingen, die die prekäre Lage der Arbeiter ausnutzten.193 In der Bundesrepublik warnten insbesondere die Gewerkschaften vor einer Einflussnahme illegaler extremistischer Gruppen auf die jugoslawischen Arbeitnehmer.194
Gleichzeitig lobte ein Vertreter der IG Metall das Engagement südslawischer Arbeiter, die
nicht erst auf Anregungen von außen oder finanzielle Mittel warteten, um Folkloregruppen und
Bibliotheken zu gründen oder Sprachkurse ins Leben zu rufen als „Initiative von unten“. Von
gewerkschaftlicher Seite könne man nur die Eigeninitative fördern, damit die Migranten
„Vereine oder Clubs auf örtlicher Ebene gründen.“195
Großer Beliebtheit erfreuten sich unter den Slowenen die Ensembles, unter denen das der
Avsenik-Brüder – in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Namen ‚Oberkrainer‛
bekannt – besonders erfolgreich war. Die offizielle Izseljenska matica und die kirchlichen
Stellen wetteiferten darin, Auftritte solcher Ensembles zu organisieren, über die dann später
in der Migrantenpresse berichtet wurde.
Slowenen als solche wurden allerdings zunächst nur von kirchlicher Seite auf dem Wege der
Katholischen Missionen angesprochen; für sie war der Katholizismus ohnehin ein Eckpfeiler des
Slowenentums. Ein wichtiges Instrument der Einflussnahme auf die Migranten war die kirchliche
und die regierungsnahe Monatspresse in Form der Zeitschriften Naša luc und Rodna gruda. Während Naša luč über das Oberseelsorgeamt und die Katholischen Missionen verbreitet wurde, Anfang der 1960er Jahre in 1.000 Exemplaren und Mitte der 1980er Jahre zusammen mit einigen
weiteren kirchlichen Publikationen in einer Auflagenhöhe von 10.000 erreichte, gelangte Rodna
192
BayLfV an MInn, 28.7.1976, BayHSTA, MInn Terrorismus 97572.
BA K, B 149, 6241, Französische Botschaft – Schutzmachtvertretung für deutsche Interessen an AA, Bonn,
26.1.1966.
194
Die jugoslawischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik – die „jüngste“ und stärkste Sprachgruppe der
ausländischen Arbeitnehmer. Vortrag von Max Diamant, im Rahmen der Generalversammlung der DeutschJugoslawischen Gesellschaft in Frankfurt/M. (19.11.1971), Manuskript, IGM-Bibliothek Frankfurt/M, S. 17.
195
AdsD, Archiv der IG Metall, Ausländische Arbeitnehmer, 5/IGMA260019, Ergebnisprotokoll der Sitzung der
Ständigen Kommission des Jugoslawischen Gewerkschaftsbundes und des Deutschen Gewerkschaftsbundes am
26. und 27. Februar 1971 in Hamburg, S. 12.
193
50
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
gruda über ein Abonnentensystem und über die Verschickung von Freiexemplaren an die Leserschaft. Das Blatt lag in Vereinsräumen und Konsulaten aus und hatte 1972 rund 4.000 individuelle Abonnenten. Ein weiteres Organ der offiziellen Slovenska izjeljenska matica war der seit
1954 erscheinende jährliche Kalender, der bis 1971 Slovenski izseljenski koledar und danach nur
noch Slovenski koledar hieß.196
Auch die Belgrader Behörden blieben nicht untätig; Aufrufe aus der Hauptstadt und Initiativen einzelner Betreuer oder ‚Gastarbeiter‘ ließen verzweigte Netzwerke ‚Jugoslawischer
Clubs‘ entstehen, die sich in den 1970er Jahren verdichteten. Den ersten Jugoslawischen Club
hatten schon 1922 jugoslawische Einwanderer aus Serbien und Dalmatien in Chicago gegründet; als Modell für die Vereine der ‚Gastarbeiter‘ bot sich auch der 1966 an der jugoslawischen Botschaft in Paris gegründete Club an, der in der Presse Jugoslawiens „lobend hervorgehoben“ wurde.197 Nach Angaben von Ivo Baučić bestanden 1978 etwa 700 Zentren, Vereine und Sportclubs jugoslawischer Migranten in Europa.198 Ein Arbeitspapier des DGB hatte
zwei Jahre zuvor für die Bundesrepublik Deutschland 102 allgemeine Clubs, 18 Initiativausschüsse und 143 Sportvereine südslawischer Arbeitnehmer aufgezählt. Regionale Schwerpunkte lagen in Baden Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, wobei die Zahl von
„ca. 100 Clubs einschließlich reiner Sportvereine“ für Baden-Württemberg etwas übertrieben,
die von 29 bzw. 19 für die beiden anderen Bundesländer durchaus realistisch erscheint.199
In größeren Industriestädten gehörten zwischen 5 und 10% der Migranten diesen Vereinen
an, die Gesamtzahl der Vereinsangehörigen schätzte der DGB auf 2–3% aller Jugoslawen in
der Bundesrepublik. In jedem Falle war die Club-Mitgliedschaft weniger verbreitet als die in
einer der Gewerkschaften; hier waren immerhin etwa 100.000 Jugoslawen organisiert, das heißt
22,7% der Gesamtzahl für das Jahr 1976.200
Ein Mitglied des Bundesrates der jugoslawischen Gewerkschaften forderte die Migranten
auf, im Ausland in die progressiven Gewerkschaften einzutreten, zu denen er auch die IG Metall
rechnete. Die Mitgliedschaft in den Arbeitnehmerorganisationen werde zwischen der BRD und
196
AS 1589, CK ZKS, IV, 79, AE 227, Obrazložitev predračuna Slovenske izseljenske matice za 1.1972, S. 2f.;
AS 537, 1045 Arhiv sekretariata KO SZDL, Del programma za leto 1979 ki se nanaša na delavce na začasnem
delu v tujini; AS 537, RK SZDL, fasc. 1696, 1165, Informacija o problemih in stanju med delavci na začasnem
delu v tujini.
197
BA Koblenz, B 149, 6240, Französische Botschaft – Schutzmachtvertretung für deutsche Interessen, an AA
Bonn, 23.2.1966; ‚55 let Jugoslavanskega kluba v Chicagu‘, RG, 1. S. 33f.
198
Übersetzung aus der kroatischen Tageszeitung Vjesnik vom 5.7.1978.
199
IGM, Abt. Ausländische Arbeitnehmer, Materialsammlung über Vorgänge im jugoslawischen Sprachbereich
(Februar 1977), S. 81f, in: IGM-Archiv, 5/IGMA 080064. Einer kroatischen Quelle zufolge stieg die Zahl der
Jugoslawischen Clubs in den diversen Bundesländern bis 1988 auf 399. Vgl. Novinščak, Yugoslav, S. 138.
200
IGM, Abt. Ausländische Arbeitnehmer, Materialsammlung über Vorgänge im jugoslawischen Sprachbereich
(Februar 1977), S. 81f, in: IGM Archiv, 5/IGMA 080064.
51
IOS Mitteilung Nr. 66
der SFRJ wechselseitig anerkannt; den deutschen politischen Parteien im Einwanderungsland
sollten jugoslawische ‚Gastarbeiter‘ demgegenüber fern bleiben.201
Die Einstellung der deutschen Gewerkschaften zu den Jugoslawischen Clubs veränderte sich
in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre. Auf zentraler Ebene sah die IG Metall in ihnen lästigen
Konkurrenten und bekämpfte sie vor allem, wenn sie versuchten, in Großbetrieben mit starkem
jugoslawischem Belegschaftsanteil Fuß zu fassen.202 Die Ausbreitung von „Nebenorganisationen
zu den Gewerkschaften“ widerspreche, so hieß es, diversen Absätzen in der Entschließung des
11. ordentlichen Gewerkschaftstages. Ungern registrierte man in der IG Metall-Zentrale auch den
Einfluss der Belgrader Behörden auf das Vereinswesen der Migranten. Wenig Klarheit hatten die
deutschen Gewerkschafter zu diesem Zeitpunkt über die zunehmende Verlagerung von
Entscheidungskompetenzen aus der Hauptstadt auf die Einzelrepubliken.203
Wer als Arbeitswanderer gewerkschaftlich und politisch tätig war, der war gut beraten, mit
beiden Seiten auszukommen, mit der jeweiligen DGB-Einzelgewerkschaft und mit der Auswandererabteilung des Sozialistischen Bundes. Die jugoslawischen Behörden förderten die
Clubs umso mehr, je offenkundiger wurde, dass ein beträchtlicher Teil der Jugoslawen beabsichtigte, länger im Ausland zu bleiben. Letztlich sollten die Vereine dazu dienen, gute Kontakte und dauerhafte Verbindungen zur Heimatregion herzustellen. Nicht anders verhielt sich
dies mit den in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre gegründeten slowenischen Vereinen, von
denen die Ingolstädter Lastovka lange Zeit einer der bedeutendsten war.204
Besonders hohe Werte wies die jugoslawische Präsenz in der IG Metall dort auf, wo sich die
Masse der Arbeiter auf einige Großbetriebe verteilte. Das zeigt der Fall der Slowenen und anderer
Jugoslawen in Ingolstadt recht deutlich: Dort betrieben die südslawischen IG Metaller nicht gerade wenig Eigenwerbung, auch der eigenen Gewerkschaft, dem DGB und den jugoslawischen
Gewerkschaften gegenüber. So tauchte in einem Arbeitspapier der IG Metall die Behauptung auf,
bei Audi seien „Ende 1973 ca. 4.000 jugoslawische Arbeitnehmer beschäftigt“ gewesen und Ingolstadt sei, ähnlich wie Wolfsburg für die Italiener, „die größte örtliche Konzentration jugoslawischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik […].“ In diesem Zusammenhang stand auch der
Plan, in Ingolstadt ein ‚Europäisches Bildungszentrum‘ der Gewerkschaften einzurichten, der
wahrscheinlich angesichts des Anwerbestopps nicht mehr weiter verfolgt wurde.205
201
IGM, Materialsammlung, S. 82–85.
Belegbar ist ein solcher Fall für die Siemenswerke in München mit ihren 1.234 Arbeitern im Jahre 1972. Vgl.
Jugoslovanski klub v tovarni Siemens v Münchnu, Rodnagruda, 3, 1972, S. 20.
203
IGM, Materialsammlung, S. S. 2–4; Anton Rupnik, ‚Naš pogovor. Vsi v sindikate‛, RG, 2. 1972, S. 20.
204
Die offizielle Bezeichnung war laut Satzung: Slovensko kulturno-prosvetno drustvo „Lastovka“ e.V. Ingolstadt
(vgl. AS 537, sk. 1170, 1349, Statut.)
205
Arbeitspapier, S. 20.
202
52
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Clubs der Jugoslawen
Die Jugoslawischen Clubs (oder auch: Clubs der Jugoslawen, manchmal auch kurz: Jugo-Clubs)
verfügten über einen eigenen Feier- und Jahrestagskalender: Besondere Feste oder andere
Zusammenkünfte gab es an den auch in Jugoslawien selbst begangenen Gedenktagen der Arbeiterund Frauenbewegung sowie des Partisanenwiderstands, so etwa am 8. März (‚Internationaler Frauentag‘), 1. Mai (‚Tag der Arbeit‘), 25. Mai (‚Tag der Jugend‘ – Titos Geburtstag), 4. Juli (‚Tag der
Kämpfer‘ – in Erinnerung an den Aufruf der jugoslawischen Kommunisten vom Juli 1941, gegen
die Besatzer zur Waffe zu greifen) und 29. November (‚Tag der Republik‘).206
Im bundesweiten Durchschnitt gehörten 1975 jedem Club etwa 150 Mitglieder an, eine Zahl,
die später in Ingolstadt von dem slowenischen Verein Lastovka um ein Vielfaches übertroffen
wurde.207
Zwar organisierten die Clubs vor allem unpolitische Aktivitäten, aber die Mitglieder waren
verpflichtet, die Innen- und Außenpolitik Jugoslawiens zu akzeptieren und die Verfassung
des Landes zu achten. Ein Mitglied des Auswandererkomitees des jugoslawischen Bundesexekutivrats berichtete Anfang März 1972, 95 Prozent der Clubs in den verschiedenen Zielländern seien auf jugoslawischer Grundlage organisiert. Das konnte im Einzelfall aber auch
heißen, dass die an vielen Orten besonders stark vertretenen Kroaten auch das Vereinsleben
dominierten.208
Die Clubs grenzten sich scharf von den Vereinen des politischen Exils und von sogenannten
„nationalistischen Organisationen“ ab. Was darunter zu verstehen sei, wurde nicht genauer definiert. Eigenständige slowenische Vereinsgründungen gerieten leicht unter Nationalismusverdacht, auch wenn sie nicht von so genannten Domobrancen-Priestern oder Vertretern des traditionellen bürgerlichen und christlich-sozialen Exils initiiert wurden.209
Die Vereinslandschaft war ziemlich komplex, denn Belgrad ließ auf einer regionalen oder
nationalen Basis gegründete Clubs bzw. Sektionen zu, wenn sie auf derselben programmati-
206
Rozman/Melik/Repe, Öffentliche Gedenktage, S. 331–335. Vgl. die dichte Beschreibung des von serbischen
Vlachen in Skandinavien begangenen 29. November in Schierup/Ålund, Will they still be dancing. Integration and
Ethnic Transformation among Yugoslav Immigrants in Skandinavia, Göteborg 1987, S. 200–204.
207
Haberl, Abwanderung, S. 144.
208
Borba, 8.3.1972, hier nach Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa, XXVI. Jg. April 1972, Heft 4, Die
jugoslawischen Gastarbeiter, S. 53. (Der ‚Wissenschaftliche Dienst‘ wurde als Monatszeitschrift vom SüdostInstitut in München bis 1981 publiziert; Redakteur war Hans Hartl. Die Jahrgangszählung wurde ab 1982 von
der neuen Zeitschrift ‚Südosteuropa‘ übernommen) Siehe auch Winterhagen, Transnationaler Katholizismus,
S. 96.
209
Interview mit Marija Schmid. Zu den fließenden Grenzen zwischen „verbotenem Nationalismus und geforderter
Heimatliebe“ im Jugoslawien der späten 1960er und frühen 1970er Jahre jetzt Calic, Geschichte, S. 237.
53
IOS Mitteilung Nr. 66
schen Grundlage arbeiteten wie die Clubs der Jugoslawen, also mit ihren Autonomieforderungen im institutionellen Rahmen der jugoslawischen Föderation blieben. Dasselbe galt für Berufsvereinigungen, etwa von Ärzten oder Gastwirten.210
Demgegenüber verzichtete Belgrad gänzlich darauf, die Gründung eigener Clubs oder Sektionen für Frauen anzuregen. Die Vorstände der jugoslawischen Clubs waren von Männern dominiert, eine autonome Organisation von Frauen nur im Falle einiger Sportarten vorgesehen.211
Ein Hauptproblem beim Aufbau der Clubs war die geringe Bereitschaft oder Fähigkeit des
Sozialistischen Bundes, der Kommission für Auswanderungsfragen und der Generalkonsulate,
die dafür benötigten finanziellen Mittel aufzubringen. Allerdings kam es vor, dass Regionalorganisationen des SZDL Patenschaften über einzelne Vereine übernahmen, deren Mitglieder
überwiegend aus der Region stammten, für die die jeweilige Organisation zuständig war. Bei
Slowenen und Kroaten sprang manchmal auch die Caritas ein, wenn ein Club besonders in
Geldnöten war. Verbreitung fanden auch diverse Formen der Selbstfinanzierung, etwa über den
Getränkeverkauf und den Erlös von Veranstaltungen. Im Vorteil waren größere Vereine, die in
der Lage waren, ein attraktives Unterhaltungsprogramm anzubieten.
210
Als Beispiel wurde ein Club der Migranten aus dem ostserbischen Prahovo genannt; „der arbeitet sehr
erfolgreich und hält sich an unsere Verfassung.“ (IGM, Materialsammlung, S. 82–85.)
211
Waldrauch/Sohler, Migrantenorganisationen, S. 188.
54
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Jugoslawische Clubs nahmen eine wichtige Hürde
Auf dem Feld der sportlichen Aktivitäten: Seit 1971 bestand in Baden-Württemberg ein ‚Fußballverband jugoslawischer Arbeiter in der BRD‘, auch ‚Jugoliga‘ genannt, der vom Württembergischen Fußballverband, einer Untergliederung des DFB, anerkannt wurde, so dass die Migrantenvereine auch Spiele gegen deutsche Mannschaften austrugen.212
Insgesamt wurde der Ton der jugoslawischen Behörden den Migranten gegenüber in der
zweiten Hälfte der 1970er Jahre schärfer. Im Mai 1974 war die erste Resolution eines kommunistischen Parteitags zu Migrationsproblemen verabschiedet worden. Gefordert wurde dort u.a.
der Ausbau der „Verbindung zu den im Ausland lebenden jugoslawischen Bürger[n].“213
Im November 1976 veröffentlichte das Bulletin des Zagreber Migrationsforschungsinstituts
die Beschlüsse einer Präsidiumssitzung des Sozialistischen Bundes. Dort war u.a. von der Aufgabe der Clubs, Vereine und anderer Versammlungsformen die Rede, sich dem Trend zur „Assimilation und anderen negativen Einflüssen“ zu widersetzen. Das Gremium rief „zur Stärkung
der Brüderlichkeit und Einheit aller unserer Völker“ auf. Nach Auffassung Belgrads sollten die
Clubs ganz im Sinne der jugoslawischen Staatsideologie arbeiten, zu deren Kernstücken die
Losung der ‚Brüderlichkeit und Einheit‘ (bratstvo i jedinstvo) zählte.214
Wieviel von den Resolutionen aus Belgrad für das einzelne Mitglied von Bedeutung war,
wie sehr also die Vereine dazu dienten, die Kernstücke des Titoismus im Alltagsgefüge der
Migranten zu verankern, ist schwer zu bestimmen. So differieren auch die Urteile von Forschern über die Erfolge der Clubs beträchtlich: Othmar N. Haberl glaubt, wegen der engen
kulturellen Funktion und des geringen Organisationsgrades sei der Aufbau der Clubs einer „vergeblichen Mühe“ gleichgekommen. Für die Masse der jugoslawischen Arbeiter und Angestellten seien sie „ohne Bedeutung“ geblieben, da sie es weder vermocht hätten, die jugoslawischen
Migranten stärker an Jugoslawien zu binden, noch gar die Situation der Jugoslawen in den Aufnahmeländern zu verbessern.215
Ganz anders das Urteil von Carl Ulrik Schierup, das sich auf ganz Europa bezieht und insbesondere auch vor dem Hintergrund der schwedischen Erfahrung zu sehen ist. Schierup nennt
die Clubs „important centres for the conservation of national and cultural identity“. Sie hätten
die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bindungen jugoslawischer Arbeitswanderer an
212
Ivanović, „Nostalgija za prugom“, S. 142–149; „Maja Fortič, „Nogometni klub ,Prvi maj‘, RG, 9, september
1973, S. 39–41. Die Gründung der bayerischen ,Jugoliga‘ erfolgte einige Jahre später. Vgl. AS 537, šk 1149, 1285,
Zapis o obisku v Münchnu – ZRN – v času od 20. do 24. oktobra 1974.
213
Künne, Außenwanderung, S. 45.
214
Auszug aus dem Bulletin Nr. 11 vom November 1976. Vgl. Baučić, Auswirkungen, S. 197.
215
Haberl, Abwanderung, S. 144f.
55
IOS Mitteilung Nr. 66
ihr Land und ihre Herkunftsgemeinschaften aufrechterhalten und Migranten mit Informationen
über soziale und ökonomische Entwicklungen in Jugoslawien versorgt.216
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte: Auch Migrantenpopulationen sind vielfältig
strukturiert; unterschiedliche Gruppen von Arbeitern haben verschiedene Freizeitbedürfnisse.
Einem Teil dieser Bedürfnisse kamen die Clubs entgegen; ohne sie wäre der Anteil der Arbeiter,
die sich zunehmend von der jugoslawischen Gesellschaft entfernten, größer gewesen. Allerdings lassen sich weder Haberl noch Schierup auf die Frage ein, warum es seit den 1970er
Jahren zu Abspaltungen von den Jugoslawischen Clubs kam, bei denen slowenische Mitglieder
zu den Vorkämpfern neuer Vereinsgründungen wurden.
216
56
Schierup, Migration and Division of Labour S. 133.
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Initiative von unten
Die allgemeine Fragestellung nach den Erfolgen oder Misserfolgen der jugoslawischen Clubs
hat hier tatsächlich in den Hintergrund zu treten gegenüber der Frage, wieso es eigentlich zu
einer slowenisch orientierten Vereinsgründung kam und welche Erfolge sie vorzuweisen
hatte. Will man zudem verstehen, was die vielfach erwähnte ‚Initiative von unten‛ im
Einzelnen ausmachte, so hält man sich am besten an die manchmal nostalgisch verklärten,
manchmal auch ganz nüchternen Beobachtungen der Interviewpartner. Ein Gesprächspartner
etwa, Slavko Cafuta aus Ingolstadt, gab an, zeitweise in sechs verschiedenen Vereinen
Mitglied gewesen zu sein. Begonnen hatte alles damit, dass sich slowenische und anderer
jugoslawische Migranten zum Kegeln trafen. Der Jugoslawische Club hatte seine eigene
Keglerabteilung, die sich Jugoteam nannte. Bis heute bestehen in Ingolstadt Kegelvereine mit
slowenischem und kroatischem Hintergrund, die noch die alten Namen Lastovka und Sloga
tragen.217
Dass einzelne Migranten zwischen verschiedenen Vereinen hin- und herpendelten, ist ein
bereits aus der Zeit der katholischen und nationaljugoslawischen Vereine der 1920er und
1930er Jahre bekanntes Phänomen. Zunächst aber bestand in Ingolstadt nur der im Dezember
1976 gegründete Club der Jugoslawen. 218
Auch bei den katholischen Slowenen gruppierten sich die Freizeitinitiativen anfänglich um
das Kegeln. Die Kegelbahn war im Kolpinghaus gegenüber der Kirche untergebracht, in der
die slowenische Sonntagsmesse stattfand. Am Gottesdienst und an dem darauf folgenden
Treffen nahmen 1972 jeden Sonntag zwischen 100 und 150 Slowenen teil; andere Migranten
hatten sich schon daran gewöhnt, deutsche Gottesdienste zu besuchen, wieder andere besuchten
die slowenische Messe nur an den hohen Feiertagen.219
Nach dem Urteil einer weiteren Zeitzeugin gingen Initiativen zur Vereinsgründung vor allem
von den Gastarbeiterheimen aus.
217
Die Keglerinnen und Kegler bildeten ihre eigene „Jugo-Liga“, die Bundes- und Europameisterschaften
ausrichteten. Bei Letzteren gelangten die Lastovka-Frauen 1978 auf den ersten Platz. (,Zlate Lastovke-Ponovno
zlate‘, in: Lastovka, 11. 1979, S. 15.)
218
Die offizielle serbokroatische Bezeichnung lautete Klub Jugoslavenskih radnika – Audi NSU – Ingolstadt. Im
Schriftverkehr mit den slowenischen Behörden findet sich auch die Form Klub Jugoslovena Audi-NSU Ingolstadt
(Klub Jugoslovebskih [sic!] Radnika – Audi NSU – Ingolstadt. Statut, AS 537, sk. 1170, 1349; Koledar predvidenih
gostovanj in obiskov iz SR Slovenije med delavci na zacasnem delu v tujini v letu 1978, ebd. sk. 1045, Republiška
konferenca Socialisticne zveze Delovnega Ljudstva Slovenije 1952–1990, S. 1); Irma Benko, ,V Ingolstadtu vse bolj
živahno‘, RG, 4. 1977, S. 23–24, hier S. 24.
219
,Ingolstadt‘, in: NL, 6.1972. Zu diesem Zeitpunkt schätzte die katholische Zeitschrift die Zahl der Slowenen in
Ingolstadt auf 1.400.
57
IOS Mitteilung Nr. 66
„Wir haben zum Beispiel versucht, in Wohnheimen einen jugoslawischen Club [sic!], einen
slowenischen Club zu gründen. Aber sie haben das nicht zugelassen, das durfte kein slowenischer Club sein, das musste ein jugoslawischer Club sein, mit slowenischer Sektion, so hat man
das genannt.“220
Schließlich gab es auch unter den Slowenen die Initiative einzelner Arbeiter, dem Bedürfnis
einer starken Minderheit Raum zu verschaffen:
Franc Obal, einer der ersten Migranten aus dem Jahr 1968 gründete einen Autoclub, der
Kontakte zur slowenischen AMS (Auto-Motor-Sveza) unterhielt. Lastovka veranstaltete Wettbewerbe im Geschicklichkeitsfahren, an denen südslawische Vereine aus ganz Bayern teilnahmen.221
Für manchen war die Teilnahme am Vereinsleben eine Alternative zum gewerkschaftlichen Engagement im Betrieb: Slavko Cafuta war zwar Gewerkschaftsmitglied, strebte aber
nie danach, sich beispielsweise zum Vertrauensmann wählen zu lassen. Der letzte Verein,
dem er am Ende noch angehörte, war ein Anglerverein. In einem anderen Fall ergänzten
sich die beiden Formen der Aktivität und Sozialisation: Der autobegeisterte Franc Obal,
dessen Verein direkt mit der Firma Audi zusammenarbeitete, findet sich auch auf einer
IGM-Kandidatenliste zum Betriebsrat des Automobilunternehmens.222
Die Fußballabteilung des Jugoslawischen Clubs, die in der Jugoliga spielte, nutzte den Sportplatz von Auto Union für die Spiele und das Training. In der Gründungsphase erhielt der Club
viel Unterstützung aus dem Pomurje; die regionale Leitung des Sozialistischen Bundes übernahm die Schirmherrschaft über den Club in Ingolstadt.223
Unter dem Interviewmaterial finden sich zwei Zeitzeugen-Aussagen zum Funktionieren
des jugoslawischen Clubs in Ingolstadt. Im ersten Falle handelt es sich um eine Art nostalgischen Rückblick auf eine Zeit, in der es zwischen jugoslawischen Migranten unterschiedlicher Nationalität keinerlei gravierende Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte. Der Zeitzeuge antwortet zunächst auf die Frage, ob es denn den Jugoslawischen Club noch gebe:
220
Interview mit Marija Schmid. Vgl. Zvone Kokalj, „Lep večer v Ingolstadtu“, RG, 3, 1973, S. 13; ,Ingolstadt‘,
in: NL, 4. 1973, wo es heißt, im September 1973 ständen die Räume für einen ‚Slowenischen Club‘ bereit.
Interessant für die Situation in Ingolstadt ist die parallele Berichterstattung durch die staatssozialistische und die
katholische Migrantenzeitschrift. Hier kündigte sich bereits die Zusammenarbeit an, die zur Gründung von
Lastovka führte.
221
Ebd.
222
Interview mit Slavko Cafuta.
223
Irma Benko, ,V Ingolstadtu vse bolj živahno‘, RG, 4. 1977, S. 23–25, hier S. 24. Die Verfasserin beklagt u.a.
die Tatsache, dass der Club noch keine Mitgliederausweise bereitstellen konnte, dass also nicht einmal klar sei,
wieviel Mitglieder er habe.
58
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
„Ja, den gibt’s schon noch, aber der ist jetzt nur noch serbisch. Den gibt’s nicht mehr so wie
früher, mit allen 6 Nationen. […] Ich habe nie gewusst, wer Mazedonier, Serbe oder Kroate ist.
Ich habe immer nur gewusst, dass er aus dem Süden kommt. Weil der südländisch gesprochen
hat, also serbokroatisch. Aber woher er kommt, das hat mich nicht interessiert. Niemanden hat
das interessiert, damals.“
Aber auch eine Zeitzeugin, die später im slowenischen Verein Lastovka organisiert war,
erinnerte sich mit einer gewissen Wehmut an den Jugoslawischen Club:
„Also Club der Jugoslawen, da waren ursprünglich alle Nationalitäten drin, natürlich war es überwiegend mehr serbisch oder kroatisch, mehr serbisch, aber wir haben uns trotzdem dort immer
gut gefühlt, immer wohlgefühlt, weil man eben das Gefühl hatte, man ist eben zu Hause.“224
Es ist alles andere als ausgeschlossen, dass in Ingolstadt nicht nur anfänglich ein gesamtjugoslawischer Zusammenhalt bestand. Auf der Ebene des Betriebs musste er ohnehin gewährleistet sein, weil die Belegschaftsversammlungen für Arbeiter aus Jugoslawien in serbokroatischer Sprache stattfanden. Ein Teil der Delegationen aus Jugoslawien bestand aus slowenischen
und kroatischen Vertretern, manchmal erweitert um einen Repräsentanten des Bundesarbeitsamtes in Belgrad. Auch Protagonisten von Lastovka wie Zvone Kokalj und Lidija Kranjčan
waren als Angestellte der Caritas nicht nur für die Slowenen, sondern auch für andere Migranten aus Jugoslawien zuständig.225
224
Interview mit Lidija Kranjčan.
Archiv Betriebsrat, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat, Festakt „25 Jahre slowenische Arbeitnehmer bei
Audi“ – Rede des Betriebsratsvorsitzenden Adolf Hochrein, 14.9.1993.
225
59
IOS Mitteilung Nr. 66
Slowenische Vereine: Lastovka
Doch es kam zu einer Umgruppierung, der Meinungsverschiedenheiten über die spezifische
Bedeutung der slowenischen Sprache und Kultur zugrunde lagen. Bei mehreren Anlässen traten
Differenzen zwischen der Gruppe um Bogdan Pualić und einigen Gewerkschaftsangehörigen
auf, die sich für eine eigene slowenische Sektion des Clubs und für ein Zusammengehen mit
einem Teil der katholischen Gruppe einsetzten. Gemeinsam hofften sie wohl, von der Stadtverwaltung Zuschüsse für die Ausgestaltung des Vereinssitzes und kulturelle Veranstaltungen zu
erhalten. Die katholischen Vereinsbegründer waren vor allem durch das Fehlen geeigneter
Räumlichkeiten im unmittelbaren Umfeld der Mission motiviert.
Noch 1969 hatte die Zeitschrift Rodna gruda von Slowenien aus die Gründung immer neuer
Jugoslawischer Clubs enthusiastisch begrüßt.226 Die 1970er Jahre standen dann bundesweit im
Zeichen neuer slowenischer Vereinsgründungen: Den Anfang machte 1970 die Berliner Slovenska katoliška skupnost, die erste katholische Gruppe, die auf Distanz zu den konservativen
Exilpriestern ging. Es folgte Stuttgart ein Jahr später mit dem Slovensko kulturno-umetniško
društvo Triglav.227
Verstärkt wurde das slowenische Streben nach Eigenständigkeit im Einwanderungsland durch
die Diskussion über die neue föderative Verfassung Jugoslawiens, die 1974 verabschiedet wurde.228
In dem Maße, in dem in Jugoslawien selbst die Rechte der einzelnen Republiken gestärkt wurden,
waren auch deren Angehörige im Ausland nicht mehr bereit, sich von jugoslawistischen Generalkonsuln, Gewerkschaftsvertretern oder anderen Anhängern der Zentralregierung bevormunden zu
lassen. Auch wurden die Entscheidungskompetenzen über Zuschüsse für die Vereine dezentralisiert. Die vom Sozialistischen Bund im Dezember 1974 verabschiedeten Leitsätze zur Kulturarbeit
unter den Migranten waren schon ganz im Geiste der neuen Verfassung gehalten.229
226
‚V Nemčiji vedno več naših klubov‘ und ‚Jugoslovanski klub v Schwenningenu‘, in: RG, 6. 1969, S. 237f.
Siehe auch die Berichte über Clubs in München und Stuttgart in den beiden folgenden Heften.
227
Zur Gründung von Triglav in Stuttgart vgl. Metka Vrhunc, ,Odbordruštva ,Triglav‘ pričel z delom‘, in: RG, 3.
1971, S. 19. Der Verein verfügte über ein anspruchsvolles Kulturprogramm, Mitglieder wurden oft zu Veranstaltungen nach Slowenien eingeladen. 1973 zählte er nach Angaben aus dem Belgrader Arhiv Jugoslavije 300
ordentliche und hundert ,helfende‘ Mitglieder (Ivanović, „Nostalgija za prugom“, S. 146 und 152.; Republiški
sekretariat, Delavci, S. 12). Hier die weiteren Angaben zu Gründungen neuer Vereine: 1972 Frankfurt am Main
(Sava) und Essen (Bled), 1975 München (Triglav) und Hilden (Maribor). In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre
folgten neben Lastovka in Ingolstadt die Vereine in Burscheidt (France Prešeren) und Essen (Ljubljana – alle
1977) sowie Planika in Ravensburg (1978). Im letztgenannten Jahr eröffnete der bayerische Ministerpräsident
Alfons Goppel in der Jahrhunderthalle Frankfurt-Höchst das 6. Treffen der Slowenen in Westeuropa. (Drnovšek,
Slovenska kronika, S. 363; Štumberger, Slovenščina, S. 43–45.)
228
„Im Ergebnis erhielt Slowenien in der Verfassung von 1974 ein Maß an Autonomie verbrieft, wie es dieses seit
dem Interludium zwischen auseinander fallender Habsburger Monarchie und Gründung des ersten jugoslawischen
Staates nicht mehr besessen hatte.“ (Höpken, Slowenien, S. 106; vgl. Vodopivec, Anfänge, S. 438–440)
229
Ivanović, „Nostalgija za prugom“, S. 144; AS 537, 1149, 1285, Osnutek družbenega dogovora o nudenju
pomoči pri samoorganiziranju prirejanju kulturnih prireditev za naše delavce na začasnem delu v tujini, 9.12.1974.
60
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Auch suchten regionale Ämter, Gewerkschaften, Parteiinstanzen und Funktionäre des Sozialistischen Bundes in Murska Sobota nach Gelegenheiten, die neue Verfassung unter den Migranten bekannt zu machen. Wechselseitige Besuche in den jeweiligen Städten, die Teilnahme
slowenischer Funktionäre an den Belegschaftsversammlungen für Jugoslawen, die Besichtigungen der Arbeiterwohnheime bei Audi, all dies bot Anlässe, die Vorzüge der neuen Verfassung zu erläutern und sie zugleich im slowenischen Sinne zu interpretieren.230
Doch vollzog sich die Differenzierung des Vereinswesens in Ingolstadt nicht allein im Sinne
einer slowenischen Nationalisierung. Analysiert man die erhalten gebliebenen Daten der Meldekartei, so wird deutlich, dass um die Mitte der 1970er Jahre von den in Ingolstadt lebenden slowenischen Männern knapp zwei Drittel verheiratet waren, während etwas mehr als ein Drittel zunächst
ledig blieb. Sloweninnen waren in Ingolstadt demgegenüber fast immer verheiratet. Die nicht verheirateten Frauen gehörten zur Gruppe der weiblichen Fachkräfte, die auf eigene Verantwortung
nach Ingolstadt gekommen waren; jedenfalls decken sich die Zahlen für die beiden Gruppen.231
Für das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen ist maßgeblich, dass interethnische und
interkonfessionelle Mischehen – vor allem die zwischen Katholiken und Orthodoxen – eher die
Ausnahme bildeten, dass also in den 1970er Jahren Slowenen, wenn sie überhaupt heirateten,
meist eine slowenische Ehepartnerin wählten.232 Dies geschah zumeist durchaus noch in der
Perspektive einer gemeinsamen Rückkehr nach Slowenien. Auf die Betonung slowenischer Eigenständigkeit im Zusammenhang mit der Verfassungsdiskussion folgte auf Seiten slowenischer Familien der Wunsch, unter sich zu bleiben und die Freizeit nicht mehr mit den Junggesellen aus den Heimen verbringen. Auch die Namensgebung für den neuen Verein sollte nach
Angaben seines ersten Vorsitzenden Zvone Kokalj ‚die Rückkehr in die Nester an der Drau und
an der Mur’ repräsentieren.233
Es liegt nahe, dass die ledigen Männer in den Wohnheimen sich auch in Fragen der nationalen Orientierung anders verhielten als die Familien – ein Unterschied, der im Konflikt zwischen
dem Jugoslawischen Club und Lastovka deutlich wurde. Allerdings scheint die Differenz anfänglich auch stark genderspezifisch ausgetragen worden zu sein:
„Und es war ja so, in diesem jugoslawischen Club, das waren Männer, […] vor allem solche aus den
Wohnheimen und alles war männerdominiert. Und bei uns [d.h. bei Lastovka] waren junge Familien,
230
Archiv Betriebsrat, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat, Festakt „25 Jahre slowenische Arbeitnehmer bei
Audi“. Rede des Betriebstratsvorsitzenden Adolf Hochrein, 14.9.1993.
231
StA Ingolstadt, Melderegister. Solche Angaben gelten nur für den Zeitraum bis zum Abschluss der
Eintragungen auf der Karteikarte, der mit dem Übergang zur EDV einhergeht. Der Zeitraum umfasst allerdings
einige Jahre über den Anwerbestopp hinaus, reicht also bis in die Gründungszeit von Lastovka.
232
Im Melderegister finden sich fünf Ehen zwischen katholischen Slowenen und orthodoxen Frauen.
233
Zvone Kokalj, ,Lastovka –simbol nekega hrepenenja‛, Slovenski koledar 1980, S. 306–313, hier S. 312.
61
IOS Mitteilung Nr. 66
vor allem Frauen, und die waren unter der Selbstverwaltung groß geworden, das bedeutet Du bist in
die Arbeit gegangen, du hast die Familie versorgt und hast dich auch sonst nicht zurückgehalten, schon
selbständig und selbstbewusst deshalb auch, dass wir gearbeitet haben und verdient haben. Dann haben wir gesagt, wir lassen uns doch nicht von den Männern da herumkommandieren […].“234
Die subjektive Färbung dieser Meinungsäußerung steht außer Frage, aber die Kritik am Club
in Ingolstadt steht nicht ganz isoliert da. Nimmt man Klagen über den Jugoslawischen Club in
Mannheim hinzu, wie sie Ingrid Slavec zu Ohren kamen, dann wird man die Chiffre ‚männerdominiert‛ auch mit ‚laut‘ und ‚alkoholisiert‘ übersetzen müssen. Die Mannheimer Slowenen
fühlten sich im Club wenig ernst genommen und an den Rand gedrängt. Die Theateraufführungen slowenischer Kinder etwa wurden von Veranstaltungsteilnehmern aus anderen Teilrepubliken verspottet.235
Die Familien und insbesondere die Frauen erwarteten sich von dem Verein mehr Verständnis
für ihre eigenen Bedürfnisse. Allerdings wurde der Wunsch nach Trennung vom Jugoslawischen Club auch durch die entsprechenden Organe und Instanzen der Partei und des Sozialistischen Bundes in Murska Sobota mitgetragen. Unter den 21 im Jahre 1979 gewählten Vorstandsmitgliedern von Lastovka gab es immerhin fünf Frauen, zu Revisoren wurden zwei Männer und
eine Frau ernannt. Die Versammlungsleitung übernahm Erna Brumen, Präsidentin der Bezirkskonferenz des SZDL in Murska Sobota.236
Ein der Neugründung von Lastovka auch zugrunde liegender weiblicher Protagonismus,
der in den Äußerungen der Zeitzeugin durchscheint, speiste sich aus verschiedenen Quellen.
Schon in der Zwischenkriegszeit bestanden katholische, liberale und sozialistische Frauenverbände. Später hatten Frauen in der slowenischen Partisanenbewegung eine wichtige Rolle
gespielt.237
Das von der FVRJ erlassene Grundgesetz über die Ehe von 1946 schrieb unter anderem
die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Lebensgemeinschaft fest. Dazu zählte die
freie Wahl des Berufs durch den jeweiligen Ehepartner und die gemeinsame Verwaltung des
zusammen erwirtschafteten Vermögens. Auch im Hinblick auf die Erbschaft waren Mann und
234
29.9.1981 Besuch einer Parteidelegation aus Slowenien; Gespräche mit dem Betriebsrat, slowenischen Arbeitnehmern, Lastovka und dem Club der Jugoslawen in Ingolstadt.
235
Slavec, Slovenci v Mannheimu, S. 77f.
236
,Novine, obvestila, oglasi …‘, in: Lastovka, 11. 1979. S. 13f.
237
1942 durften Sloweninnen erstmals wählen, und zwar zunächst die Delegierten einiger regionaler Volksbefreiungsausschüsse. Die Exekutive der Befreiungsfront gewährte Männern und Frauen ab dem vollendeten
17. Lebensjahr das aktive und passive Wahlrecht. Die Entscheidung fiel am 11.9.1943. Vgl. Verginella, Frauengeschichte, S. 150. Zur Rolle der Volksbefreiungsausschüsse, Wörsdörfer, Krisenherd Adria, S. 522–524.
62
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Frau gleichberechtigt. Die Tatsache, dass Frauen zunehmend industrielle Arbeitsplätze übernahmen, förderte zwar einerseits die Gleichberechtigung, schuf aber auch Formen der Doppelbelastung, weil Männer sich längst nicht in demselben Maße an der Haus- und Erziehungsarbeit beteiligten.
Lange blieben Frauen auf den verschiedenen Ebenen der politischen Vertretung deutlich unterrepräsentiert: Der ersten, im Mai 1945 gebildeten slowenischen Nachkriegsregierung gehörten elf
Männer und eine Frau an, Vida Tomšič, Ministerin für Soziales. In der Leitung der Osvobodilna
fronta, die den Partisanenkrieg gegen die Besatzer geführt hatte, war sogar unter 28 Mitgliedern
nur eine Frau. Immerhin gewährten die ersten Nachkriegskabinette den Frauen soziale Rechte wie
den Mutterschutz, Kinderbetreuung, den Zugang zu Verhütungsmitteln, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sowie Arbeitsrechte.238
Bei aller legitimen Kritik an der titoistischen Variante der Frauenemanzipation förderte diese
doch immerhin eine Bereitschaft zur Teilnahme an der sozialen Umgestaltung, die sich auch
bei den Migrantinnen in Ingolstadt und anderswo wieder findet. Wer dem Verein beitrat, der
konnte sich auf der Seite des Fortschritts und der Emanzipation fühlen.
Frauen trugen mit kleinen literarischen Beiträgen zum Inhalt des Vereinsorgans Lastovka
maßgeblich bei. Dahinter verbarg sich eine nur aus wenigen Personen bestehende ‚Literatursektion‘ des Vereins, die von muttersprachlichen Lehrerin Olga Kerčmar ins Leben gerufen
wurde. Über sie wurden auch die Kinder in die Gestaltung des Vereinsblatts einbezogen.
Kerčmar ließ die Grund- und Hauptschüler kleine Aufsätze verfassen, in denen es u.a. um die
Sommer- und Weihnachtsferien, den ersten Schnee, den Besuch einer Schulklasse aus Murska
Sobota, die Reisen nach Jugoslawien, die Familie und die Schule ging. Das war eine alte
slowenische Tradition, denn schon die in Ljubljana erscheinenden und beiderseits des Atlantiks
verbreiteten Zeitschriften der Zwischenkriegszeit hatten Leserbriefe von Kindern aus der
Diaspora abgedruckt. In Ingolstadt reflektieren die Texte die Bemühungen der Familien und
der Lehrerin, den Kindern die slowenische Sprache nahezubringen. Bisweilen war der
Unterricht für die Kinder auch die erste Begegnung mit der Hochsprache, da zu Hause der
Dialekt des Murgebiets gesprochen wurde.239
238
Kaser, Familie und Verwandtschaft, S. 429; Verginella, Frauengeschichte, S. 151–153.
Interview mit Olga Kerčmar; Janja Kolenko, ,V slovenski šoli‘, Lastovka, 17. 1981, S. 9; Zvone Kokalj,
,Lastovka – simbol nekega hrepenenja‘, Slovenski koledar 1980, S. 306–313, hier S. 308
239
63
IOS Mitteilung Nr. 66
Die Festkultur von Lastovka ähnelte der des Clubs; allerdings beging man dort neben den
gesamtjugoslawischen auch einige slowenische Feste wie etwa das Kulturfest oder die Weinlese. Zu überwinden hatte der Lastovkavorstand vor allem große Schwierigkeiten mit dem jugoslawischen Generalkonsulat in München.240
Zur Verteidigung der eigenen Arbeit konnte er sich zwar auf offizielle Resolutionen berufen,
die das ‚gesellschaftliche Engagement der Frauen fördern‘ und der ‚Arbeit mit Jugendlichen
und Kindern‛ mehr Aufmerksamkeit widmen wollten.241 Beides gehörte zu den hauptsächlichen Aufgabenfeldern des Vereins. Aber das Konsulat übte schon in der Gründungsphase dahingehend Druck aus, dass Lastovka und der Jugoslawische Club den ‚Tag der Republik‛ gemeinsam begehen mögen. Letztlich feierten dann die Vereine in getrennten Räumen, liehen
sich aber wechselseitig einen Teil des Programms.242
Fortan koexistierte ein nach dem Geschlecht und dem Familienstand separierter, stark männlich geprägter Verein (Club der Jugoslawen) mit dem von slowenischen Familien unter maßgeblicher Beteiligung der Frauen gegründeten neuen Migrantenverein Lastovka. Die Ausdifferenzierung war zugleich geschlechtsspezifisch, sozial, national und kulturell; allerdings gehörten einzelne Vorstandsmitglieder von Lastovka im Dezember 1977 gleichzeitig auch der Leitung des Jugoslawischen Clubs an.243
Sozial überwog im Jugoslawischen Club ebenso wie bei Lastovka die Figur des Automobilarbeiters, der aber bei den ‚Schwalben‘ oft im Kreise seiner Familie auftrat. Keinesfalls überzubewerten ist die klassenspezifische Komponente im offiziellen Namen des Clubs: Dass dort der
Arbeitgeber und zugleich auch die ‚Arbeiteridentität‘ der Mitglieder beim Namen genannt werden, heißt im Vergleich zu Lastovka wenig. Denn auch in dem slowenischen Verein gaben neben
den Frauen Audi-Arbeiter den Ton an, die allesamt Gewerkschaftsmitglieder waren. Zudem
spielte beim Jugoslawischen Club die Firmenzugehörigkeit eine große Rolle, wie die Zusammenarbeit des Clubs mit Audi auf dem Feld der Freizeitgestaltung zeigte (Fußball, Geschicklichkeitsfahren.) Bedeutsamer war das Element der nationalen Differenzierung: Mit der Gründung von
Lastovka verblieben dauerhaft nur noch wenige Slowenen beim Jugoslawischen Club.
Dem Arbeiter im Wohnheim fiel das Festhalten an einem gesamtjugoslawischen Verein
leichter als der jungen Familie, die sich stärker an Slowenien orientierte und die Städtepartnerschaft zwischen Ingolstadt und Murska Sobota begrüßte. Der ledige slowenische Automobilarbeiter unterschied sich in seinem Freizeitverhalten kaum von seinem kroatischen, serbischen
240
Interview mit Lidija Kranjčan.
Auszug aus dem Bulletin Nr. 11 vom November 1976.
242
AS 537, šk. 1170, 1349, Zvone Kokalj [Lastovka] an Republiška konferenca SZDL Ljubljana [Pogačnik],
22.11.1977.
243
Ebd., šk 1174, 1362, Občinska konferenca SZDL Murska Sobota an RK SZDL Slovenije Ljubljana, 19.12.1977.
241
64
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
oder makedonischen Kollegen; die sprachliche Verständigung war ohnehin kein großes Problem. Die Familie war demgegenüber mit der Frage befasst, ob und wie sie die slowenische
Sprache und Kultur an die nächste Generation weitergeben mochte (Kurse, muttersprachlicher
Schulunterricht, Reisen nach Slowenien).
Im Übrigen bestand zwischen beiden Vereinen anfänglich kein absoluter Gegensatz: Das
Besuchsprogramm einer slowenischen Delegation galt am 8. März 1978 durchaus noch einer
gemeinsamen Veranstaltung von Lastovka und Jugoslawischem Club.244
Die Vereine verstanden sich als politisch neutral. Positiv nahmen sie auf die jugoslawische
Föderation bzw. im Falle Lastovkas zusätzlich auf die slowenische Teilrepublik Bezug. Auf
den ersten Blick lassen sich keine bedeutenden Unterschiede im Verhältnis beider Vereine zur
deutschen Mehrheitsgesellschaft erkennen. Als Mitglieder waren laut Statut beim Jugoslawischen Club ebenso wie bei Lastovka auch Deutsche zugelassen. Der Kontakt zur AudiWerksleitung und zum Betriebsrat war für beide Vereine gleich wichtig, die Kommune
Ingolstadt spielte vielleicht für Lastovka eine etwas größere Rolle als für den Club, was
wiederum mit den besonderen Beziehungen zwischen Ingolstadt und Murska Sobota, das heißt
also mit der sich anbahnenden Städtepartnerschaft zu tun hat.
Das weitere Schicksal der beiden Vereine verdient einige Überlegungen. Was wurde aus
dem Jugoslawischen Club, nachdem Lastovka begonnen hatte, die Masse der Slowenen zu organisieren? Offenbar blieb er als Verein der anderen nationalen Gruppen erhalten und zog unter
den Slowenen, wenn überhaupt dann vor allem Heimbewohner, also unverheiratete Männer,
an. Über ein Jahrzehnt bestanden Lastovka und der Club als alternative Möglichkeiten der Freizeitorganisation. Mit dem Zerfall des Landes, dessen Namen er trug, zerfiel der Club in seine
einzelnen nationalen Bestandteile. „Jetzt haben alle eigene Vereine, die Serben, die Makedonier, die Kroaten und die Slowenen haben […] Lastovka. Zum damaligen Zeitpunkt gab’s nur
um Pualić herum diesen Jugoslawischen Club und uns als Lastovka.“245
244
Koledar predvidenih gostovanj, S. 2.
Interview mit Marija Schmidt. Die Internet-Seite ,Stadt Ingolstadt – Kultur & Freizeit‘ nennt folgende Migrantenvereine: Club ,Makedonija‘ e.V., Club der Jugoslawen ,Sveti Sava‘; HKZ Croatia kroatische Kulturgemeinschaft
e.V.; Slowenischer Kulturverein Lastovka e.V. Daneben erscheinen auch der Freundschaftsverein Ingolstadt-Kragujevac, der sich um die Pflege der Beziehungen zur serbischen Partnerstadt bemüht, und die Slowenische Mission
Ingolstadt (http://www2.ingolstadtr.de/index.pthml?ofs_1=15&NavID=1842.11&mNavID=1842... Letzter Zugriff
6.2.2012.)
245
65
IOS Mitteilung Nr. 66
‚Väterchen Frost‛ oder ‚Sankt Nikolaus‛?: Lastovka vs. Slowenische
Katholische Mission
Zvone Kokalj, der als eigentlicher Begründer des neuen Vereins gelten muss, schrieb in einer Broschüre zum zehnten Jahrestag der Vereinsgründung: „Lastovka ‚startete‛ am 22. Oktober 1977 im
großen Saal des Gewerkschaftshauses, der an jenem Tag sogar zu klein war.“246 Der Verein entstand aus einer Fusion zwischen Teilen der katholischen Kirchengemeinde und solchen Slowenen,
die in der Gewerkschaftsbewegung engagiert waren.247 Die Konkurrenz zum Jugoslawischen Club
erwies sich auf die Dauer gesehen als nicht so gravierend, wie man anfänglich hätte annehmen
können. Denn beide Vereine sprachen unterschiedliche Teile der jugoslawischen Einwohnerschaft
von Ingolstadt an. Problematischer waren die Beziehungen zwischen Lastovka und der Slowenischen Mission um den streng antikommunistisch eingestellten Priester Vili Stegu. Stegu, der noch
an einer Gründungssitzung des Vereins teilgenommen und dem ersten Vorstand angehört hatte, war
nicht bereit, die Zusammenarbeit zwischen Lastovka und der slowenischen Stadtverwaltung von
Murska Sobota zu tolerieren. Die von der Mur anreisenden Slowenen – Kommunalpolitiker, Funktionäre des Sozialistischen Bundes oder Gewerkschafter – blieben für Stegu und seine Anhänger
Repräsentanten des ‚gottlosen und kirchenfeindlichen Kommunismus.‘ 248
Tatsächlich war Lastovka – anders als die Exilpriester – nicht antijugoslawisch in dem Sinne,
dass der Verein es an der gebotenen Loyalität der jugoslawischen Föderation gegenüber hätte missen lassen. Genügen mag hier der Hinweis auf die Beteiligung des Vereins am Tito-Kult: Bei Lastovka-Festen wurden ganz ähnlich wie bei denen des Jugoslawischen Clubs Bilder Josip Broz-Titos
gezeigt. Aus Anlass seines Todes erschien im Mai 1980 eine Sondernummer des Vereinsorgans
‚Lastovka‛. Das Vereinsblatt brachte noch Jahre nach Titos Ableben regelmäßig Gedenkartikel zu
seinem Todestag. Kinder wurden als ‚Pioniere‛ und ‚Pionierinnen‛ bezeichnet und angehalten,
kleine Artikel über den ‚Genossen Tito‛ zu verfassen.249 Ein Mädchen berichtete nach der Rückkehr
aus dem Urlaub in Murska Sobota: „Mitten in der Stadt steht ein großes Denkmal. Es erinnert an
den Volksbefreiungskampf und an einen großen Kämpfer – Genossen Tito.“250
246
Lastovka Ingolstadt e.V. Slovensko kulturno prosvetno društvo, 10 let / Slowenischer Kultur- u. Bildungsverein, 10 let – 10 Jahre, Murska Sobota o.J. [1987]
247
AS 537, sk. 1170, 1349, Zapisnik II. seje upravnega odbora Slovenskega kulturno-prosvetnega društva
,Lastovka‛ v Ingolstadtu.
248
Zapisnik II. seje upravnega odbora slovenskega kulturno-prosvetnega drustva „Lastovka“ v Ingolstadtu, AS
537, sk. 1170, 1349. Schon einen Monat nach der Gründung von Lastovka hatte der Sozialistische Bund aus
Murska Sobota die Schirmherrschaft über den Verein angenommen (Vgl. Republiški sekretariat, Delavci, S. 29.
Siehe auch Vili Stegu, ,Razmišljanje ob slovenskem kulturnem prazniku‛, Lastovka, 2. 1978, S. 1–4.)
249
Zvone Kokalj, Zvesti veliki prisegi, ebd., 22. 1982; ders., Tito živi z nami, ebd., 30. 1984; Ders., Štiri desetletja
pod svobodnim soncem, ebd., 34.1985. Zur Heranziehung von Schülern beiderlei Geschlechts als ,Pioniere‛ auch
Winterhagen, Transnationaler Katholizismus, S. 99.
250
Kotiček za male lastovke, Lastovka, 19. 1981, S.9.
66
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Die kulturelle und sprachliche Orientierung war jedoch entschieden slowenisch, und darüber
hinaus seit 1979 auf die Partnerschaft zwischen Ingolstadt und Murska Sobota ausgerichtet.
Möglich wurde ein solches national geprägtes Vorpreschen der Slowenen im Ausland wiederum durch die neue jugoslawische Verfassung. Der Jugoslawismus von Lastovka war ähnlich
wie die jugoslawische Orientierung der slowenischen Kommunisten von den Ideen Ivan
Cankars beeinflusst, der sich stets gegen die Bevormundung einer südslawischen Kultur durch
eine andere eingesetzt hatte. Letztlich handelte es sich aber nicht so sehr um einen ethnisch
geprägten Nationalgedanken, wie er etwa von Naša luč und der konservativ-katholischen Strömung verfochten wurde. Im Vordergrund stand vielmehr eine durchaus auch verfassungspatriotisch beeinflusste Orientierung am Wohl der slowenischen Teilrepublik, die sich in der Anteilnahme an Geschehnissen in der engeren Heimat, also vor allem im Pomurje/Prekmurje, konkretisierte.
Für die konservativen slowenischen Katholiken in Ingolstadt war es inakzeptabel, dass Slowenen aus dem Umfeld der Katholischen Mission mit slowenischen Stadt- oder Regionalverwaltungen zusammenarbeiteten. Das galt auch dann, wenn diese längst in einem engen Kontakt zu
den deutschen Parteien oder zur Stadtregierung von Ingolstadt standen. Vor allem formulierte
Lastovka eine Alternative zu jener programmatischen Option, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts oft eine Grundlage für erfolgreiche slowenische Vereinsgründungen gewesen war: die Möglichkeit, slowenische Nation und konservativen Katholizismus miteinander zu identifizieren.
Eine jedes Jahr von Neuem im Dezember wiederkehrende Konsequenz des neuen Weges
war es auch, dass der katholische ‚Heilige Nikolaus‛ die Lastovka-Kinder in der staatssozialistischen Version eines ‚Väterchens Frost‛ bescherte, ohne dass die jungen Familien daran Anstoß genommen hätten.251
Olga Kerčmar, die lange Zeit für den slowenischen muttersprachlichen Unterricht
verantwortlich war, weist auf einen Parallelfall gespaltener Festkultur der Slowenen und
insbesondere der Sloweninnen in Ingolstadt hin. Anders als im Falle von ‚St. Nikolaus‛ und
‚Väterchen Frost‛ feierten die Frauen ihr Fest an unterschiedlichen Daten: Während sie bei
Lastovka den 8. März als Internationalen Frauentag in der sozialistisch-feministischen
Tradition Clara Zetkins begingen, feierte die Gruppe um die Slowenische Mission im Mai den
Muttertag.252
251
‚Siva kučma, bela brada, topelkožuh, zvrhankoš…‘ und ‚Prva prireditev v novih druženih prostorih
Lastovke‘, in: Lastovka, 11. 1979, S. 15 bzw. 21. 1982, S. 7 und S. 13. Die Slowenischen Mission Ingolstadt
feierte demgegenüber weiter das traditionelle Nikolausfest (‚Severna Bavarska‘ und ‚Ingolstadt‘, NL, Nr. 2,
1980, S. 26f.bzw. 1, 1983, S. 27f.) Ähnliches gilt für die Missionen in München oder Stuttgart. Vgl. Slovenska
župnija, Slovenska sobotna šola, S. 40f.; Šket/Turk, Slovenci, S. 87–90.
252
Interview mit Olga Kerčmar.
67
IOS Mitteilung Nr. 66
Der slowenische Antikommunismus der Domobranci-Tradition und der Exilkirche um Bischof Rožman geriet in Ingolstadt in die Isolation.253 Zwar fehlen genaue Zahlenangaben zum
Kräfteverhältnis zwischen Lastovka und der katholischen Gruppe um Pfarrer Stegu, aber die
hohe Publizität, die die Feste und Kulturveranstaltungen von Lastovka genossen, fand keine
exakte Entsprechung bei den Initiativen der Katholischen Mission. Das Missverständnis begann
dort, wo die traditionalistische Strömung im Exil und im Lande selbst „Slowenien auf dem Weg
der Entchristlichung“ sah und der titoistischen Führung einseitig die Verantwortung dafür zuweisen wollte.254 Unberücksichtigt blieb dabei, dass sich die Beziehungen zwischen Jugoslawien und dem Vatikan gewandelt hatten, was nicht ohne Folgen auf den Katholizismus des
slowenischen Exils geblieben war.255
Die Tendenz zur Liberalisierung in der Kirchenpolitik warf für katholische Migranten die
Frage auf, ob die intransigent-klerikale Opposition gegen Staat und Partei so noch zeitgemäß
sei. Insgesamt schien vielen ein Beharren auf dem traditionellen Antikommunismus in Zeiten
der ‚neuen Ostpolitik‛ und der globalen Entspannung kontraproduktiv. Auch war unter den slowenischen Priestern im Ausland ein Differenzierungsprozess eingetreten. Nach einem Urteil
aus Kreisen der ZKS distanzierten sich die älteren noch von der ‚Selbstorganisation der Arbeiter
in Vereinen‛, während die jüngeren dem Vereinswesen gegenüber aufgeschlossen waren.256
Noch 1966 hieß es in einem Bericht des Oberseelsorgeamtes München:
„Die Gastarbeiter aus Jugoslawien sind nicht allesamt Kommunisten, wie oft behauptet wird. Im
Gegenteil, die große Mehrheit will vom Kommunismus nichts hören, sie wollen nur möglichst
viel und schnell verdienen, um dann nach Hause zu kehren. Nur ein verschwindend kleiner Teil
sind Parteimitglieder, die jedoch versuchen, über ihre Arbeitskollegen zu wachen und sie vor
unliebsamen Kontakten mit den slowenischen Priestern zu ‚behüten‘.“257
Zehn Jahre später hatte sich das Bild insofern gewandelt, als mit dem Anwerbeabkommen
Tausende junger Slowenen nach Deutschland gelangten, die unter den Bedingungen des Selbstverwaltungssozialismus aufgewachsen waren.
253
Peter Schnell, ‚Zum Geleit‹, in: Lastovka Ingolstadt e.V., a.a.O.
Rafko Lešnik, ‚Slovenija na poti razkristjanjevanja‘ und ‚Razkristanjevanja v Sloveniji‘, in: NL, Nr. 9, 1973
bzw. ebd., Nr. 9, 1977, S. 7f. Die Zahl der Teilnehmer an den sonntäglichen Messen ging in Slowenien zwischen
1968 und 1978 von 32% auf 20% zurück. In Ljubljana wurden in den 1970er Jahren rund 15% aller Neugeborenen
nicht getauft (Vodopivc, Anfänge, S. 442.)
255
Vgl. den slowenischen Standpunkt in Grgič, Odnosi. Die Position der konservativen Exilpriester reflektieren
die Texte ‚Vatikan in Jugoslavija‘, in: NL, 7. 1966; ‚Vera in Cerkev v Sloveniji‘, ebd., 7. 1967, S. 4–6.
256
Poročilo o delu koordinacijskega odbora za vprašanje naših delavcev na začasnem delu v tujini za leto 1977,
AS 537, šk 1045, 1005.
257
Bericht, 1966, S. 8f.
254
68
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Aus alledem erwuchs eine Konstellation, die den Beziehungen zwischen Don Camillo und
Peppone im fiktiven oberitalienischen Dorf glich, mit einem Unterschied: Hinter dem slowenischen ‚Peppone‘ stand die sozialistische Staatsmacht, hinter ‚Don Camillo‘ die immer noch gut
organisierte Exilkirche. Kritisch, wenn auch nicht gerade dramatisch, war die Situation in Ingolstadt, wo eine sonst nirgends in Deutschland aufgetretene Zusammenballung slowenischer
Arbeiter die Aufmerksamkeit der heimischen Behörden auf sich zog. Als dann der Verein
Lastovka im Einverständnis mit den kommunalen und regionalen Autoritäten in Slowenien
selbst gegründet wurde, ergab sich daraus für die katholischen Vereinsmitglieder eine schwierige Situation.
Man kann den Kompromiss- und Übergangscharakter von Vereinen wie Lastovka in Ingolstadt nicht genug betonen; es handelte sich um slowenische Initiativen, die auf eine tatkräftige Unterstützung von Seiten der Behörden in der Teilrepublik selbst, insbesondere derjenigen in Murska Sobota, auf die Hilfe der Ingolstädter Stadtverwaltung und auf eine denkbar breite Zustimmung der slowenischen Arbeiterinnen und Arbeiter rechnen konnte. Diese
stimmten zwar, so weit sie bei Audi arbeiteten, weiterhin für den Motor des Clubs der Jugoslawen, Bogdan Pualić, wenn er als Kandidat der IG Metall bei den Betriebsratswahlen antrat.
Aber sie waren nicht mehr bereit, ihm zu folgen, wenn es um die Gestaltung ihrer Freizeit
ging.
Auf die Frage, was denn im Zentrum des Vereinslebens von Lastovka stand, antwortete ein
langjähriges Mitglied:
„Die slowenische Sprache, also unsere Kultur aufzubewahren. Und natürlich können Schule und
Verein nichts dazu tun, dass die Kinder ihre Muttersprache beherrschen. Das ist eine Aufgabe der
Eltern. Und wenn ich vom Verein spreche, von unseren Kollegen, wir haben alle mit unseren
Kindern zu Hause Slowenisch gesprochen. Und sogar die Enkelkinder, die sprechen auch noch
Slowenisch, unsere Kinder und deren Kinder, und das war uns das Wichtigste. Dass die Kinder
die slowenische Sprache beherrschen und nicht vergessen, wo die Wurzeln sind, also das war uns
sehr viel wert. Deswegen haben wir sehr viel Zeit investiert, dass die Kinder spüren, wo die Wurzeln sind. Also für mich – das muss jeder für sich selbst wissen – für mich wäre das unvorstellbar,
wenn mein Kind nach Slowenien käme und könnte die Sprache nicht sprechen.“258
Es stellt sich dennoch die Frage, ob nicht Teile der Lastovka-Mitgliedschaft auch von diesem
Verein vor allem ausgleichende und entspannende Aktivitäten für Fabrikarbeiter favorisierten.
Mit dem Unterschied, dass die Initiatoren des Vereins darauf achteten, die stärker am Erhalt
und an der Verbreitung slowenischer Kultur orientierten Veranstaltungen nicht einseitig der
258
Interview mit Ladislava Kokalj.
69
IOS Mitteilung Nr. 66
‚leichteren‘ Betätigung im Sinne von Sport und Spiel gegenüberzustellen. Auf einigen Feldern,
beispielsweise auf dem der Folkloregruppen und -abende, begegneten sich die verschiedenen
Teilgebiete ohnehin.
Lastovka blieb lange Zeit ein wichtiges Kommunikationszentrum für Slowenen im mittelbayerischen Donauraum, das auch bei bundesweiten Anlässen regelmäßig Präsenz zeigte.
Große Aufmerksamkeit zog beispielsweise die Folkloregruppe auf sich, die in Ingolstadt selbst
und bei den Folkloriade-Festivals der Slowenen in verschiedenen deutschen Städten auftrat.
„Wir haben ja auch eine Folkloregruppe gehabt, und diese Folkloregruppe von den jungen Leuten,
die ist zum Beispiel dann auch bei den Deutschen aufgetreten. Wir haben hier in Ingolstadt das
Bürgerfest, früher jedes Jahr, jetzt alle zwei Jahre, wo sie dann auftreten, und wir haben auch ‚Die
Welt ist bunt‛ für Ausländer, für alle ausländischen Vereine ist so eine Veranstaltung im Juli, wo
man dann auch erstens mit diesen Nationaltänzen auftritt und auch eigene Spezialitäten tanzt.
Aber es gab bundesweite Treffen von den slowenischen Vereinen: Augsburg, Frankfurt, Berlin …
und Nürnberg, … wo sie waren.“
Seit Ende der 1970er Jahre war Lastovka einer der rührigsten Slowenenvereine bundesweit;
man warb mit der eigenen hohen Mitgliederzahl, dem anspruchsvollen Kulturprogramm und
letztlich auch mit den Sprachkursen. Da bewusst nicht nur Angehörige der slowenischen Gemeinschaft angesprochen wurden, sondern auch alteingesessene Ingolstädter, war es möglich,
auf den Festen und Kulturveranstaltungen von Lastovka auch letztere zu treffen.
Neben dem Vereinschor entstanden noch diverse Schach-, Tennis- und Jugendsektionen.
Aber es gelang Lastovka nach viel versprechenden Anfängen nicht, sich zu konsolidieren.
Trotz unbestreitbarer Erfolge litt der Verein unter den Querelen zwischen seinem Vorsitzenden und der Slowenischen Mission. Der in einem anderen Zusammenhang erfolgte Rückzug
Zvone Kokaljs kostete die ‚Schwalben‘ einen großen Teil ihres Schwungs, mit dem sie gestartet waren. Zu den Feldern, auf denen Lastovka-Mitglieder sich weiterhin betätigten, zählten die Initiativen im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Ingolstadt und Murska
Sobota.
70
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Städtepartnerschaft
Geschäftliche Kontakte bestanden zunächst zwischen Textilbetrieben in beiden Städten, doch
wäre es wohl dabei geblieben, wenn Auto Union nicht im Herbst 1968 mit der Rekrutierung
slowenischer Arbeitskräfte begonnen hätte. Zwar hatte der Automobilhersteller auch vorher
schon Geschäftsbeziehungen nach Jugoslawien geknüpft, doch ging es hier immer nur um die
Vergabe von Lizenzen zum Bau von DKW-Modellen.259
War die Anwerbung durch Auto Union und einige andere Betriebe zunächst durchaus noch
so erfolgt, dass ‚Gastarbeiter‛ beiderlei Geschlechts im Zweifelsfalle als Konjunkturpuffer benutzt werden konnten, so ergab sich schon relativ früh die zusätzliche Möglichkeit einer Verdichtung der Kontakte zwischen Ingolstadt und Murska Sobota. Die Audi-Werksleitung legte
Wert auf die Präsenz einer „sozio-kulturell einigermaßen homogenen Gruppe“ unter ihren Arbeitern. Wollte Audi die Rekrutierung von Arbeitskräften aus derselben Region verstetigen,
dann musste es darauf ankommen, den Ruf des eigenen Betriebs und Ingolstadts als Migrationsziel in der Bevölkerung des Prekmurje oder Pomurje dauerhaft positiv zu verankern. Die
Automobilfirma unterstrich dies, indem sie die engen Beziehungen zwischen den Stadtverwaltungen und Gewerkschaftsorganisationen beider Zentren förderte. Wie sich u.a. den Materialien
des Betriebsrats entnehmen lässt, war es für Audi durchaus von Vorteil, wenn deutsche Gewerkschafter beim Besuch in Murska Sobota die Politik der Werksleitung verteidigten, einmal
ganz abgesehen von der Konsolidierung der Kontakte auf dem Wege der Städtepartnerschaft.260
Das Prekmurje bot sich als überschaubare Region mit eigener Geschichte und eigenen Wanderungstraditionen, man sprach dort einen besonderen slowenischen Dialekt und lebte ansonsten in einer ethnischen Vielfalt, von der man an der Donau allerdings zunächst wenig Notiz
nahm. Die zwischen dem Prekmurje und dem mittelbayerischen Donauraum über die Städtepartnerschaft hergestellte Nähe war geeignet, einen Teil des aufreibenden Gegensatzes zwischen ‚Heimat‘ und ‚Fremde‘ aufzuheben; die Problematik der Entwurzelung sollte auf diese
Weise wo immer möglich gemildert werden.
Die erste Einladung an eine slowenische Delegation erging für den Monat November 1969
durch Oberbürgermeister Otto Stinglwagner. Adressat war das Stadtoberhaupt von Murska
Sobota, Präsident Boris Goljevšček. Er sollte Gelegenheit erhalten, „den Betrieb und die zweite
Heimat, wo so viele Bürger seiner Gemeinde arbeiten“, direkt kennen zu lernen.261 Im Juni
1971 erfolgte der erste Gegenbesuch einer Abordnung des Stadtrats von Ingolstadt. „Während
259
‚Vor Status der Partnerschaft‘, DK, 8.11.1978; Schlemmer, Industriemoderne, S. 333f.
Ebd., S. 290.
261
Ingolstadt plant, 1966–1971, S. 131.
260
71
IOS Mitteilung Nr. 66
eines hochinteressanten Aufenthaltes lernten die von herzlicher Gastfreundschaft umhegten Ingolstädter ein mit fruchtbarem Boden und heilkräftigen Thermalquellen gesegnetes Land kennen. In gut geführten und mit modernen Maschinen ausgestatteten Textilfabriken überzeugten
sie sich von dem großen Fleiß der Slowenen.“262
Es ist schwer zu unterscheiden, wie viel an solchen Berichten die tatsächliche Überzeugung
des Verfassers wiedergab und wie viel Teil einer diplomatischen Rhetorik bildete, auf die sich
beide Seiten, die slowenische und die deutsche, verstanden und verständigten. Den „großen
Fleiß“ der Slowenen kennen wir jetzt immerhin schon über etliche Jahrzehnte hinweg, was den
Schluss erlauben sollte, dass er nicht frei erfunden sein kann.
Was Ingolstadt angeht, so bestand bei der Förderung des Austauschs mit Murska Sobota
weitgehende Einhelligkeit zwischen den beiden großen im Stadtrat vertretenen Parteien. Zwar
war die SPD unter Oberbürgermeister Otto Stinglwagner 263 vorangegangen, weil bei ihren Mitgliedern zum kommunalen Impetus auch das besondere Interesse an der Arbeitswelt und am
jugoslawischen Selbstverwaltungsmodell hinzukam. Doch auch die CSU hatte sich nach anfänglichem Zögern auf das Projekt eingelassen, von dem alle zu gewinnen hofften.264
Seit Beginn der Städtefreundschaft 1969 stand alljährlich ein Jugendaustausch zwischen Ingolstadt und Murska Sobota auf dem Programm; es kam zu wechselseitigen Besuchen von Delegationen aus den unterschiedlichsten Bereichen; darunter waren auch die Vertretungen der
Partnerstädte auf diversen Messen und Ausstellungen. Murska Sobota war 1978 erstmals auf
der Mittelbayerischen Ausstellung (Miba) vertreten. Insbesondere die an der Mur (slow. Mura)
ansässige und nach dem Fluss benannte Textilfirma Mura-Moden legte Wert darauf, ihre Produkte dort einem deutschen Publikum zu präsentieren; zusätzlich sollten in Ingolstadt Folkloregruppen auftreten und slowenische Spezialitäten angeboten werden.265
Umgekehrt war im Jahr 1980 eine Ingolstädter Delegation mit Exponaten auf der Landwirtschaftsmesse in Gornja Radgona vertreten; im Donaukurier war von „Jugoslawiens größter Landwirtschaftsmesse“ die Rede.266 Im Zusammenhang mit der Miba stand auch die Entscheidung über
eine offizielle Städtepartnerschaft an, die im Stadtrat von der SPD bereits beantragt worden war.
262
Ebd.
Otto Stinglwagner war als Kandidat einer von der SPD unterstützten Wahlgemeinschaft 1958 zum Landrat gewählt
worden (Schlemmer, Industriemoderne, S. 159.) 1966 gewann er dann als sozialdemokratischer Kandidat für des Amt
des Oberbürgermeisters mit 54 % der Stimmen schon im ersten Wahlgang gegen den Kandidaten der CSU (ebd., S. 156.)
264
Anfang 1979 kam es zu einer Verzögerung im Annäherungsprozess, denn in der CSU gab es Stadträte, die „den
Jugoslawen wegen der Nicht-Auslieferung von vier deutschen Terroristen einen Denkzettel verpassen“ wollten.
(‚Partnerschaftsvertrag kommt doch noch unter Dach und Fach‘, DK, 23.1.1979)
265
‚Vor Status der Partnerschaft‘, DK, 8.11.1978.
266
Insgesamt 13 Firmen aus dem Umland Ingolstadts zeigten Arzneimittel, Textilien, Schuhe, Elektroerzeugnisse,
landwirtschaftliche Geräte, Armaturen, Desinfektionsmittel, Werkzeuge und Autos (‚Ingolstadt bei Jugoslawiens
263
72
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre schaltete sich auf slowenischer Seite auch der SZDL
in die Diskussion um die Städtepartnerschaft ein. Der Sozialistische Bund war vor allem für die
Beziehungen zu den Migrantenvereinen in Ingolstadt und anderen bayerischen Zentren zuständig. Zugleich war der SZDL die breiteste Bündnis- und Frontorganisation der jugoslawischen
Kommunisten; sein Engagement sollte signalisieren, dass die Unterstützung der Migranten von
einem denkbar breiten gesellschaftlichen Konsens getragen war.267
Das Interesse der Gäste von der Mur machte im Einzelfall auch nicht vor innerbetrieblichen
Problemfeldern Halt; einen Anlass zum Besuch des Bürgermeisters Karel Sukić aus Murska
Sobota bot die Belegschaftsversammlung bei Audi. In Ingolstadt traf sich Sukić mit OB Peter
Schnell, der betonte, dass die Arbeitsplätze der Slowenen durch den Aufschwung bei Audi sicherer geworden seien.268
Bis 1972 war Ingolstadt nur Partnerschaften mit Städten eingegangen, die in EWGund/oder NATO-Ländern lagen; insofern waren die Beziehungen nach Murska Sobota ein
absolutes Novum.269 Nach der Wahl von 1972 war der CSU ein Gutteil der Verantwortung
für die weiteren Verhandlungen um die Partnerschaft zugefallen, wobei SPD-Mitglieder die
Beziehungen nach Murska Sobota zu einem großen Teil kritisch begleiteten oder auch aktiv
mittrugen. Das politische System Jugoslawiens gab den Vertretern beider Parteien einige
Rätsel auf. „Besonders aufschlussreich“, heißt es zum ersten Ingolstädter Gegenbesuch an
der Mur, „waren aber die begleitenden Gespräche über die von den übrigen östlichen Ländern abweichenden Wege, die Jugoslawien eingeschlagen hat, um politisch und wirtschaftlich seine eigenen Ziele zu verfolgen.“ Ein Sozialdemokrat zeigte sich 1979 „überrascht
von der relativ schwachen Stellung der Kommunistischen Partei, beeindruckt vom
jugoslawischen Selbstverwaltungsmodell und erstaunt über das sogenannte
‚Rotationsprinzip‛, wonach kein Kommunalpolitiker länger als zwei Wahlperioden im Amt
bleiben darf.“270
größter Landwirtschaftsmesse‘, DK 19.8.1980; Peter Schnell an Karel Sukić, 21.6.1979, StA Ingolstadt,
Städtepartnerschaft Murska Sobota (bis 1994).
267
AS 537, šk 1174, 1362 Republiška Konferenca SZDL Slovenije, Svet za mednarodne odnose, Informacija o
rezultatih vprašalnika o organiziranosti za obravnavanje mednarodnih odnosov v občinah (undatiert).
268
Archiv Betriebsrat, Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat, Festakt „25 Jahre slowenische Arbeitnehmer bei
Audi“ – Rede des Betriebsratsvorsitzenden Adolf Hochrein, 14.9.1993; ‚Als Stadt noch Profil gewonnen‘, DK
20.10.1977. Peter Schnell, ein seit 1966 der CSU angehörender Jurist, hatte am 11. Juni 1972 den SPDGegenkandidaten mit 58,6 gegen 41,4% besiegt; zugleich hatte die SPD auch ihre Mehrheit im Stadtparlament
verloren (vgl. Schlemmer, Industriemoderne, S. 333f.)
269
Weitere Partnerstädte Ingolstadts waren: Grasse (F), Carrara (I), Kirkcaldy (Schottland). Vgl. ‚Vor Status der
Partnerschaft‘, DK, 8.11.1978.
270
‚Murska und die Freundschaft machen Fortschritte‘, ebd. 17.7.1979
73
IOS Mitteilung Nr. 66
Das System der Arbeiterselbstverwaltung erläuterte der Donaukurier am Beispiel des
Mura-Textilunternehmens. Die 4.000 Mitarbeiter des Staatsbetriebs nähten Herrenkonfektion, Damenkonfektion, Kindertextilien und Herrenwäsche; 1978 lag der Umsatz bei umgerechnet etwa 1,3 Milliarden DM, bei jährlichen Steigerungsraten von bis zu sieben Prozent.
Auf dem Weltmarkt durchaus konkurrenzfähige Mura-Konfektion wurde nach Europa, Afrika
und Nordamerika exportiert; Anfang der 1980er Jahre gingen 86% des Exports in die Bundesrepublik Deutschland.271
Die Berichterstattung über die Prinzipien der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung, wie
sie vom slowenischen Parteitheoretiker und Tito-Vertrauten Edvard Kardelj entworfen und in
ganz Jugoslawien praktiziert wurden, war erstaunlich nüchtern und objektiv. Die im Donaukurier-Titel angedeutete Selbstbestimmung der Arbeiter über die eigenen Löhne finde ihre
Schranken beim Markt. Da die Arbeiter am Risiko des Unternehmens beteiligt seien, könne der
Lohn in schlechten Jahren durchaus sinken, obwohl das Land zurzeit eine Inflationsrate von 25
Prozent aufweise. Tröstlich seien wiederum die Nachrichten über das niedrige Preisniveau im
Prekmurje; es lasse die mageren Löhne leichter ertragen. Eine Zuschneiderin verdiene bei Mura
800 Mark netto monatlich, eine Bandarbeiterin im besseren Falle 750 Mark. Aber eine normale
Zweizimmerwohnung koste auch nur etwa 80 Mark Miete.272
Im März 1979 war es dann so weit: Im Rathaus von Ingolstadt tauschten Peter Schnell und
Karel Sukić die Patenschaftsurkunden aus und versprachen einander die weitere Pflege der 1968
aufgenommenen „freundschaftlichen Kontakte“.273 OB Schnell bescheinigte den slowenischen
Migranten in Ingolstadt bei dieser Gelegenheit, sie seien nicht nur „tüchtige Arbeiter“, sondern
auch „engagierte Mitbürger.“ Dann stellt er das Miteinander durch Städtepartnerschaften ganz
unerwartet den Verhandlungen zur Rüstungsbegrenzung gegenüber, als ob Ersteres eine
Alternative zu Letzteren darstellen könnte.274
Vier Monate später kehrte Schnell bereits wieder von einer „anstrengenden Reise“ in die
Partnerstadt zurück, begleitet von einer gemischten Delegation aus Dezernenten und Stadträten
der beiden großen Parteien. Im Zentrum der Gespräche hatten Themen des Austauschs unter
Jugendlichen, Gewerkschaften, Sportvereinen – sowie allgemeiner – der Tourismus gestanden.
OB Schnell zeigte sich positiv beeindruckt von Fortschritten auf den Feldern des Wohnungsbaus
und der Stadtbildpflege. „Übereinstimmend, ob von CSU- oder SPD-Seite, hoben die Ingolstädter
271
Werner, Murska Sobota, S. 30.
‚Arbeiter bestimmen die eigenen Löhne‘, DK 25.10.1979.
273
Werner, Murska Sobota, S. 94. An der Zeremonie nahmen die Stadtoberhäupter der übrigen drei damaligen
Partnerstädte Ingolstadts teil. – Peter Schnell, ein seit 1966 der CSU angehörender Jurist, hatte am 11. Juni 1972
den SPD-Gegenkandidaten mit 58,6 gegen 41,4% besiegt; zugleich hatte die SPD auch ihre Mehrheit im
Stadtparlament verloren (vgl. Schlemmer, Industriemoderne, S. 333f.)
274
‚Ein Beitrag für Frieden und Freundschaft in Europa‘, ebd. 31.3./1.4.1979.
272
74
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Emissäre die Herzlichkeit und Gastfreundschaft hervor, mit der sie in Murska Sobota empfangen
worden sind.“275
Im Sommer des ersten Partnerschaftsjahres fuhren 20 Kinder aus Ingolstadt nach Murska
Sobota und von dort aus weiter an die kroatische Adriaküste; wenig später kam es zum
Gegenbesuch von 20 jungen Slowenen.276
Ähnlich wie die Beziehungen zwischen den Gewerkschaftern in Ingolstadt und Murska
Sobota erhielten auch Kontakte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen durch die
Städtepartnerschaft Auftrieb. Für eine Reihe von Jahren sah es so aus, als ob es über die
Systemgrenze hinweg gelingen könnte, auch die mittelbayerische Wirtschaft mit derjenigen des
Pomurje zu verflechten.
275
276
‚Murska und die Freundschaft machen Fortschritte‘, DK 17.7.1979.
‚20 Kinder können kostenlos in Jugoslawien Urlaub machen‘, ebd. 5.7.1979.
75
IOS Mitteilung Nr. 66
„Ach, ich bleibe jetzt noch ein bisschen …“: Überlegungen zur Dauer
des Aufenthalts
Die slowenischen Interviewpartner in Ingolstadt sind sich weitgehend einig in der Antwort auf
die Frage, wie lange sie anfänglich hätten in Deutschland bleiben wollen. Einmal angekommen,
planten alle eine zeitliche Begrenzung ihres Aufenthalts von einem Minimum, das bei einem
Jahr lag, bis zu einem Maximum von zwei bis drei Jahren.277
Da Auto Union bzw. Audi NSU zunächst auch nur Jahresverträge gewährte, deckte sich der
Unternehmerstandpunkt hier weitgehend mit den Vorstellungen vieler Migranten. Es stellte
sich schon bald heraus, dass der ins Auge gefasste Zeitpunkt für eine Rückkehr den meisten zu
nahe lag. Sei es, dass die Aussicht auf einen auch nur annähernd gleichwertigen Arbeitsplatz in
Slowenien gering war, sei es, dass noch längst nicht alle Konsumwünsche erfüllt waren, der
Aufbruch in Richtung Süden wurde immer wieder aufgeschoben.278
Da Audi und einige andere Unternehmen am Verbleib der meisten slowenischen Arbeiterinnen und Arbeiter interessiert waren, konnten viele von ihnen problemlos mehrfach eine Verlängerung des Aufenthalts an der Donau erwirken. Die individuellen oder familiären Rechtfertigungsstrategien ähnelten einander zumeist; einige wenige Unterschiede gab es vor allem bei
den selbst gesetzten Fristen.279
Manch einer verschob die Rückkehr von einem Jahr auf das nächste, andere dachten in größeren Zeitabschnitten. Eine Interviewpartnerin brachte den jeweiligen Aufschub mit den jugoslawischen Fünfjahresplänen in Verbindung, begann also selbst, in den Kategorien der wirtschaftlichen Entwicklung Südslawiens zu denken.280 Die ursprüngliche Absicht, bald zurückzukehren, machte sich bei der Partnerwahl bemerkbar. Wer dem Herkunftsland gewogen und
verbunden blieb, der heiratete zumeist einen Slowenen bzw. eine Slowenin, damit sich auch
eine mögliche Remigration ohne Konflikte gemeinsam meistern ließ.281
Allerdings reichten die fortbestehenden Bindungen an den Herkunftsort und seine Bewohner
nur selten aus, um eine Migrantenfamilie zur baldigen Rückkehr zu motivieren.
277
Interviews in Ingolstadt (Slavko Cafuta, Ladislava Kokalj, Lidija Kranjčan, Marija Schmid.) Siehe auch LukšičHacin, Migracijske politike, S. 54.
278
Interviews mit Marija Schmid. Im Bekanntenkreis von Frau Schmid gab es einige Ingolstadt-Migranten aus
dem Prekmurje, die sich nach ihrer Rückkehr selbständig machten und eine Kfz.-Werkstatt, einen Reifenbetrieb
oder eine Malerwerkstatt gründeten. Demgegenüber gab es lange Zeit niemanden, der einen akzeptablen Arbeitsplatz gefunden hätte.
279
„Jeder, der von uns hierher gekommen ist, hat gesagt, nur für ein paar Jahre. Und aus diesen paar Jahren sind
Jahrzehnte geworden. Das hätten wir uns nie gedacht, nie!“ (Interview mit Ladislava Kokalj.)
280
Interview mit Marija Schmid.
281
Interview mit Lidija Kranjčan.
76
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
„Also nach meinen Erfahrungen und nach dem, was ich bei meiner Mutter erlebt habe, geht das
immer von Jahr zu Jahr, etwa so: ‚Ach, ein Jahr bleibe ich noch … Und dann habe ich mir das
angeschafft und dann das. Ach, ich bleibe jetzt noch ein bisschen, noch ein Jahr …‛ Und dann
kam der Zeitpunkt, wo der richtige Tag oder das richtige Jahr verpasst wurden und die Rückkehr
unmöglich wurde, weil man dann den Anschluss in der Heimat verlor.“282
Die Antwort auf die Frage, wie man sich den Verlust des Anschlusses an die Herkunftsregion vorzustellen hat, ist an der ursprünglichen Perspektive einer Rückkehr nach ein bis zwei
Jahren zu messen. Migranten mussten zunächst einmal überprüfen, ob sie dort beruflich und
familiär wieder anknüpfen konnten, wo sich die Bindungen durch den Umzug gelockert hatten.
Bisweilen traten unvorhergesehene Ereignisse ein, die eine Rückkehr erzwangen. Ein Slowene,
von dessen früher Remigration wir aus dem Bericht eines anderen erfahren, konnte nicht in
Ingolstadt bleiben, weil seine in Slowenien lebende Frau das dritte Kind erwartete und mit der
Situation überfordert war. Von anderen Arbeitern hören wir, dass sie schon „nach einem Jahr
aus Heimweh oder wegen familiärer Geschichten zurückgegangen sind.283
Schließlich gab es noch Migranten, die der Situation am Arbeitsplatz in Ingolstadt nicht gewachsen waren. Manchen wurde der Arbeitsvertrag nach einem Jahr nicht verlängert, so dass
auch sie die Rückkehr ins Herkunftsland vorzogen. Andere erfuhren insofern eine Art sozialen
Abstiegs, als sie die begehrten Stellen in der Auto- und Metallindustrie gegen weniger beliebte
und schlechter bezahlte Arbeitsplätze in der Baubranche oder in der Gastronomie eintauschen
mussten. Die Automobilindustrie und das Arbeitsamt verbuchten solche Fälle unter den sogenannten ‚Fluktuationsverlusten‛. Bis zu einem gewissen Grade waren solche ‚Verluste‛ von den
Werksleitungen einkalkuliert: Die Metallunternehmen in Mittelbayern waren schnell versucht,
mehr Arbeitskräfte anzuwerben als sie tatsächlich auf Dauer benötigten; denn es bestand immer
das Risiko einer unerwarteten Rückkehr oder eben auch einer Arbeitsleistung, die sich nicht
mit den Erwartungen der Firma deckte. 284
Zwei Jahre nach dem Anwerbestopp gingen aus Slowenien noch 1.200 Personen auf Arbeitssuche ins Ausland, allerdings die überwiegende Mehrheit nach Österreich. Zugleich kehrten etwa
2.000 nach Slowenien zurück. Vor allem die Arbeiter aus dem Pomurje taten sich schwer mit der
Rückkehr, weil Arbeitsplätze im Nordosten Sloweniens noch immer sehr rar waren.285
282
Ebd.
Interview mit Marija Schmid.
284
BHStA München, Akten der Staatskanzlei, Nr. 142784, Der Arbeitsmarkt in Südbayern. Bericht über die Entwicklung
des Arbeitsmarktes und die Tätigkeit der Arbeitsämter im Landesarbeitsamtsbezirk Südbayern, Juli 1969, S. 21f.
285
Vrnitev v domovino, NL 7. 1975, S. 24.
283
77
IOS Mitteilung Nr. 66
Was die Mehrheit der ‚Ingolstädter Slowenen‘ angeht, so verdienen auch die zunächst unerfüllt gebliebenen Konsumwünsche Aufmerksamkeit, denn sie wurden für den Aufschub (mit-)
verantwortlich gemacht. Anders als Vladimir Bonač in seiner Skizze zum Strukturwandel der
jugoslawischen Familie 1960 noch vermutete, ging das „Bedürfnis nach Besitz“ in den
folgenden fünfzehn Jahren nicht zurück, sondern es nahm zu.286 Die Wünsche waren zum einen
Teil individueller Natur und zum anderen auf die Familie und den Hof ausgerichtet. Am Anfang
standen bisweilen das private Automobil und der „schöne Anzug“; die Landwirte unter den
Migranten wollten auf keinen Fall auf die Anschaffung eines Traktors verzichten.287
Der Wunsch nach dem eigenen Traktor traf sich mit einem landesweiten Trend zur Mechanisierung der Landwirtschaft. Die Anzahl der Traktoren war in Jugoslawien zwischen 1960 und
1969 von 32.000 auf 65.000 gestiegen, was gemessen an der Situation in den westlichen Industrieländern noch ziemlich wenig war. 288
Solange die Beziehungen zum Herkunftsort eng blieben, verbreitete sich unter den jungen
Familien auch der Wunsch, ein Haus in Slowenien zu errichten, um für eine mögliche Rückkehr
gerüstet zu sein.289 All dies schrieb sich ein in die Konsumkonjunktur Jugoslawiens im Verlauf
der 1970er Jahre. Für das Haus gab es günstige Kredite, den ersten Wagen kaufte man gebraucht, und es dauerte eine ganze Weile, ehe der ‚Ingolstädter Slowene‛ sich einen kostspieligen Audi leisten konnte. Die Automobilisierung der slowenischen Teilrepublik stieg zwischen
1964 und 1975 um mehr als 600% an, von etwas über 43.000 im Jahre 1964 auf über 260.000
im Jahre 1975. Die Neuwagen stammten zumeist aus der Zastava-Autofabrik in Kragujevac
(Serbien); es handelte sich um in Lizenz hergestellte Fiat-Modelle.290
Daneben zählten langlebige Konsumgüter zu den begehrtesten Produkten; die industrielle
Massenproduktion lief insbesondere bei den Haushaltsgeräten auf Hochtouren; allein der
slowenische Marktführer Gorenje lieferte 1968 „täglich mehr als 500 Waschmaschinen, 1.000
Herde und 1.500 Kühlschränke“.291
Božo Repes Befund lautet, es habe in Slowenien damals eine „ungewöhnliche kulturelle Atmosphäre“ geherrscht, weil die Menschen gleichzeitig „an Tito, an die Selbstverwaltung und
286
Bonač, Strukturwandel, S. 426.
Interview mit Marija Schmid.
288
Hoffmann, Agriculture, S. 262.
289
Ebd., auch Interviews mit Ladislava Kokalj und Slavko Cafuta.
290
Vodopivec, Anfänge, S. 443. Siehe auch die Fotos unter der Überschrift „Življenje v 70. letih“, in: Drnovšek
(Hg.), Slovenska kronika, S. 370f. Kragujevac wurde später ebenfalls Partnerstadt von Ingolstadt.
291
Münnich, Mangel, S. 115.
287
78
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Blockfreiheit, aber auch an Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernsehapparate und andere Fetische der Konsumgesellschaft“ glaubten.292 Dieser Synkretismus fand seinen Platz auch im Migrantengepäck; ein Zeitzeuge in Ingolstadt betonte – vielleicht nicht ganz ohne Übertreibung –
dass seine Ansprüche im Verlauf der Jahre gewachsen seien („immer längeren Urlaub, immer
bessere Hotels, immer bessere Autos“.) Er nannte Elemente eines angeblichen ‚Luxuskonsums‛,
die allerdings für deutsche Verhältnisse durchaus noch im Bereich des für die Zeiten des Wirtschaftswunders Üblichen lagen. „Wenn ich jetzt nach Slowenien gegangen wäre, dann hätte ich
das gleich vergessen können. Diese Grand Hotels und immer auf Luxus, weil ich ja in Maribor
gelebt habe.“293 Mit dem letzten Nebensatz wollte er andeuten, dass er – anders als viele aus
Prekmurje stammende Arbeitskollegen – ein quasi-großstädtisches Konsumniveau gewohnt war.
Maribor, die zweitgrößte Stadt Sloweniens, und Ingolstadt, das in Bayern auf Platz 6 rangierte,
lagen von der Bevölkerungszahl her ungefähr gleichauf. Also durfte es auch nicht verwundern,
dass jemand, der vorher lange an der Drau gelebt hatte, ähnliche Ansprüche an den
Lebensstandard formulierte wie der durchschnittliche Ingolstädter.
Manchmal handelte es sich auch eher darum, in der Heimat Konsumgewohnheiten
vorzuspiegeln, die überhaupt nicht dem alltäglichen Lebensniveau in Ingolstadt entsprachen.
„Da hat man die Verwandten eingeladen und Geschenke mitgebracht.“294 Insgesamt war den
Slowenen der westliche Lebensstandard auch unabhängig von ihrer Migrationserfahrung geläufig; denn viele befanden sich in der privilegierten Situation, relativ nahe bei den Konsumzentren Italiens und Österreichs (Triest, Graz) zu leben und entsprechend oft zu den inzwischen
schon von der Historiographie beschriebenen Einkaufsfahrten zu starten.295
Eine eher geringe Rolle bei der Entscheidung über den Verbleib in Ingolstadt bzw. die Rückkehr nach Slowenien spielte für die slowenischen Paare der Umzug in eine Neubauwohnung.
Mitte der 1970er Jahre, als viele neue Kernfamilien solche Wohnungen bezogen, war die Frage
nach einer Rückkehr bei den meisten noch in der Schwebe. Selbst die Vereinsgründungen (Jugoslawischer Club, Lastovka) können nicht als Anzeichen für den Durchbruch einer ‚Dableiber‘Mentalität unter den Migranten gewertet werden. Eher trifft das Gegenteil zu: Je mehr jemand
davon überzeugt war, dass er bald nach Slowenien zurückkehren werde, desto größer war sein
292
Repe, Slowenische Geschichte, S. 141.
Interview mit Slavko Cafuta.
294
Interview mit Marija Schmid 2.
295
In den 1970er Jahren gelangten zwischen 3 und 3,5 Millionen slowenische Grenzgänger nach Triest; im
Durchschnitt hielten sich am Tag „zwischen 20.000 und 25.000 Einkaufstouristen aus Jugoslawien in der Stadt“
auf (Nećak, Triest, S. 340.)
293
79
IOS Mitteilung Nr. 66
Bedürfnis, die Bindungen an die Herkunftsregion so eng wie möglich zu gestalten (Urlaub, Sprache, kulturelle Orientierung.) Später wirkte sich dann die wirtschaftliche Krisensituation Jugoslawiens sehr negativ auf die Rückkehrbereitschaft aus.296
296
80
Interview mit Marija Schmid 2.
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
„Mal hier – mal unten“: Wochenend-Pendelverkehr und Remigration
Der Wochenend-Pendelverkehr aus Ingolstadt (aber auch aus München, Augsburg oder Nürnberg) war ein Faktum, das die Gastarbeitermigration nach Bayern grundsätzlich von anderen
Wanderbewegungen abhob. Nicht zuletzt die Möglichkeit, zwischen Freitag und Montag nach
Slowenien zu pendeln, machte aus Ingolstadt ein attraktives Migrationsziel. Sprichwörtlich waren auf den Migrantentreffen die 600 Kilometer, die das bayerische Industriezentrum ‚nur‛ vom
Herkunftsort in Slowenien trennten. Migranten aus anderen Teilen der Bundesrepublik, auch
aus dem Ruhrgebiet, zogen deshalb an die Donau um.297
Der Pendelverkehr funktionierte vor allem deshalb weitgehend reibungslos, weil er sich in
das bei Audi vorherrschende Schichtsystem einfügte:
„Die machen für gewöhnlich Nachtschicht“, erklärt Pfarrer Gajšek. „Und am Samstag in der
Frühe, wenn sie von der Arbeit kommen, fahren sie nach Slowenien. Am Montag, wenn sie zurückkommen, fangen sie wieder an zu arbeiten. […]. Ich kenne jemanden, der fährt wirklich jedes
Wochenende, nur einmal in 16 Jahren ist er nicht gefahren.“298
Manchmal lebte auch das Elternpaar im Ausland, während die Kinder bei den Großeltern in
Slowenien wohnten. Im Bezirk Murska Sobota gab es 1972 rund 1.000 Kinder im Vorschulalter
und 1.700 schulpflichtige Kinder, die ohne ein Elternteil oder sogar ohne beide Eltern lebten.299
In diesem und in ähnlichen Fällen pflegten die Automobilarbeiter und andere Ingolstädter
Slowenen wie die Bergleute des Kaiserreichs eine halb-ländliche Lebensweise, mit dem Unterschied, dass die urbane und die rurale Welt nicht mehr – wie noch im Ruhrgebiet um 1900 –
unmittelbar benachbart, sondern auf zwei Länder verteilt waren. Das galt auch, wenn die Kinder
in Ingolstadt blieben, die Großeltern dagegen Slowenien nicht verließen.
„Man muss also auch sehen, dass dann die alte Generation zu Hause alleine war und dann ist man
eben am Wochenende hin gefahren und hat das Land beackert oder gesät […]. Also man hat dann
die Arbeiten unten erledigt und dann ist man wieder hinaufgefahren.“300
297
„Aber die Gruppe ist auch größer geworden dadurch, weil diejenigen, die anderswo in Deutschland gearbeitet
haben – damals gab es noch fast überall im August diese Betriebsferien – dann hat man sich in der Heimat getroffen
und dann hat man gehört ‚Ach das ist ja nur 600 km von zu Hause‘ […]. Auf alle Fälle, wo ein Nest ist und wo so
viele sind, da kamen auch Leute aus anderen Städten nach Ingolstadt. Sie kamen mit den Familien, denn das war
ja nur, Audi hat später auch neue Leute aus Slowenien beschäftigt, aber nicht Angeworbene.“ (Interview mit Maria
Schmid und Lidija Kranjčan.)
298
Interview mit Stanislav Gajšek.
299
AS 1589 IV CK ZKS, šk 1832, 012 1974, Zapisnik 9. seje komiteja občinske konference ZKS Murska Sobota
(29.5.1974).
300
Interview mit Marija Schmid.
81
IOS Mitteilung Nr. 66
Die für viele Migranten charakteristische Präsenz in zwei Gesellschaften war auch für viele
‚Ingolstädter Slowenen‘ ständige Realität. Unter den am häufigsten wiederkehrenden Themen,
die slowenische Schulkinder in Aufsatzform für die Ingolstädter ‚Lastovka‘ bearbeiteten, war der
Besuch beim Großvater während der Sommerferien. Dort auf dem Lande – so schrieben sie – gab
es viele Nutz- und Haustiere, von denen einige, vor allem Hasen und Katzen, sogar den Kindern
selbst gehörten.301
Unterdessen wurden die Wochenendfahrten auch für die Erwachsenen Teil einer existenziellen Dimension, an die man sich später noch mit durchaus gemischten Gefühlen erinnerte. Wer
kein eigenes Auto besaß, der wählte auch für die Heimfahrten am Wochenende den Reisebus.
Ein in der Personalabteilung von Audi arbeitender, des Serbokroatischen mächtiger Volksdeutscher stellte den Kontakt zu den Busunternehmen her. Diese witterten in den regelmäßigen
Wochenendfahrten der Migranten ein gutes Geschäft und ließen sich ihrerseits auf den Rhythmus der Schichten bei Audi ein:
„So wurde das dann auch organisiert, dass der Bus freitags um 15.00 Uhr, also am Ende der
Frühschicht, runter fuhr nach Murska Sobota und auch nach Varaždin in Kroatien. […]. Der Bus
kam dann Sonntag in der Nacht in umgekehrter Richtung zurück, und zwar so, dass er montags
um 14.30 zur Spätschicht wieder da war. Sie hatten so das ganze Wochenende, d.h. sie waren am
späten Freitagabend zu Hause und sind Sonntag in der Nacht wieder zurück gefahren.“
Noch 1984 warb ein Busunternehmen aus Nürnberg im Vereinsblatt Lastovka mit einer
günstigen Verbindung von Ingolstadt über Maribor und Ptuj nach Varaždin und Zagreb.302 Erst
mit dem Umsteigen auf das eigene Auto erübrigte sich die organisierte Fahrt, obgleich sich für
den wochenendlichen Transfer auch Fahrgemeinschaften bildeten.303
Bis zum Jahr 1973 kann man vielleicht noch von einem provisorischen Status sprechen, der
auch solche Reisen einschloss. Mit dem Ende der Anwerbung immer neuer Arbeiter aber
machte sich eine neue Logik unter den in Ingolstadt verbliebenen Migranten breit:
„1974 gab es bei Audi einen Sozialplan, wo es Abfindungen gab. Und diejenigen, die dann gesagt
haben ‚Ich bleib ja sowieso nicht lang‘, das waren dann die ersten, die das Geld genommen haben
und heruntergegangen sind. Und in jeder Situation, in der in der Automobilindustrie eine Krise
eintrat, hat Audi wieder Sozialpläne gemacht und dann sind die nächsten gegangen. Und so hat
301
Kotiček za male Lastovke, Lastovka, 19. 1981, S. 8.
‚Redna autobusna linija iz Ingolstadta za Jugoslavijo‘, Lastovka, 30. 1984, S. 15.
303
‚Naši v Ingolstadtu. Strah pred ovojnico‘, Delo, 31.7.1974. Gespräche mit Stanislav Gajšek, Marija Schmid
und Lidija Kranjčan.
302
82
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
sich die Zahl verringert und jetzt ist – ich weiß nicht wie viele aus der ersten Generation, weil wir
ja auch die zweite und die dritte Generation haben.“ […]
„Dann ist eigentlich die Zeit stehen geblieben. Einzelne sind zurück nach Slowenien gegangen.
Die haben so geplant: Wenn die Kinder reif für die Schule sind, dann können wir zurückgehen.
Aber getan haben das nur wenige. Allerdings sind einige Frauen mit den Kindern nach Slowenien
zurückgegangen. Und die Männer haben weiter hier gearbeitet. Bis heute.“
Aus dieser Situation ergab sich nahezu zwingend das Phänomen des Pendelverkehrs, der
nicht unbedingt für jeden gleich alle Wochenenden ausfüllen musste. Doch es blieb nicht
allein bei dieser Pendelbewegung. Da die meisten von ihnen inzwischen in Slowenien Wohneigentum besaßen, konnten sich zumindest die Rentner unter den Migranten der ersten Generation immer wieder relativ kurzfristig entscheiden, ob sie eine bestimmte Jahreszeit, eine
Gruppe von Feiertagen, den Jahreswechsel u.a. lieber in Ingolstadt oder in Slowenien verbringen wollten. Oft genug lebte die Verwandtschaft an zwei Orten – in Bayern und im
Prekmurje – so dass ein Zusammenhalt nur gewährleistet war, wenn man an beiden Orten
regelmäßig Präsenz zeigte:
„Viele sind auch so, die haben unten ein Haus und hier, Kinder sind da, Enkelkinder sind da, und
die sagen, solange das gesundheitlich geht, werden wir pendeln. Dann sind sie einen Monat unten
und einen Monat hier. Und dann, wenn es nicht mehr geht, dann muss man eine Entscheidung
treffen. Entweder bleib ich immer unten, was für mich günstiger ist, oder ich bleibe hier.“304
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre organisierte der Sozialistische Bund des Pomurje
sommerliche Treffen in der Bäderstadt Moravske Toplice, die für alle in der Herkunftsregion
ihren Urlaub verbringenden Ingolstädter Slowenen leicht erreichbar war. Es bestand also die
Möglichkeit, auch in der Nähe des Herkunftsorts wieder mit Freunden und Kolleginnen aus
Ingolstadt zusammen zu sein.305
Manchmal entsprach das in den 1970er oder frühen 1980er Jahren mit dem ersten Geld gebaute Haus schon bald nicht mehr den Ansprüchen, die man an eine dauerhafte Bleibe stellte.
„Das, was man damals gebaut hat, ist auch ganz anders als das, was man jetzt als Standard hat.
Manche kehren wieder zurück, aber die meisten, die dort unten gebaut haben, die pendeln. Die
sind zwei, drei Wochen hier, und dann sind sie wieder unten, das ist eigentlich so das Schicksal
unserer Generation.“306
304
Interview mit Ladislava Kolkalj.
‚Vsi v Pomurje!‘, Lastovka, 23. 1982.
306
Interview mit Marija Schmid.
305
83
IOS Mitteilung Nr. 66
Es fällt auf, dass sich manche Interviewpartner als Angehörige einer bestimmten Migrantengeneration empfinden und problemlos über deren Stimmungslage berichten können. Dies gilt
auch für die Frage, ob das Pendeln ein Ausdruck der Tatsache war, dass jemand viele Möglichkeiten hatte und dann auch damit zufrieden war, oder ob es doch eher ein Ausdruck der Unzufriedenheit war, weil Migranten am Ende doch nirgends ‚richtig‘ lebten. Oder galt womöglich
gar beides? Die Antworten der Zeitzeugen oszillieren zwischen beiden Polen.
„Ich bin schon zufrieden damit, wie es ist. Mal hier, mal unten. Meine Frau wollte runter gehen
für immer, aber ich nicht. Ich habe mal gesagt, solange ich Autofahren kann, bleiben wir hier.“307
„Teils-teils, […] unten ist es jetzt für uns auch nicht leicht. Wir sind hier Ausländer und jetzt
unten auch. Also es ist nicht so, dass sie unsere Leute jetzt mit offenen Armen aufnehmen würden.
Die sagen, wo ihr bislang wart, da bleibt auch.“308
Um die Frage nach einer möglichen Weiter- oder Rückwanderung konnte es ernsthafte Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern einer Familie geben. Es muss nicht wirklich
erstaunen, dass zeitweise oder ganz heimkehrende ‚Gastarbeiter‘ in Slowenien mit Anfeindungen zu kämpfen hatten.
„Das war so tragisch eigentlich für unsere Generation. Wir haben doch immer gesagt: ‚Wir gehen
zurück, wir gehen zurück‛ und keiner wollte uns unten haben.“ 309
Auf die Frage, welche Gefühle dabei eine Rolle spielten, ob etwa der Neid und die Missgunst
gegenüber dem ökonomisch besser gestellten (Re-) Migranten darunter seien, antwortete eine
Zeitzeugin:
„Also ja. Für uns ist das schmerzhaft, weil wir niemandem etwas weggenommen haben, im Gegenteil. Wir haben doch dort die Arbeitsplätze gelassen, wir sind ins Ausland […]. Und als der
Krieg war, ich weiß ganz genau, was wir hier gesammelt haben. Obwohl ja in Slowenien zum
Glück fast nichts kaputtgegangen ist. Aber die Familien, die betroffen waren, was wir an Geldspenden runtergeschickt haben, und ganze Lastwagen mit Material heruntergefahren und also
Hilfe geleistet ohne Ende. Und am Schluss kriegst du keinen Dank.“310
Nach Ansicht eines weiteren Zeitzeugen hatten die Remigranten es sich selbst zuzuschreiben,
wenn es ihnen schwer fiel, in Slowenien wieder Fuß zu fassen. Viele von ihnen hätten nämlich
das neue Haus nicht in ihrem Geburtsort, sondern in der nächstgelegenen größeren Stadt errichtet.
307
Interview mit Slavko Cafuta.
Interview mit Ladislava Kokalj.
309
Interview mit Marija Schmid.
310
Interview mit Ladislava Kolkalj.
308
84
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
„Es war auch so mit dem Hausbau, die die jung waren, die haben gebaut und gebaut und keinen
Urlaub gehabt, weil sie jeden Urlaub auf dem Bau arbeiten mussten. Jetzt ist alles fertig, jetzt sind
sie alt und haben kein Interesse ... Und das schlimmste ist, viele Kollegen die ich kenne, nicht nur
in Pomurje, sondern auch in Dolenjsko, Gorenjsko und so, die kommen aus den Dörfern, mit
Weinbergen […], aber das Haus haben sie in der Stadt gebaut, jetzt hat er keine Freunde in der
Stadt, in der Nachbarschaft. Er hat ein Luxushaus, die anderen haben ganz normale Häuser, ein
schönes Auto, jeden Monat oder jedes Jahr ein anderes Auto, die sind dann ein wenig eifersüchtig
unten. Da sagt dann der Kollege: ‚Ja wenn ich jetzt mein Haus nehmen und in meinen Geburtsort
tragen könnte, dann würde ich das sofort machen.‛“311
311
Interview mit Slafko Cafuta.
85
IOS Mitteilung Nr. 66
Finis Jugoslaviae
Anfang der 1990er Jahre stieg der Anteil der Anhänger einer Eigenstaatlichkeit unter den Slowenen. Zwar gab es auch Zusammenhänge mit den Wanderbewegungen und insbesondere mit den
Organisationen des politischen Exils, aber wenig deutet auf ein Einwirken von Slowenen aus
Deutschland hin. Traten bei Umfragen im Januar 1990 nur 11,1% der Befragten in Slowenien für
die Unabhängigkeit von Jugoslawien ein, so waren es im Dezember desselben Jahres schon 52,3%.
In demselben Zeitraum fiel die Zahl der Befürworter eines Verbleibs in der jugoslawischen Föderation von 15,2 auf 5,3%, die der Befürworter einer konföderativen Lösung von 50,2 auf 32,5%.312
Im Juni 1991 überschlugen sich die Ereignisse: Nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens vom 26. Juni waren auf dem Weg zur österreichischen Grenze Panzer der Jugoslawischen
Volksarmee auf Murska Sobota zugerollt; Flugzeuge kreisten über der Stadt. In Gornja Radgona hatten slowenische Jugendliche den Konvoi der Volksarmee mit Molotov-Cocktails angegriffen; die Grenzstation nach Österreich war von Panzern zerstört worden. Erst im letzten
Moment hatte eine Ingolstädter Delegation die Partnerstadt, deren Kasernen noch in der Hand
der jugoslawischen Streitkräfte waren, in Richtung Norden verlassen können.313
Das Eingreifen der Volksarmee traf auf unerwarteten Widerstand in verschiedenen Teilen Sloweniens; unter dem Druck der EU wurde am 4. Juli ein Waffenstillstand erreicht, der Unabhängigkeitsprozess für drei Monate ausgesetzt. Da in Kroatien mit seiner starken serbischen Minderheit Konflikte viel größeren Ausmaßes anstanden, beschloss das jugoslawische Präsidium Mitte
Juli den Rückzug der Jugoslawischen Volksarmee aus Slowenien binnen dreier Monate.314
Der Krieg und die slowenische Eigenstaatlichkeit trugen nicht dazu bei, dass in einem ersten
Moment mehr Migranten aus Ingolstadt nach Slowenien zurückgekehrt wären. Die meisten
fürchteten erst recht Umstellungsprobleme, die nicht kleiner wurden, nachdem sie einmal zwanzig Jahre im Ausland verbracht hatten.
„Als dann dieser Krieg war, obwohl Slowenien selbständig geworden ist, da waren wir 40–45
Jahre alt, da brauchst Du unten nicht mehr nach einer Perspektive suchen. Und so sind eigentlich
die Leute, die damals da waren, bis zur Rente geblieben. Da sind die wenigsten – die die vorher
gegangen sind, ja – aber nachdem Slowenien einmal selbständig geworden war, da sind alle geblieben, bis sie in Rente gegangen sind. Weil man einfach vom Alter her und von dem ganzen
Umbruch her, den es dort gab, auch keine Chance mehr gehabt hat.“
312
Alle Zahlen nach: Bernik u.a., Slovenian Political Culture, S. 77.
Weitere Einzelheiten in ‚Panzerschüsse krachen vor Murska Sobota‘, DK, 29.6.1991; ‚Gespannte Ruhe in
Murska Sobota‘, DK 1.7.91; Ciocchi, Giorni, S. 108f.
314
Vodopivec, Anfänge nationalen Erwchens, S. 499f; ders, Slowenien, S. 37.
313
86
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Es war also nicht die Eigenstaatlichkeit als solche, die Slowenen zur Remigration veranlasst
hätte. So bedeutend war der Einschnitt nun auch wieder nicht, kein Vergleich jedenfalls zur
Gründung der polnischen Republik 1918, die etwa ein Drittel der Ruhrpolen zur Rückkehr in
ein Land veranlasste, das vorher preußisch und jetzt polnisch war.
Für Slowenien galt das auch in dieser Form nicht: Slowenien war seit 1945 slowenisch,
wenn auch im Bunde mit anderen Teilrepubliken und unter der Last einer eher ungeliebten
Bundeshauptstadt.
Was die Ingolstädter Slowenen betrifft, zu groß schien vielen das Risiko, in der gewandelten
Situation zu Hause erst recht nicht mehr Fuß fassen zu können.
Andererseits warf die slowenische Eigenstaatlichkeit angesichts der ohnenhin schon recht
engen Beziehungen nach Murska Sobota in Ingolstadt keine großen Probleme auf, die mit dem
Regime- und Systemwechsel in unmittelbarem Zusammenhang gestanden hätten.
87
IOS Mitteilung Nr. 66
Fazit
Die Geschichte der Slowenen in Bayern nach 1945 entwickelt sich entlang unterschiedlicher
Migrationsregimes. Ich verwende diesen neueren Terminus der Migrationsforschung, um anzudeuten, dass vieles an den von Migranten eingeschlagenen Wegen nicht einfach von deren
individueller Entscheidung abhängt.
Zum Migrationsregime gehören Gesetze über das politische Asyl und den Arbeitsmarkt,
Anwerbeabkommen und Anwerbestopps. Sie wirken auf das Migrationsgeschehen ein, wenn
auch nicht immer ganz im Sinne derjenigen, die die Gesetze verabschieden oder die Maßnahmen treffen.
Das politische Asyl für Slowenen und die Leiharbeit slowenischer Migranten gehören der
Vergangenheit an. Das Anwerbeabkommen von 1968 hat demgegenüber dauerhafte Fakten
geschaffen. In Ingolstadt leben nach wie vor Hunderte slowenischer Staatsbürger, die zu unterschiedlichen Einwanderergenerationen gehören. Mein Beitrag, der Teil einer umfangreichen Forschungsarbeit über die Slowenen in Deutschland seit der Reichseinigung im 19. Jahrhundert ist, kann vor allem eines zeigen: Migrationsregimes sind wandelbar, und zwar auch
dann, wenn sie sich auf einen begrenzten Raum beziehen, wie beispielsweise auf Bayern und
auf Slowenien.
88
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Abkürzungsverzeichnis
Abt.
AEG
AG
AOK
AS
AdsD
BA K
BfA
BayHStA
BayLfV
BayMInn
Betr.
BMinn
CK
CSU
DAG
DD
DDJ
Ders.
DGB
Dies.
DK
DP
dt.
EKD
epd
EU
e.V.
EWG
FAZ
FfM.
Filmsign.
HStA
IGM
IMIS
Abteilung
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Allgemeine Ortskrankenkasse
Arhiv Slovenije
Archiv der sozialen Demokratie
Bundesarchiv Koblenz
Bundesanstalt für Arbeit (vor 1969: Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung)
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München
Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
Bayerisches Staatsministerium des Innern
betrifft
Bundesministerium des Innern
Centralni komite
Christlich Soziale Union
Deutsche Angestellten Gewerkschaft
Dve domovini – Two Homelands
Deutsche Delegation in Jugoslawien
Derselbe
Deutscher Gewerkschaftsbund
Dieselbe
Donaukurier
Displaced Persons
deutsch
Evangelische Kirche Deutschlands
Evangelischer Pressedienst
Europäische Union
eingetragener Verein
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurt am Main
Filmsignatur
Hauptstaatsarchiv
Industriegewerkschaft Metall
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien
89
IOS Mitteilung Nr. 66
IMP
IRO
KO
kroat.
LAA
LKA
NfD
NL
OB
OF
OZNA
RdErl.
RG
RUDIS
SAZU
Sig.
slow.
SPD
SR
SRS
srbkr.
StA
SZ
StK
SZDL
Šk.
TAM
UDBA
UNRRA
VBM
VS
VSt.
ZDA
ZKS
ZR
ZRC
ZRN
90
Industrijsko montažno podjetje
International Refugee Organisation
Koordinacijski odbor
kroatisch
Landesarbeitsamt
Landeskriminalamt
Nur für den Dienstgebrauch
Naša luč
Oberbürgermeister
Osvobodilna fronta
Oddelek za zaščito naroda
Runderlass
Rodna gruda
Rudarsko industrijska skupnost
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Signatur
Slowenisch
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Socialistična Republika; Sozialistische Republik
Socialistična Republika Slovenija
Serbokroatisch oder kroatoserbisch
Stadtarchiv
Süddeutsche Zeitung
Staatskanzlei
Socialistična Zveza Delovnega Ljudstva
škatla
Tovarna avtomobilov in motorjev
Uprava državne bezbednosti
United Nations Relief and Rehabilitation Administration
Verein der Bayerischen Metallindustrie
Verschlusssache
Verwaltungsstelle
Združene države Amerike
Zveza Komunistov Slovenije
Zvezna Republika
Znanstveno raziskovalni center
Zvezna Republika Nemčija
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Quellen- und Literaturverzeichnis
Archive
Deutschland
Bundesarchiv Koblenz (BA K)
B 106 Bundesministerium des Innern
B 119 Bundesanstalt für Arbeit
B 136 Bundeskanzleramt
B 145 Bild-, Presse und Informationsamt der Bundesregierung
B 149 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München
Akten der Bayerischen Staatskanzlei (StK)
Ministerium des Innern (MInn)
Staatsarchiv München
Arbeitsämter
Stadtarchiv Ingolstadt
Einwohnermeldekarten
Straßenverzeichnis
Städtepartnerschaft Murska Sobota (bis 1994)
Archiv der IG Metall (IGM-Archiv) im Archiv der sozialen Demokratie Bonn
Abteilung Ausländische Arbeitnehmer
Länderakten Jugoslawien
Verwaltungsstelle Ingolstadt
Bibliothek der IG Metall Frankfurt
Berichte und Redemanuskripte
Archiv des Betriebsrats der AUDI AG Ingolstadt
Ordner Ausländerausschuss
Ordner Jugoslawisches Syndikat/Beirat,
Archiv der Erzdiözese München-Freising
Altreg. Kasten 0741.
Archiv der Arbeiterwohlfahrt im Archiv der sozialen Demokratie Bonn
AdsD, Archiv der Arbeiterwohlfahrt. Ordner Seminar in Jugoslawien, 21–23.10.1987.
Archiv des deutschen Caritasverbandes, Freiburg i.Br.
Bericht des Oberseelsorgeamtes für die Slowenen in der Bundesrepublik 1961.
91
IOS Mitteilung Nr. 66
Slowenien
Arhiv Slovenije Ljubljana (AS)
AS 537
Republiška konferenca Socialistične Zveze Delovnega Ljudstva Slovenije
AS 1589
CK ZKS
AS 1931
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Zeitungsarchiv Delo
Internet-Quellen
http://www2.ingolstadtr.de/index.pthml?ofs_1=15&NavID=1842.11&mNavID=1842.... letzter Zugriff
6.2.2012.
History – Revoz d.d. (http://www.revoz.si/en/inside.cp2?cid=50A1DC36-A564-8F6D-AAEFBB43A84AB, letzter Zugriff am 26.7.2015.
Interviews
Lidija Kranjčan (1.12.2006); Stanislav Gajšek (1.12.2006); Marija Schmid (28.11.2011 und
5.2.2015); Peter Schnell (30.11.2011); Fritz Böhm (1.12.2011); Ladislava Kokalj (2.12.2011);
Slavko Cafuta (18.1.2012); Olga Kerčmar (5.2.2015)
92
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Bibliografie
Akgün, Lale/Thränhardt, Dietrich (Hg.): Integrationspolitik in föderalistischen Systemen, Jahrbuch
Migration 2000/2001, Münster 2001.
Allcock, John B.: Explaining Yugoslavia, New York 2000.
AUDI AG/Audi Tradition: Das Rad der Zeit. Die Geschichte der AUDI AG, Ingolstadt, 3. Aufl., 2000.
Bade, Klaus J.: (Hg.): Migration in der europäischen Geschichte seit dem späten Mittelalter. Vorträge auf dem Deutschen Historikertag in Halle an der Saale, 11. September 2002 (= IMIS-Beiträge, 20/2002).
Ders. (Hg.): Enzyklopädie Migration in Europa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paderborn 2007.
Baučić, Ivo: Porijeklo i struktura radnika iz Jugoslavije u SR Njemačkoj, Zagreb 1970.
Ders.: Radnici u inozemstvu prema propisu stanovništva Jugoslavije 1971, Zagreb 1973.
Ders.: Die Auswirkungen der Arbeitskräftewanderung in Jugoslawien, in: Lohrmann/Manfrass,
Ausländerbeschäftigung, S. 171–206.
Berding, Helmut (Hg.): Nationales Bewußtsein und kollektive Identität. Studien zur Entwicklung
des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1994.
Berlinghoff, Marcel: Das Ende der ‚Gastarbeit‘. Europäische Anwerbestopps 1970–1974, Paderborn 2013.
Bernik, Ivan/Malnar, Brina/Toš, Niko: Slovenian Political Culture: Paradoxes of Democratization,
in: Danica Fink-Hafner/John R. Robbins, Making a New Nation: The Formation of Slovenia,
Aldershot 1997, S. 56–82.
Bonač, Vladimir: Strukturwandlungen der jugoslawischen Familie, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Bd. 12, 1960, Heft 3, S. 421–437.
Boos-Nünning, Ursula: Muttersprachliche Klassen für ausländische Kinder: Eine kritische Diskussion des bayerischen „Offenen Modells“, in: Deutsch lernen, 2/1981, S. 40–69.
Dies./Hohmann, Manfred/Reich, Hans M.: Integration ausländischer Arbeitnehmer. Schulbildung
ausländischer Kinder, Bonn 1976.
Brunnbauer, Ulf: Jugoslawische Geschichte als Migrationsgeschichte, in: Ders., Helmedach, Troebst, Schnittstellen, S. 111–132.
Brunnbauer, Ulf/Helmedach, Andreas/Troebst, Stefan (Hg.), Schnittstellen. Gesellschaft, Nation,
Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag,
München 2007.
Ders.: Globalizing Southeastern Europe: The Economic Causes and Consequences of Overseas Emigration up until 1914, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte – Economic History Yearbook, 1.
2014, S. 33–63.
[Bundesanstalt für Arbeit]: Repräsentativuntersuchung 72 über die Beschäftigung ausländischer
Arbeitnehmer im Bundesgebiet und ihre Familien- und Wohnverhältnisse, Nürnberg 1973.
Calic, Marie-Janine: Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, München 2010.
93
IOS Mitteilung Nr. 66
Caruso, Clelia/Pleinen, Jenny/Raphael, Lutz (Hg.): Postwar Mediterranian Migration to Western
Europe/La migration méditerranéenne en Europe occidentale après 1945 Legal and political
frameworks, Sociability and Memory Cultures/Droit et politique, sociabilité et mémoires,
Frankfurt a.M. 2008.
Ciocchi, Alessandro (Hg.): I giorni della Slovenia, 25 giugno/10 luglio, Ljubljana 1991.
Corni, Gustavo/Dipper, Christof (Hg.): Italiani in Germania tra Ottocento e Novecento. Spostamenti, rapporti, immagini, influenze, Bologna 2006.
Drnovšek, Marjan. (Hg.): Slovenska kronika XX. Stoletja, II knjiga, Ljubljana 1997.
Ders.: Odnos Partije do slovenske emigracije, in: Drago Jančar (Hg.), Temna stran meseca. Kratka
zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990, Ljubljana 1998, S. 234–247.
Ders.: Slowenien in Bewegung: Vom Massenexodus des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der Gastarbeitermigration. Eine sozialdemografische Skizze, in: Rutar/Wörsdörfer (Hg.), Sozialgeschichte in Slowenien, S. 29–49.
Ders.: Izseljevanje „rakrana“ slovenskega naroda, Ljubljana 2010.
EKD, Länderinformation Balkan: Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien, Makedonien, Slowenien. Stand: Oktober 2006.
Endres, Egon: Macht und Solidarität. Beschäftigungsabbau in der Automobilindustrie. Das Beispiel
AUDI NSU in Neckarsulm, Hamburg 1990.
Europäische Flüchtlingsprobleme 1959. Bericht der amerikanischen Zellerbach-Kommission für die
europäische Flüchtlingssituation (= Schriftenreihe der Deutschen Nansen-Gesellschaft, Heft 2,
März 1960.)
Fartek, Martina/Franko, Melita: Izseljenci iz vasi Šalamenci na Goričkem, ki so se stalno vrnili
domov. Raziskovalna naloga. Gimnazija Murska Sobota, in: Lukšič-Hacin (Hg.), Sesonstvo in
izseljenstvo, S. 487–514.
Ferenc, Tone: Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941–
1945 – Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941–1945, Maribor 1980.
Ders. u.a.: Kronologija napredna delavskega gibanja na Slovenskem (1868–1980), Ljubljana 1981.
Ders.: „Absiedler“. Slowenen zwischen ‚Eindeutschung‛ und Ausländereinsatz, in: Herbert (Hg.),
Europa und der „Reichseinsatz“, S. 200–209.
Gombač, Jure: Repatriacija povratnih migracij po koncu druge svetovne vojne, in: Lukšič-Hacin,
Spet doma, S. 13–33.
Gottlob, Bernd: Die Missionare der ausländischen Arbeitnehmer in Deutschland. Eine Situationsund Verhaltensanalyse vor dem Hintergrund kirchlicher Normen, München, 1978.
Gow, James/Carmichael, Cathie: Slovenia and the Slovenes. A Small State and the New Europe,
London 2000.
Grandits, Hannes./Sundhaussen, Holm: Jugoslawien: Jugoslawien in den 1960er Jahren. Auf dem
Weg zu einem (a)normalen Staat? Wiesbaden 2013.
Grgič, Jožica: Odnosi med Vatikanom in Jugoslavijo po letu 1960, Ljubljana 1983.
Grieger, Manfred: Die „geplatzte Wirtschaftswundertüte“. Die Krisen 1966/67 und 1973/75 im
deutschen Symbolunternehmen Volkswagen, in: Tilly/Triebel (Hg.), Automobilindustrie, S. 23–75.
94
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Grothusen, Klaus-Detlev (Hg.): Südosteuropa-Handbuch, Band 1, Jugoslawien, Göttingen 1975.
Haberl, Othmar Nikola: Die Abwanderung von Arbeitskräften aus Jugoslawien. Zur Problematik
ihrer Auslandsbeschäftigung und Rückführung, München 1978.
Hadžić, Senad: Titos ‚Gastarbeiter‘. Hintergründe und Ursachen des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Jugoslawien, in: Neutatz/Zimmermann (Hg.),
Deutsche und östliches Europa, S. 103–114.
Ders.: Istorija jugoslovenske migracije u SR Njemačkoj – Zur Geschichte der jugoslawischen Arbeitsmigration, in: Projekt Migration, Köln 2005, S. 303–310 bzw. 812–815.
Ders./Muňos-Sánchez, Antonio: Kalter Krieg und Migration, in: ebd., S. 35–42.
Hegenkötter, August: Moje delo med Slovenci. Prevedel in piredil Dr. Jože Premrov, Ljubljana 1970.
Herbert, Ulrich: Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880–1980: Saisonarbeiter –
Zwangsarbeiter – Gastarbeiter, Berlin 1986.
Ders. (Hg.): Europa und der „Reichseinsatz“: ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZHäftlinge in Deutschland 1938–1945, Essen 1991.
Ders./Hunn, Karin: Beschäftigung, soziale Sicherung und soziale Integration von Ausländern, in:
Hockerts, Geschichte, S. 781–810.
Hermann, Helga: Auslandsinvestitionen. Deutsche Investoren in Entwicklungsländern, in: Winfried
Schlaffke Rüdiger von Voss (Hg.): Vom Gastarbeiter zum Mitarbeiter. Ursachen, Folgen und
Konsequenzen der Ausländerbeschäftigung in Deutschland, Köln 1982, S. 39–55.
Heßler, Martina: Die Halle 54 bei Volkswagen und die Grenzen der Automatisierung. Überlegungen zum Mensch-Maschine-Verhältnis in der industriellen Produktion der 1980-er Jahre, in:
Zeithistorische Forschungen, 1. 2012, S. 56–76.
Hockerts, Hans Günther (Hg.): Geschichte der Sozialpolitik in Deutschlkand seit 1945, Band 5,
1966–1974, Bundesrepublik Deutschland. Eine Zeit vielfältigen Aufbruchs, Baden-Baden 2006.
Hoff, Andreas: Vorausschauende Personalplanung in der Automobilindustrie. Das Beispiel der
Audi/NSU/Auto Union AG, Die Mitbestimmung, 6. 1983, S. 304–309.
Hoffmann, George W.: Agriculture and Forestry, in: Grothusen, Südosteuropa-Handbuch, S. 254–274.
Hohmann, Manfred: Recht und Organisation des Unterrichts mit ausländischen Kindern, in: BoosNünning/Hohmann/Reich, Schulbildung, S. 142–171.
Höpken, Wolfgang: Slowenien im ersten und zweiten Jugoslawien, in: Bernik/Lauer (Hg.), Grundlagen, S. 83–120.
Hunger, Uwe: Bildungspolitik und „institutionalisierte Diskriminierung“ auf Ebene der Bundesländer, in: Akgün/Thränhardt, Integrationspolitik, S. 119–137.
Initiativgruppe Betreuung von ausländischen Kindern e.V.: Erfahrungen, Anregungen, Informationen, 4. überarbeitete Auflage, München 1982.
Ivanović, Vladimir: „Nostalgija za prugom“ – Das Freizeitverhalten jugoslawischer Gastarbeiter in
der BRD und in Österreich, in: Grandits/Sundhaussen, Jugoslawien, S. 135–156.
Kaser, Karl: Familie und Verwandtschaft auf dem Balkan. Analyse einer untergehenden Kultur,
Wien 1995.
95
IOS Mitteilung Nr. 66
Kiefer, Dorothea: Entwicklungspolitik in Jugoslawien. Ihre Zielsetzungen, Planungen und Ergebnisse,
München 1979.
Kolb, Arnd: Autos. Arbeit. Ausländer. Die Geschichte der Arbeitsmigration des Audi Werks
Neckarsulm, Bielefeld 2011.
Koller, Rudolf: Ingolstadt plant und baut. Ein Rechenschaftsbericht 1966–1971.
Ders.: Ingolstadt plant und baut. Ein Rechenschaftsbericht 1972–1982.
Ders.: Schulentwicklungsplan der Stadt Ingolstadt. Allgemeinbildende Schulen, Ingolstadt 1974.
Korpič-Horvat, Zaposlovanje in deagrarizacija pomurskega prebivalstva, Murska Sobota 1992.
Kunstelj, Ignacij: Politika in duhovnik, Celovec 1979.
Kuzmič, Mihael: Slovenski protestanti in izseljenstvo, in: Trebše-Štolfa/Klemenčič, Slovensko,
S. 149–158.
Lipoglavšek-Rakovec, Slava: Slovenski izseljenci. Geografski pregled predvojnega stanja, Geografski vestnik 22, Ljubljana 1950, S. 1–58.
Lohrmann, Reinhard/Manfrass, Klaus (Hg.): Ausländerbeschäftigung und internationale Politik.
Zur Analyse transnationaler Sozialprozesse, München 1974.
Lukšič-Hacin, Marina: Sesonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Zbornik razprav mednarodne
konference, Radenci, Slovenija, 22.–25. oktober 2002, Ljubljana 2003.
Dies. (Hg.): Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo. Znanstvene razprave,
Ljubljana 2006.
Dies.: „Ekonomske“ migracijske politike in vračanje, in: ebd., S. 35–57.
Luthar, Oto (Hg.): The Land between. A History of Slovenia. Second, revised edition, Frankfurt
a.M. 2013.
Mattes, Monika: „Gastarbeiterinnen“ in der Bundesrepublik. Anwerbepolitik, Migration und Geschlecht in den 50er bis 70er Jahren, Frankfurt a.M. 2005.
Morokvašić, Mirjana: Jugoslawische Frauen. Die Emigration – und danach, Basel 1987.
Münch, Ursula: Asylpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung und Alternativen,
2. erweiterte Auflage, Opladen 1993.
Münnich, Nicole: Struktureller Mangel und Credit-Card Communism. Konsumkultur in Jugoslawien
in den „langen 1960er Jahren“, in: Grandits/Sundhaussen (Hg.), Jugoslawien, S. 109134.
Nećak, Dušan: Triest, eine Einkaufsstadt der Slowenen, in: Helga Schultz (Hg.), Grenzen im Ostblock und ihre Überwindung, Berlin 2001, S. 337–350.
Ders./, Božo: Slowenien, Klagenfurt/Celovec 2006.
Neumaier, Thomas/Roloff, Stefanie: Das Fotoalbum/Konradviertel, Ingolstadt 2011.
Neutatz, Dietmar/Zimmermann, Volker (Hg.): Die Deutschen und das östliche Europa. Aspekte
einer vielfältigen Beziehungsgeschichte. Festschrift für Detlef Brandes zum 65. Geburtstag,
Essen 2006.
Novinščak, Karolina: From Yugoslav ‚Gastarbeiter‘ to ‚Diaspora Croats‘. Policies and Attitudes
toward Emigration in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Croatia,
in: Caruso/Pleinen/Raphael (Hg.): Postwar Mediterranian Migration, S. 125–143.
96
Slowenische Wanderungsbewegungen nach Bayern seit 1945
Dies.: Auf den Spuren von Brandts Ostpolitik und Titos Sonderweg: deutsch-jugoslawische Migrationsbeziehungen in den 1960er und 1970er Jahren, in: Oltmer, „Gastarbeiter“-System, S. 133–148.
Oltmer, Jochen (Hg.): Migrationsforschung und interkulturelle Studien: Zehn Jahre IMIS, Osnabrück 2002.
Ders.: Flucht, Vertreibung und Asyl im 19. und 20. Jahrhundert, in: Bade, Migration, S. 107–134.
Ders.: Migration im 19. und 20. Jahrhundert, München 2010 (= Enzyklopädie deutscher Geschichte,
Bd. 86)
Ders.: Globale Migration. Geschichte und Gegenwart, München 2012.
Pelikan, Egon: Antisemitismus ohne Juden in Slowenien, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung,
15. 2006, S. 185–199.
Rass, Christoph: Institutionalisierungsprozesse auf einem internationalen Arbeitsmarkt: Bilaterale
Wanderungsverträge in Europa zwischen 1919 und 1974, Paderborn 2010.
Rauch, Albert: Kirchen und Religionsgemeinschaften, in: Grothusen, Südosteuropa-Handbuch,
S. 345–359.
Repe, Božo: Slowenische Geschichte, zweiter Teil, in: Nećak, Repe, Slowenien, S. 87–192.
Republiški zavod za zaposlovanje (Hg.): Pregled koncentracije delavcev iz SR Slovenije v tujini,
Ljubljana 1974.
Rogelj, Janez: Petdeset let Slovenske Izseljenske Matice, in: Trebše-Štolfa/Klemenčič, Slovensko
izseljenstvo, S. 15–52.
Rozman, Franc/Melik, Vasilij/Repe, Božo: Öffentliche Gedenktage bei den Slowenen, in: Emil
Brix/Hannes Stekl (Hg.), Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Wien 1997, S. 292–335.
Rutar, Sabine/Wörsdörfer, Rolf (Hg.): Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien.
Forschungen und Forschungsberichte, Bochum/Essen 2009 (= Mitteilungsblatt des Instituts für
soziale Bewegungen, 41. 2009).
Schierup, Carl-Ulrik: Migration, Socialism and the International Division of Labour: The Experience
of Jugoslavia, Aldershot 1990.
Ders./Alexandra Ålund: Will they still be Dancing. Integration and Ethnic Transformation among
Yugoslav Immigrants in Skandinavia, Göteborg 1987.
Schlemmer, Thomas: Industriemoderne in der Provinz. Die Region Ingolstadt zwischen Neubeginn,
Boom und Krise 1945 bis 1975, München 2009 (= Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 57.)
Schmuhl, Hans-Walter: Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsverwaltung in Deutschland 1871–2002.
Zwischen Fürsorge, Hoheit und Markt, Nürnberg 2003.
Slavec, Ingrid: Slovenci v Mannheimu. Knjižnica Glasnika slovenskega etnološkega društva, 7,
Ljubjana 1982.
Slovenska župnija v Münchnu/Izseljeniško društvo Slovenija v svetu: Slovenska sobotna šola v
Münchnu. 30 let, München/Ljubljana 2004.
Sundhaussen, Holm: Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten 1943–2011. Eine ungewöhnliche Geschichte des Gewöhnlichen, Wien 2012.
97
IOS Mitteilung Nr. 66
Šket, Janez/Turk, Ciril: Slovenci na Württemberškem. Nova domovina v cerkvi, Ljubljana 2000.
Štumberger, Saška: Slovenščina pri Slovencih v Nemčiji, Ljubljana 2007.
Švent, Rozina: Slovenski begunci v Auvstriji 1945–1950, Ljubljana 2007 (= Migracije 13.)
Tilly, Stephanie/Triebel, Florian: Automobilindustrie 1945–2000. Eine Schlüsselindustrie zwischen
Boom und Krise, München 2013.
Trebše-Štolfa, Milica/Klemenčič, Matjaž: Slovensko izseljenstvo. Zbornik ob 50-letnici Slovenske
izseljence matice, Ljubljana 2001.
Vilfan, Sergij: Kulturregion und Nation – Gemeinschaften und Gemeinsamkeiten, in: Manfred
Prisching (Hg.): Identität und Nachbarschaft. Die Vielfalt der Alpen-Adria-Länder, Wien/Köln/
Graz 1994, S. 91–113.
Vodopivec, Peter: Von den Anfängen des nationalen Erwachens bis zum Beitritt in die Europäische
Union, in: Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec, Slowenische Geschichte. Gesellschaft –
Politik – Kultur, Graz, 2009, S. 218–518.
Waldrauch, Harald/Sohler, Karin: Migrantenorganisationen in der Großstadt. Entstehung, Strukturen
und Aktivitäten am Beispiel Wiens, Wien 2004.
Werner, Hans Joachim: Murska Sobota, Stadt in Slowenien, Ingolstadt 1982.
Ders.: Fritz Böhm – Streiter für Arbeit und Recht, in: Ders., Siegfried Hörmann, Fritz Böhm –
Streiter für Arbeit und Recht, Kösching 1990, S. 29–196.
Wimmer, Andreas: The Making and the Unmaking of Ethnic Boundaries: A Multilevel Process Theory, in: American Journal of Sociology, 4, 2008, S. 970–1022.
Winterhagen, Jenni: Transnationaler Katholizismus. Die kroatischen Migrantengemeinden in
Deutschland zwischen nationalem Engagement und funktionaler Integration, Berlin 2013.
Wörsdörfer, Rolf: Krisenherd Adria. Konstruktion und Artikulation des Nationalen im italienischjugoslawischen Grenzraum, Paderborn 2004.
Ders.: Transnationale Aspekte italienischer und deutscher Besatzungspolitik in Slowenien 1941 bis
1945, in: Lutz Klinkhammer/Amedeo Osti Guerrazzi/Thomas Schlemmer (Hg.), Die „Achse“
im Krieg. Politik, Ideologie und Kriegsführung 1939–1945, Paderborn 2010, S. 340–367.
Ders.: Vom ‚Westfälischen Slowenen‘ zum ‚Gastarbeiter‘. Slowenische Deutschland-Migrationen
im 19. und 20. Jahrhundert, Paderborn 2017.
98