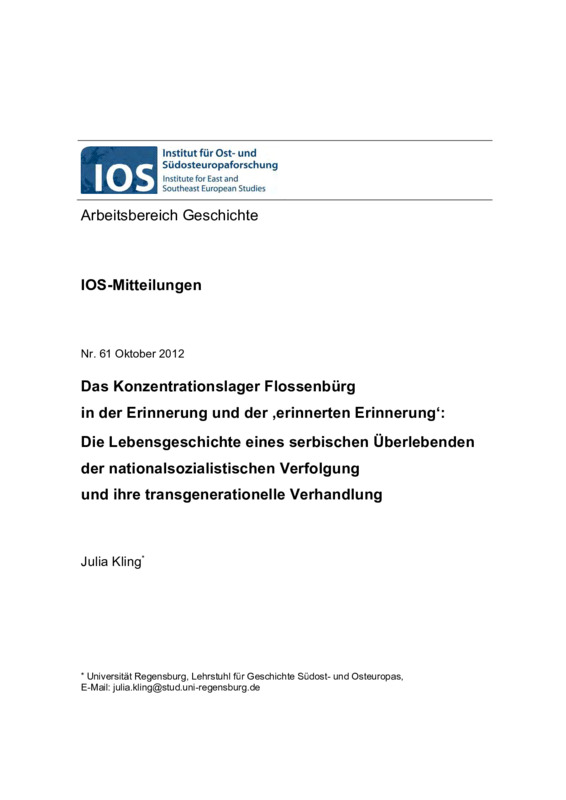https://www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_61.pdf
Media
- extracted text
-
Arbeitsbereich Geschichte
IOS-Mitteilungen
Nr. 61 Oktober 2012
Das Konzentrationslager Flossenbürg
in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘:
Die Lebensgeschichte eines serbischen Überlebenden
der nationalsozialistischen Verfolgung
und ihre transgenerationelle Verhandlung
Julia Kling*
* Universität Regensburg, Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas,
E-Mail: julia.kling@stud.uni-regensburg.de
Grabplatte für die jugoslawischen Opfer des KZ-Flossenbürg auf
dem „Platz der Nationen“.
© Archiv der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Landshuter Straße 4
D-93047 Regensburg
Telefon: (09 41) 943 54-10
Telefax: (09 41) 943 54-27
E-Mail: info@ios-regensburg.de
Internet: www.ios-regensburg.de
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ................................................................................................................................. 1
1.1 Projektbeschreibung ........................................................................................................ 1
1.2 Forschungsstand ............................................................................................................. 2
1.3 Generation und Erinnerung ............................................................................................. 4
1.4 Erinnerung und ‚erinnerte Erinnerung‘ ............................................................................ 6
1.5 Vorgehensweise .............................................................................................................. 7
2 Vorstellung der Quellen und methodische Herangehensweise ............................................. 9
2.1 Quellenbasis .................................................................................................................... 9
2.2 Interviewtechnik .............................................................................................................. 10
2.3 Auswertung der Interviews ............................................................................................. 12
3 Eine Rekonstruktion der Biographie ...................................................................................... 16
3.1 Zwischenkriegszeit und „Razzia“ .................................................................................. 16
3.2
Volksbefreiungsbewegung und Verhaftung ................................................................. 19
3.3 In den Konzentrationslagern Flossenbürg und Hersbruck ........................................... 20
3.4 Rückkehr und das Leben nach 1945 ............................................................................ 25
4 Erinnerung und ‚erinnerte Erinnerung‘ an die nationalsozialistische Verfolgung ................ 28
4.1 Das KZ Flossenbürg in der Erinnerung des Überlebenden Miloš ............................... 28
4.2 Das KZ Flossenbürg in der ‚erinnerten Erinnerung‘ von Milošs Betreuer ..................... 51
5 Lebensgeschichtliche Erzählungen als Erinnerungsorte? .................................................... 67
5.1 Einordnung der „Lebensgeschichte“ in die Erinnerungstheorie ................................... 67
5.2 Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und ihre Überlebenden ......................................... 71
6 Fazit ....................................................................................................................................... 76
7 Quellen- und Literaturverzeichnis ........................................................................................ 78
7.1 Primärquellen ............................................................................................................... 78
7.2 Sekundärliteratur .......................................................................................................... 78
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
1 Einleitung
1.1 Projektbeschreibung
Ziel des lebensgeschichtlichen Interviewprojekts, aus dem diese Arbeit entstanden ist,
war, die Erinnerung an das Konzentrationslager Flossenbürg aus Sicht eines südosteuropäischen Überlebenden darzustellen. Mit Unterstützung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg war es möglich, Kontakt zu einem ehemaligen Häftling aus Serbien herzustellen, der sich zu einem lebensgeschichtlichen Interview bereit erklärte. Der Zeitzeuge
war wegen Verbindungen zu den jugoslawischen Partisanen zunächst von ungarischen
Kräften verhaftet worden, dann aber in der zweiten Jahreshälfte 1944 an die Geheime
Staatspolizei (im Folgenden: Gestapo) übergeben und im Alter von 19 Jahren im Konzentrationslager Flossenbürg und wenig später im KZ-Außenlager Hersbruck interniert
worden. Die Kontaktaufnahme mit dem Zeitzeugen konnte allerdings nicht auf direktem
Wege stattfinden, sondern ausschließlich über einen Freund des Überlebenden, der zugleich auch als sein Betreuer fungiert, und ihn in den vergangenen Jahren mehrfach
nach Flossenbürg begleitet hat. Dieser Betreuer nahm somit die Rolle einer „key person“ ein, wie sie in der Feldforschung häufig beschrieben wird, indem er Eintritt in die
Interviewsituation bot und zum Mittler zwischen Interviewer und Zeitzeuge wurde.1 Er
legte nicht nur die Termine für die Interviews fest, sondern bot sich auch an, während
der Interviews als Dolmetscher bereit zu stehen, was zum einen eine Möglichkeit darstellte, die Sprachbarriere zu einem gewissen Grad zu umgehen, zum anderen jedoch
auch, wie bei der Kontaktaufnahme, zu einer gewissen Abhängigkeit von seiner Person
führte. Durch seine Teilnahme an den Interviews fand eine Ausweitung des ursprünglichen, auf den Zeitzeugen fokussierten, Themas statt, da er das Interview nicht nur begleitete, sondern auch wiederholt in das Interviewgeschehen eingriff. So musste die
anfängliche Projektidee angepasst und die Person des Betreuers in der Auswertung der
lebensgeschichtlichen Erzählung mit berücksichtigt werden.
1
Rolf Lindner, Ohne Gewähr: Zur Kulturanalyse des Informanten, in: Utz Jeggle (Hrsg.), Feldforschung.
Qualitative Methoden in der Kulturanalyse, Tübingen 1984, S. 59–71, S. 59–60, 71.
1
IOS-Mitteilung Nr. 61
1.2 Forschungsstand
Die lebensgeschichtlichen Erinnerungen von Überlebenden der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager sind, wie von Thomas Rahe geschildert, auf zweifache Weise besonders bedeutend: Zum einen sind es Erinnerungen, die,
wenn es nach den Unterdrückern gegangen wäre, niemals zu erzählen gewesen wären,
d.h. diese Erinnerungen stellen sich aktiv gegen ihr einmal angestrebtes Auslöschen.
Zum anderen ist die öffentliche Wahrnehmung der Erinnerungen zugleich aber auch
eine Form des Umgangs der Überlebenden mit ihren Traumata.2 Obwohl die Generation derer, die die nationalsozialistische Verfolgung selbst erlebten, nicht mehr lange
von ihren Erfahrungen berichten können wird, sind diese Erinnerungen dennoch in
der Forschung bislang relativ wenig zu Gewicht gekommen. So spricht Rahe noch
Mitte der 90er Jahre davon, dass es „bislang nur sehr wenige Studien [gibt], die die
Zeugenberichte zur Geschichte der Konzentrationslager selbst zum Gegenstand einer
Untersuchung gemacht haben“. Seiner Beobachtung nach besteht dabei immer noch
ein besonders großes Defizit, was Quellen angeht, die weniger einen Beitrag zur faktischen Rekonstruktion des Lageralltags bieten, als solche, die die Erfahrungswelt der
KZ-Häftlinge beschreiben.3
Gerade was die Schilderungen von Erfahrungen angeht, bietet sich das Instrument
der lebensgeschichtlichen Interviewführung jedoch in besonderem Maße an, wie
Ulrike Jureit eindrucksvoll in ihrer Studie „Erinnerungsmuster. Zur Methodik
lebensgeschichtlicher Interviews mit Überlebenden der Konzentrations- und
Vernichtungslager“ zeigt.4 Dort entwickelt sie eine analytische Herangehensweise an
lebensgeschichtliche Interviews mit Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung, die nach dem individuellen Umgang des Zeitzeugen mit seiner Verfol-
2
Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte für die historische Forschung zur Geschichte der
Konzentrations- und Vernichtungslager, in: Kurt Buck (Hrsg.), Kriegsende und Befreiung, Bremen 1995,
S. 84–98, S. 85.
3
4
Ebd., S. 86–87.
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster. Zur Methodik lebensgeschichtlicher Interviews mit Überlebenden der
Konzentrations- und Vernichtungslager, Hamburg 1999.
2
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
gungsvergangenheit fragt. Dieser Ansatz soll auch in der Quellenanalyse dieser Arbeit herangezogen und im Kapitel zur methodischen Vorgehensweise näher vorgestellt werden.
Untersuchungen zu Häftlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, besonders solche
lebensgeschichtlicher Natur, sind noch wesentlich seltener. Wie Silvija Kavčič beschreibt, waren „Überlebende nationalsozialistischer Konzentrationslager (…) im
ehemaligen Jugoslawien kein Gegenstand detaillierter geschichtswissenschaftlicher
Untersuchungen“.5 Dies hatte seinen Ursprung in der, im neugegründeten sozialistischen Jugoslawien, staatlich geförderten Erinnerungskultur in Bezug auf den Zweiten
Weltkrieg, die geprägt war von der Vorstellung des heldenhaften Partisanenkampfes
gegen die Feinde von außerhalb und innerhalb des Landes, wenn auch unter Ausblendung des Bürgerkriegs, in den alle lokalen Kriegsparteien verwickelt waren, und damit auch all derer Verhältnisse, die dem Gründungsgedanken von „Brüderlichkeit und
Einheit“ widersprochen hätten.6 Heike Karge zeigt in ihrer Untersuchung des jugoslawischen Veteranenbundes u.a. auch, wie diese Form der Kriegserinnerung dazu
führte, dass offiziell nur bestimmte Gruppen als Opfer, bzw. Helden, anerkannt und
unterstützt wurden, allen voran diejenigen, die aktiv am Partisanenkampf oder der
politischen Arbeit, beteiligt gewesen waren.7 Anderen Gruppen hingegen, insbesondere nicht politischen Überlebenden der Lager, Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitern, wurde eine offizielle Anerkennung oft nicht oder erst nach langen Jahren der
Bemühung zugestanden.8 Auch ihren Erinnerungen wurde so meist nur wenig Bedeutung zugemessen bzw. sie wurden gar nicht gehört, da sie in den Augen vieler nicht
5
Silvija Kavčič, Etablierung eines Erzählmusters. Slowenische KZ-Überlebende im sozialistischen
Nachkriegsjugoslawien, in: Julia Obertreis / Anke Stephan (Hrsg.), Erinnerungen nach der Wende. Oral
History und (Post-)sozialistische Gesellschaften, Essen 2009, S. 221–232, S. 221.
6
Heike Karge, Steinerne Erinnerung – versteinerte Erinnerung? Kriegsgedenken in Jugoslawien (1947–
1970), Wiesbaden 2010, S. 23–25.
7
Ebd., S. 34–38.
8
Ebd., S. 172–178.
3
IOS-Mitteilung Nr. 61
mit dem, für die Nachkriegskonsolidierung des Zweiten Jugoslawien so bedeutenden,9
Volksbefreiungskampf zusammenhingen.10 Eine Studie, die zeigt, wie sich das staatlich verordnete Erinnern in Jugoslawien auf bestimmte Gruppen auswirken konnte, ist
Silvija Kavčič’s Untersuchung von lebensgeschichtlichen Erinnerungen ehemaliger
slowenischer Häftlinge des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück, deren Ergebnisse ebenfalls für die Analyse der Interviews in dieser Arbeit herangezogen werden
sollen.11 Darin beschreibt sie, wie die Überlebenden, deren Erfahrungen nicht in das
heroisierende Nachkriegsbild des Partisanenkampfes passten, und denen nach ihrer
Rückkehr von weiten Teilen der jugoslawischen Gesellschaft Desinteresse oder Vorurteile entgegen gebracht wurden, eine Art „Verteidigungsmechanismus“ entwickelten, der dazu führte, dass Erinnerung aktiv umgestaltet wurde, um Teil der offiziellen
Darstellung werden zu können.12 Dies führte langfristig sogar dazu, dass diese neu
geschaffenen, konformen, Erinnerungen eine derartige Kraft entwickelten, dass sie
auch heute noch neben den ursprünglichen Erinnerungen auftauchen oder diese sogar
überlagern.13
Das sich im Interview ergebende Zusammenspiel von Zeitzeuge und Betreuer stellt
eine zusätzliche Spezifizierung der Fragestellung dar und soll im Kontext des transgenerationellen Umgangs mit der Vergangenheit gesehen werden.14 Um die Positionierung der beiden Interviewteilnehmer und ihre Standpunkte näher beschreiben
zu können, sollen nun zunächst die Begriffe „Generation“ und „Erinnerung“ näher
definiert werden.
9
Holm Sundhaussen, Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall, Mannheim
1993, S. 93–94.
10
Silvija Kavčič, Etablierung eines Erzählmusters, S. 225.
11
Dies., Überleben und Erinnern. Slowenische Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück,
Berlin 2007.
12
Ebd., S. 16–17 u. S. 249.
13
Ebd., S. 280.
14
Ulrike Jureit, Generationenforschung, Göttingen 2006, S. 69.
4
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
1.3 Generation und Erinnerung
Durch den wesentlich jüngeren Betreuer nahm, wie schnell deutlich wurde, eine Person
am Interview teil, die die Erzählung des Zeitzeugen aus einem anderen Blickwinkel
betrachtete. Dieser andere Blickwinkel soll in dieser Arbeit berücksichtigt werden, indem er mit dem Ansatz der „Generation“ erklärt wird. Denn mit dem Generationenbegriff wird es nach Ulrike Jureit möglich, „historischen Wandel in einer lebensgeschichtlich überschaubaren Zeitspanne kollektiv wahrzunehmen und ihn mit der generativen
Erneuerung von Gesellschaften in Zusammenhang zu bringen“.15 Indem man also davon
ausgeht, dass eine Generation, also eine bestimmte Gruppe von Menschen, in ihrem
Aufwachsen von einer Reihe von Ereignissen und Veränderungen bestimmt war, und
man annimmt, dass sie eine Art kollektiven Umgang damit entwickelt haben, bedeutet
das, dass sie sich in ihrer Wahrnehmung und ihrem Verhalten wiederum von anderen
Generationen abgrenzen, deren Empfinden von Ereignissen einer anderen Zeit geprägt
ist.16 Dieser Annahme, dass in einer Gesellschaft verschiedene Generationen zugleich
existieren, entspricht ein „horizontal strukturierende[r]“ Ansatz bei der Betrachtung des
Generationsbegriffes, der nach Jureit „generationelle Vergemeinschaftungen als altersspezifische Prägungs- und Deutungseinheiten versteh[t] und in ihnen potentielle oder
tatsächliche Handlungseinheiten identifizier[t]“.17 Dieses Verständnis von Generation
als „Kategorie der Gleichzeitigkeit“, also der gleichzeitigen Existenz unterschiedlicher
Generationen, deutet zugleich auch das sich Gegenüberstehen von unterschiedlichen
„Erfahrungsgemeinschaften“ an.18 Nimmt man für das in dieser Arbeit vorgestellte
Fallbeispiel beispielhaft die nationalsozialistische Verfolgung während des Zweiten
Weltkriegs als Bezugspunkt, so ist der Zeitzeuge Angehöriger der Generation, für die
diese Verfolgungserfahrung Teil ihrer Lebensgeschichte ist. Man kann von dieser Generation daher als „Erlebnis-Generation“ sprechen. Diejenigen, die erst nach dem Ereignis
15
Ebd., S. 3.
16
Ebd., S. 2–3.
17
Ebd., S. 10.
18
Ebd., S. 13.
5
IOS-Mitteilung Nr. 61
geboren wurden, und dazu gehört auch der Betreuer des Zeitzeugen, lassen sich demnach, je nach Altersgruppe, als Angehörige der „zweiten“ oder „dritten Generation“
nach diesem Ereignis betrachten, da sie die Verfolgung nicht persönlich erlebt haben,
deren Folgen aber durch Übertragungen und Überlieferungen aus der älteren Generation
auch Teil ihrer Lebensgeschichte wurde.19 Um was es bei dieser sehr deutlichen Trennung von Erfahrungen, die sich in der Realität natürlich selten so klar vollziehen lässt,
geht, ist zu zeigen, dass jede dieser angesprochenen Generationengruppen gezwungenermaßen eine andere Wahrnehmung ihrer Vergangenheit hat, jeweils ausgehend von
den eigenen Lebenserfahrungen. Indem in der hier vorliegenden Arbeit „Generationen
[auch] als Erinnerungsgemeinschaften“ gesehen werden, die sich in der Gesellschaft
gegeneinander behaupten müssen, stehen sich zugleich die Erinnerungen und Geschichtsbilder der einen und der anderen Generation gegenüber.20 „Transgenerationalität“ ist damit nicht nur als „ein intergenerationelles Beziehungsmuster“ zu verstehen,
sondern auch als „eine spezifische Form des Erinnerns“,21 d.h. eine Weitergabe und
damit implizierte Veränderung von Erinnerungen aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen der Generationen.22
1.4 Erinnerung und ‚erinnerte Erinnerung‘
Ausgehend von diesem Generationenverständnis, erklären sich auch die in dieser Arbeit
verwendeten Begriffe zur Unterscheidung der Erinnerung. Mit der generellen Lebenserinnerung und der Erinnerung an Flossenbürg ist im Folgenden die tatsächliche Erinnerung des Zeitzeugen gemeint. Dabei bleibt natürlich zu beachten, dass auch die Erzählungen eines Zeitzeugen immer auch eine von heutigen Erwartungen bestimmte rückwirkend übertragene Konstruktion der Lebensgeschichte bleiben und keine Schilderung
19
Vgl. dazu: Ebd., S. 77.
20
Ebd., S. 17.
21
Ebd., S. 17.
22
Ebd., S. 69.
6
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
der damaligen Realität darstellen können.23 Mit der ‚erinnerten Erinnerung‘ hingegen ist
die Verarbeitung der Zeitzeugenerinnerung durch die nächsten Generationen gemeint,
in diesem Fall durch den Betreuer des Zeitzeugen. Es geht also um die Art, wie der Betreuer die vom Überlebenden präsentierte Erinnerung wiederum selbst darstellt, also
‚erinnert‘. Wie es auch Jens Birkmeyer und Cornelia Blasberg beschreiben, können spätere Generationen, anders als die Erlebnisgeneration, nämlich nur „Erinnerungen an
andere Erinnerungen“ haben, was von ihnen auch als „sekundäre Erinnerung“ beschrieben wird. Diese Art der Erinnerung entsteht eben nicht aus dem Erleben selbst, sondern
formiert sich auf Basis sekundärer Quellen, d.h. ausschließlich aus der vielfältigen Repräsentation des Erlebten heraus.24 Marianne Hirsch spricht im Zusammenhang mit der
Erinnerung der zweiten Generation auch von „postmemory“, einer Form der Erinnerung,
die sich durch generationellen Abstand auszeichnet, zugleich jedoch eine emotionale Verbindung zu einer Vergangenheit herstellt, die nicht die eigene ist. Diese „postmemory“ ist
in ihrem Verständnis allerdings nicht weniger bedeutend als die echte Erinnerung, eben
nur mit dem Unterschied, dass sie weiter von der Vergangenheit entfernt ist und, weit
stärker als die Erinnerung eines Zeitzeugen, konstruiert wird.25
1.5 Vorgehensweise
In dieser Arbeit soll gezeigt werden, welchen Umgang der Zeitzeuge für die Präsentation seiner Erinnerung in den lebensgeschichtlichen Erzählungen gefunden hat und wie
und aus welchem Grund diese Erinnerungen wiederum von der nächsten Generation, in
Gestalt seines Betreuers, in ihrer ‚erinnerten Erinnerung‘ repräsentiert werden. Zu diesem Zweck soll zunächst die Methode der lebensgeschichtlichen Interviewführung, mit
der das Quellenmaterial, das dieser Arbeit zu Grunde liegt, erhoben wurde, vorgestellt
werden. Daran schließt sich eine Erklärung des methodischen Ansatzes an, der in der
23
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 34.
Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg, Vorwort, in: Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg (Hrsg.), Erinnern
des Holocaust? Eine neue Generation sucht Antworten, Bielefeld 2006, S. 7–15, S. 12.
24
25
Marianne Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory, Cambridge Mass. /
London 1997, S. 22.
7
IOS-Mitteilung Nr. 61
späteren Auswertung der Zeitzeugeninterviews zum Einsatz kommen soll. Dabei handelt es sich um eine Verbindung der Interviewanalyse nach Gabriele Rosenthal mit dem
Lebensweg-Ansatz von Ulrike Jureit. Zur genaueren Analyse der ‚erinnerten Erinnerung‘ des Betreuers soll zusätzlich noch auf die Rhetorik des kollektiven Gedächtnisses
nach Astrid Erll eingegangen werden. Anschließend soll unter Zuhilfenahme der von
Jureit definierten Lebensabschnitte zunächst die Biographie des Zeitzeugen aus seinen
lebensgeschichtlichen Erzählungen rekonstruiert und historisch eingeordnet werden. Im
Rahmen der Interviewanalyse sollen daraufhin eine Reihe von Motiven herausgearbeitet
werden, anhand derer exemplarisch gezeigt wird, wie der Zeitzeuge seine Erinnerung an
das KZ Flossenbürg in seiner Lebensgeschichte präsentiert. Davon ausgehend sollen
Hypothesen dazu aufgestellt werden, welche Umstände in seiner Biographie ausschlaggebend für die jeweilige Darstellungsweise sein können. Ziel der Untersuchung ist es
abschließend, eine Antwort auf die Frage zu geben, welchen Umgang der Zeitzeuge mit
seiner Verfolgungsvergangenheit gewählt hat. Im Anschluss an diesen Analyseteil soll
in einem weiteren Schritt die ‚erinnerte Erinnerung‘ des Betreuers betrachtet werden,
vor allem mit Blick auf die Veränderungen, die die Lebensgeschichte des Zeitzeugen
durch die Repräsentation des Betreuers, in seiner Funktion als Dolmetscher, erfährt und
welche Bedeutung dies für die ursprüngliche Erinnerung hat. Im abschließenden Teil
der Arbeit soll schließlich untersucht werden, ob Lebensgeschichten auch als „Orte der
Erinnerung“ an die nationalsozialistische Verfolgung verstanden werden können und
davon ausgehend, am Beispiel der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, ein Ausblick auf die
zukünftige Entwicklung der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen gegeben werden.
8
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
2 Vorstellung der Quellen und methodische Herangehensweise
2.1 Quellenbasis
Die Generierung der drei lebensgeschichtlichen Interviews, die dieser Arbeit zu Grunde
liegen, fand auf Basis der narrativen Interviewtechnik nach Gabriele Rosenthal statt.26
Sie wurden in einem Zeitraum von drei Tagen in der Wohnung des Zeitzeugen in Novi
Sad geführt und umfassen Tonbandaufzeichnungen von insgesamt etwa sechs Stunden.
Dabei gilt zu berücksichtigen, dass der Betreuer, obwohl er nur auf Anfrage des Interviewers dolmetschen sollte, nach jeder Erzähleinheit des Zeitzeugen, und wiederholt
auch mitten in einer Sinneinheit, in die Erzählung eingriff und so große Erzählabschnitte in den Aufzeichnungen von ihm und nicht vom Zeitzeugen stammen. Obwohl die
Teilnahme eines Dolmetschers an diesen Interviews absolut notwendig war, um die
Sprachbarriere zu überwinden, so ist diese Art der Interviewführung dennoch mit Problemen verbunden, besonders da die Person des Dolmetschers stark ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rückt.27 Auf die Problematik der Interviewführung mit Hilfe von Dolmetschern geht auch Utz Jeggle in Bezug auf ein Interviewprojekt mit ehemaligen
Zwangsarbeitern aus Griechenland ein. So beschreibt er, welch großen Einfluss die Person des Dolmetschers durch seinen persönlichen Hintergrund und seine Einstellungen
auf die Gesprächssituation im Interview und auf das Verhältnis zwischen Interviewer
und Zeitzeuge haben kann, eine Auswirkung, die sich letztlich auch im Interviewergebnis zeigt.28 Auf diese Problematik wird im Laufe dieser Arbeit noch genauer einzugehen
sein.
26
Die Transkriptionen der drei Interviews können auf Anfrage im Archiv der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg eingesehen werden. Die Abkürzungen ‚I‘, ‚M‘ und ‚B‘ im Interviewtranskript stehen jeweils für die
Worte ‚Interviewer‘, ‚Miloš‘ und ‚Betreuer‘. Die Interviews wurden in serbischer und englischer Sprache
geführt. In dieser Arbeit werden, auch aus Gründen des Platzes und der Übersicht, nur die Zitate in serbischer Sprache jeweils im Rahmen einer Fußnote auf Deutsch übersetzt. Der Verweis auf relevante Interviewpassagen innerhalb der Arbeit findet ausschließlich in folgender Form im fortlaufenden Text statt:
(Nummer des Interviews, Seitenzahl).
27
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 304.
28
Utz Jeggle, Verständigungsschwierigkeiten im Feld, in: Utz Jeggle (Hrsg.), Feldforschung. Qualitative
Methoden in der Kulturanalyse, Tübingen 1984, S. 93–112, S. 107 – 109.
9
IOS-Mitteilung Nr. 61
2.2 Interviewtechnik
An dieser Stelle soll nun die Interviewtechnik nach Gabriele Rosenthal vorgestellt werden, immer in Verbindung mit den im hier vorgestellten Fall notwendig gewordenen
Modifikationen aufgrund der komplexen Interviewkonstellation. Nach Rosenthal beginnt ein narratives Interview mit einer „Erzählaufforderung“, die zur „Haupterzählung“
führen soll, gefolgt von einem internen Nachfrageteil, in dem genauere Nachfragen zum
bereits Erzählten möglich sind und abschließend einem externen Nachfrageteil, in dem
Fragen gestellt werden können, die vom Interviewpartner noch nicht gestreift wurden.
Die Erzählaufforderung kann in geschlossener Form stattfinden, hier ist das nachgefragte Thema genau abgesteckt, in offener Form, wobei keine Einschränkungen gemacht
werden, zum Beispiel bei der Nachfrage nach der gesamten Lebensgeschichte, und in
halboffener Form, indem man andere Erzählungen zwar möglich macht, aber auch auf
den eigenen Interessenschwerpunkt hinweist.29 Grundsätzlich sollten die Interviews mit
dem Zeitzeugen in offener Form stattfinden, indem er nach seiner ganzen Lebensgeschichte gefragt wird, um so sehen zu können, welchen Stellenwert er der Erinnerung
an das KZ Flossenbürg in seiner Lebensgeschichte einräumt. Da jedoch die Unterstützung eines Dolmetschers nötig war, wurde beschlossen, das erste Interview mit der Bitte zu beginnen, der Zeitzeuge möge zunächst auf seine Kindheit eingehen. So sollte
allen Teilnehmern des Interviews die Möglichkeit gegeben werden, sich in die komplexe Interviewsituation einzufinden. Der Zeitzeuge sollte dann im Laufe des Interviews
die Schwerpunkte seiner Erzählung zunehmend selbst setzen können.30 Die Schwierigkeiten, die sich dabei ergaben, lagen u.a. auch darin begründet, dass der Zeitzeuge durch
die Frage nach seiner ganzen Lebensgeschichte anfänglich verunsichert wurde, da er
anscheinend davon ausgegangen war, direkt mit der Zeit im KZ antworten zu können
(I, 1). Dieses Abweichen von einer chronologischen Vorgehensweise wurde jedoch von
29
Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung: Eine Einführung, Weinheim / München 2005,
S. 143–152.
30
Judith Schlehe beschreibt diese Möglichkeit einer flexiblen Anpassung der Methode ausgehend von
der Interviewsituation in: Judith Schlehe, Formen qualitativer ethnographischer Interviews, in: Bettina
Beer (Hrsg.), Methoden ethnologischer Feldforschung, Berlin 2008, S. 119–142, S. 126–128.
10
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Seiten des Betreuers umgehend verhindert und die Chronologie auch in der Folge von
ihm immer wieder konsequent eingefordert. Die anfängliche Idee, dem Zeitzeugen im
Laufe des Gesprächs mehr Freiraum in seinen Erzählungen zu geben, scheiterte so.
Während der gesamten Interviews gab es so nur wenige kurze Episoden, in denen der
Zeitzeuge ohne die Aufsicht des Betreuers erzählen konnte.31
Die komplexe Situation, die sich aus der Interviewer / Zeitzeuge / DolmetscherKonstellation ergab, stand so auch in vielen Punkten den Vorgaben der Rosenthalschen
Interviewtechnik entgegen. So strebt man mit einem narrativen Interview nach Rosenthal die „Hervorlockung und Aufrechterhaltung von längeren Erzählungen“ an, „die
zunächst ohne weitere Interventionen von Seiten der InterviewerInnen produziert werden können“: Wichtig ist also zunächst nicht das Gesprächsziel, sondern dass der Interviewer der Logik der interviewten Person und ihren Gedanken folgt, um so zu gewährleisten, dass die Interviewpartner selbstständig entscheiden können, wie sie ihre Narration gestalten möchten.32 Es soll bei dieser Methode vermieden werden, dass
„InterviewerInnen mit Zwischenfragen den Erinnerungsfluss unterbrechen“ und die
Interviewpartner so unbewusst dazu bewegen, nicht ihre eigenen Schwerpunkte zu
setzen, sondern das zu erzählen, was die Interviewer für wichtig halten.33 Im hier
vorgestellten Fallbeispiel wurde eine freie Erzählung des Zeitzeugen jedoch durch den
Betreuer kaum ermöglicht. Er unterbrach regelmäßig den Gesprächsfluss, schlug
Themen und Anekdoten vor, von denen der Zeitzeuge erzählen sollte, stellte
Zwischenfragen zu bestimmten Details und fügte seinen Übertragungen ins Englische
häufig auch eigene Interpretationsvorschläge hinzu. Dabei geht es bei narrativen Interviews allgemein, wie dies auch Roswitha Breckner betont, nicht um das Aufspüren von
Fakten, oder das Stellen vieler Fragen. Der Interviewte soll die Möglichkeit bekommen,
die Ereignisse selbst zu ordnen und zu entscheiden, was er erzählen möchte, er soll sein
31
Zur Bedeutung des Entstehungsrahmens im Zeitzeugengespräch s.: Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 31.
32
Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung, S. 137.
33
Ebd., S. 143.
11
IOS-Mitteilung Nr. 61
eigenes „Relevanzsystem“ offenbaren können.34 Da das „Relevanzsystem“ des Zeitzeugen in den Interviews nur bruchstückhaft auftreten konnte, soll im Laufe dieser Arbeit
also auch untersucht werden, welches „Relevanzsystem“ der Betreuer durch seinen Einfluss auf das Interview schafft und welche Auswirkungen sich so für die erzählte
Lebensgeschichte des Zeitzeugen ergeben.
2.3 Auswertung der Interviews
Bei der Auswertung der transkribierten Interviews geht es schließlich Rosenthal zufolge
darum, aus den Interviews „sowohl die Gegenwartsperspektive als auch die Perspektiven des Handelnden in der Vergangenheit zu rekonstruieren“; es muss also unterschieden werden, zwischen dem, was der Zeitzeuge in seiner Biographie erlebt hat und der
Art wie er heute davon spricht. Außerdem lassen sich durch eine Gegenüberstellung
dieser „erlebten“ und „erzählten“ Lebensgeschichte, die bei Rosenthal mit Hilfe einer
sequentiellen Analyse erhoben werden, Hypothesen darüber aufstellen, was zu bestimmten Darstellungsweisen in der Lebensgeschichte geführt hat.35 In diesem Sinne
besteht dann auch die Möglichkeit, in den Lebensgeschichten eine „Wechselbeziehung
zwischen Individuellem und Allgemeinem, zwischen Individuum und Gesellschaft“
aufzuspüren, denn gerade auch die Art wie sich die Biographie von der präsentierten
Lebensgeschichte unterscheidet, gibt Aufschluss darüber, „was, wie, wann und in welchen Kontexten thematisiert werden darf und was nicht“.36 Interviews mit Zeitzeugen
ermöglichen demnach keinen realitätsnahen Rückblick auf die Vergangenheit, sondern
sind immer auch von gesellschaftlichen Erwartungen und Interessen beeinflusst.37
34
Roswitha Breckner, Von den Zeitzeugen zu den Biographen. Methoden der Erhebung und Auswertung
lebensgeschichtlicher Interviews, in: Berliner Geschichtswerkstatt (Hrsg.), Alltagskultur, Subjektivität
und Geschichte. Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte, Münster 1994, S. 199–222, S. 199–202.
35
Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung, S. 173–174.
36
Gabriele Rosenthal, Die Biographie im Kontext der Familien- und Gesellschaftsgeschichte, in: Bettina
Völter / Bettina Dausien / Helma Lutz / Gabriele Rosenthal (Hrsg.), Biographieforschung im Diskurs,
Wiesbaden 2005, S. 46–64, S. 50–51.
37
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 96.
12
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Rosenthal fragt sich bei der sequentiellen Untersuchung der Lebensgeschichte „ob die
einzelnen Sequenzen im Sinne einer Gestalt angeordnet sind, in der die einzelnen Teile in
einem Beziehungszusammenhang stehen, oder ob es sich hierbei um eine beliebige Anhäufung einzelner Teile handelt“.38 Besonders bei einem Interview mit einem Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung ist davon auszugehen, dass aufgrund des tiefen
Eingriffs der Verfolgungserfahrung in seine Biographie, diese Erzählung im Mittelpunkt
der Lebensgeschichte steht. Auf diese spezifische Tatsache, das im Zentrum stehen der
KZ-Erfahrung, geht Ulrike Jureit mit ihrem Lebensweg-Ansatz ausführlich ein: Sie betont
die besondere Schwierigkeit, der Überlebende der nationalsozialistischen Verfolgung bei
der Erzählung ihrer Lebensgeschichte unterliegen, da sie, wie jeder Biograph, ihre Lebensgeschichte so konstruieren müssen, dass ihr Leben nach einer logischen Abfolge
klingt, während sie aber von etwas erzählen, dass einer Kontinuität in der Lebensgeschichte oder jedweder Logik fundamental widerspricht. Aus diesem Grund schließt sie,
dass der Versuch, dennoch von den Erlebnissen im Lager zu erzählen, auch eine Möglichkeit für die Zeitzeugen ist, sich den traumatischen Erfahrungen zu nähern und letztendlich
damit umzugehen. Sie interessiert vor allem dieser Weg des Umgangs, der ein Weiterleben ermöglichte und sie beschreibt daher die Erinnerung der Überlebenden an diesen Weg
als eine Art „Wegbeschreibung“. Zu diesem Ziel betrachtet Jureit in ihrer Analyse der zu
untersuchenden Lebensgeschichte vier „Zeiträume“, nämlich den, der der Verfolgung
voranging, den der zwischen Verfolgung und Deportation lag, die Lebensperiode im Konzentrationslager und die Zeit danach. Indem sie die Erzählungen aus diesen vier Zeiträumen historisch einordnet, versucht sie in ihnen „Kontinuitäten und Brüche innerhalb der
Wegbeschreibungen heraus[zu]arbeite[n]“, um so ableiten zu können, welchen individuellen Umgang der Überlebende mit seiner KZ-Erinnerung gewählt hat.39 Die von Rosenthal
beschriebenen zwei Ebenen der „erlebten“ und „erzählten“ Lebensgeschichte zeigen sich
also auch im Ansatz von Ulrike Jureit, was eine Verbindung beider methodischer Zugänge
in dieser Arbeit als sinnvoll erscheinen lässt.
38
Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung, S. 184.
39
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 131–132.
13
IOS-Mitteilung Nr. 61
Im Anschluss an die Analyse der Zeitzeugenerinnerung, soll auch der Redeanteil des
Betreuers in den Interviews analysiert werden, da sich in seinen Ausführungen, wie
noch zu zeigen sein wird, eine ganz eigene Sichtweise auf die Lebensgeschichte des
Zeitzeugen herauskristallisiert. Dabei sollen die Veränderungen, die sich in der Wahrnehmung der ursprünglichen Erinnerung durch die Darstellungsweise des Betreuers in
den gedolmetschten Passagen ergeben, untersucht werden. Um abschließend festzustellen, was den Betreuer bewusst oder unbewusst dazu bewegt, derartige Modifikationen
vorzunehmen, soll auch die Theorie der Fünf Modi der Rhetorik des kollektiven Gedächtnisses nach Astrid Erll zur Analyse hinzugezogen werden. Erlls Ansatz geht davon
aus, dass es in einer „stark kontextorientierten erinnerungshistorischen Narratologie“
verschiedene Kategorien oder Modi gibt, die Teil einer bestimmten Rhetorik sind und
dazu dienen, beispielsweise einen Text zum Medium des kollektiven Gedächtnisses
werden zu lassen.40 Zwar wurde dieser Ansatz als literaturwissenschaftliches Instrument
entwickelt, dennoch erscheint eine Verwendung im Bereich des lebensgeschichtlichen
Interviews durchaus als vielversprechend. Neben ihrer Nähe zu Literaturformen wie
Memoiren, bezeichnet Hans Joachim Schröder Interviews schließlich auch als „Dokumentarliteratur“, eine „Literaturform“, die gekennzeichnet ist durch „die fließenden
Übergänge zwischen faktentreuer, freier und fiktiver Darstellung“.41
Erll unterscheidet in ihrer Theorie zwischen dem erfahrungshaftigen Modus (die Erzählung ist bestimmt durch den Rahmen des kommunikativen Gedächtnisses), dem monumentalen Modus (die Erzählung ist hier bestimmt vom kulturellen Gedächtnis), dem
historisierenden Modus (die Erzählung beschäftigt sich mit historischen, „abgeschlossenen“ Aspekten), dem antagonistischen Modus (die Erzählung ist bestimmt durch
„Erinnerungskonkurrenzen“) und dem reflexiven Modus (die Erzählung reflektiert über
den Prozess der Erinnerung). Diese Modi treten in unterschiedlichen Kombinationen
auf, was jeweils Auswirkungen auf die „erinnerungskulturelle (…) Funktionalisierung“
40
Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart / Weimar
2005, S. 167–168.
41
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 92.
14
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
der Erzählung hat.42 Im Redeanteil des Betreuers soll also untersucht werden, welche
dieser Modi, wie und in welcher Kombination verstärkt auftreten, um abschließend eine
Aussage darüber machen zu können, welche Ziele er mit seiner Version der Lebensgeschichte verfolgt.
Für die Auswertung des Interviews bestand der Zeitzeuge zwar nicht auf einer Anonymisierung, da er aber weder die englischen Ausführungen seines Betreuers verstehen
konnte, noch die Interviewtranskriptionen zur Einsicht erhielt, oder zu den Analyseergebnissen Stellung nehmen konnte, wird im Folgenden immer von ‚Miloš‘, stellvertretend für den Namen des Zeitzeugen, die Rede sein. Auch der Dolmetscher wird in der
anonymisierten Form als ‚Betreuer‘ bezeichnet werden.43 Zunächst soll nun der Zeitzeuge, Miloš, im Rahmen einer biographischen Rekonstruktion seiner Lebensgeschichte, vorgestellt werden, gegliedert wie zuvor beschrieben nach den Betrachtungszeiträumen von Ulrike Jureit. Dabei geht es darum, wie oben erwähnt, die Erzählungen in den
Interviews, welche „konstruierte Erfahrungssynthese[n]“ darstellen, zunächst historisch
einzuordnen, um in der sich daran anschließenden Analyse das Miteinander von „erlebter“ und „erzählter“ Geschichte erkennen zu können, was wiederum Rückschlüsse auf
den „individuellen Umgang mit der erlittenen Verfolgung“ erlaubt.44
42
Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 168 u. 189.
43
Zu dieser Vorgehensweise vgl.: Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 14.
44
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 13–14.
15
IOS-Mitteilung Nr. 61
3 Eine Rekonstruktion der Biogr aphie: Miloš – Ein Überlebender des KZ Flossenbürg
3.1 Zwischenkriegszeit und „Razzia“
Miloš, Jahrgang 1925, entstammt einer Familie von serbischen Kleinbauern aus einem
Dorf in der serbischen autonomen Provinz Vojvodina, worunter man vor 1941 generell
„die bis 1918 innerungarischen und seitdem südslawischen Gebiete, also die (südliche)
Bačka, den (westlichen) Banat und die heute zu Kroatien gehörende (südliche) Baranja“
verstand.45 Miloš wuchs dort in sehr einfachen Lebensverhältnissen auf, die Beschreibungen seiner Kindheit klingen nach harter körperlicher Arbeit, aber auch einem in gewisser Weise idyllischen Leben. Auch wenn sein Vater einen Großteil seines Besitzes,
vermutlich aufgrund einer schlechten Ernte, gegen Ende der 1920er Jahre verlor, hatte
die Familie durch ihren kleinen Landbesitz dennoch immer genug zum Leben und
konnte ihre Ersparnisse wiederum in die Vergrößerung ihres Besitzes investieren. Neben der Tierhaltung verkaufte die Familie auch Wassermelonen in der Hauptstadt Belgrad. Diese mussten mit Hilfe von großen Lastkähnen in einer mehrstündigen Reise
dorthin transportiert werden (I, 1–7).
Miloš war Einzelkind, eine große Ausnahme in der Dorfgemeinschaft, wo es außer
ihm ausschließlich sehr kinderreiche Familien gab. Die Verbindung zu seinen Eltern
scheint sehr eng gewesen zu sein, vor allem zu seinem Vater. Er betont zwar, dass er
immer gehorchen und seine Pflichten erfüllen musste, aus seinen Erzählungen wird aber
auch deutlich, dass er bereits in sehr jungen Jahren viel Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit übertragen bekam. Er besuchte sechs Jahre lang die Schule, im Anschluss daran sollte er im Alter von 13 Jahren, wie die meisten seiner Altersgenossen,
für eine Lehre fortgeschickt werden. Da aber viel vom Krieg gesprochen wurde, entschloss sich der Vater dazu, den Sohn zu Hause zu behalten (I, 3–5).
Miloš wuchs in einer ethnisch sehr heterogenen Region auf. In der Bačka, in der
auch Milošs Dorf liegt, „lebte zwischen 1918 und 1941 auch der größte Teil sowohl der
45
Carl Bethke, Deutsche und ungarische Minderheiten in Kroatien und der Vojvodina 1918–1941.
Identitätsentwürfe und ethnopolitische Mobilisierung, Wiesbaden 2009, S. 62–63.
16
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
deutschen als auch der ungarischen Minderheit Jugoslawiens“.46 Für sein Dorf beschreibt Miloš die ethnische Zusammensetzung als eine Mehrheit von serbischen Bewohnern und eine etwa 20 % umfassende ungarische Minderheit. Das Zusammenleben
in der Zwischenkriegszeit sei gut und vertrauensvoll gewesen. Allerdings beschreibt er
auch die nach Ethnien getrennten Schulen und die Kirchen der verschiedenen Konfessionen (I, 6–7, 10–11, 13–14).
Nachdem sich Jugoslawien am 25. 3. 1941 dem Dreimächtepakt angeschlossen hatte,
folgte ein Putsch serbischer Offiziere gegen die jugoslawische Regierung; obwohl dieses
Ereignis keinen Ausstieg aus dem Pakt zur Folge hatte, begann am 6. 4. 1941 der Angriff
des Deutschen Reiches auf Jugoslawien mit der Absicht den Staat auszulöschen.47 Mit der
Kapitulation Jugoslawiens am 17. 4. 1941,48 „wurde der Vielvölkerstaat in ein buntes Mosaik von annektierten, besetzten und scheinsouveränen Gebieten zerstückelt“: Während
das jugoslawische Banat „deutscher Militärverwaltung“ zufiel, wurden „die Batschka und
die Baranja (…) sowie ein Zipfel im äußersten Nordwesten Jugoslawiens (…) an Ungarn
zurückgegliedert, zu dem sie bis 1918 gehört hatten“.49 Ungarische Kräfte begannen bereits am 11. 4. 1941 damit, die Bačka zu besetzen.50 Milošs Dorf befand sich so mit Beginn des Krieges, wie er auch beschreibt, in der ungarischen Besatzungszone (I, 7).51
Für Milošs Dorf beginnt die Besatzungszeit relativ ruhig, die ersten ungarischen Besatzungstruppen hatten ein gutes Verhältnis zu den Bewohnern. Allerdings musste auch
Milošs Familie einen Soldaten und zwei Pferde aufnehmen. Auch mussten sie bald einen zunehmenden Eingriff in ihre Privatsphäre hinnehmen, auf Befehl der Besatzer
durften beispielsweise die Türen der Häuser und Ställe nicht mehr verschlossen werden.
Zudem spricht Miloš davon, wie sie zu einer Art wöchentlichem Appell antreten muss-
46
Carl Bethke, Deutsche und ungarische Minderheiten, S. 62–63.
47
Holm Sundhaussen, Experiment Jugoslawien, S. 65–67.
48
Carl Bethke, Deutsche und ungarische Minderheiten, S. 621.
49
Holm Sundhaussen, Experiment Jugoslawien, S. 68.
50
Carl Bethke, Deutsche und ungarische Minderheiten, S. 621.
51
Zur ungarischen Besatzungszone siehe auch: Sabrina Ramet, Die drei Jugoslawien. Eine Geschichte
der Staatsbildungen und ihrer Probleme, München 2011, S. 197–198.
17
IOS-Mitteilung Nr. 61
ten, wo ihnen eingeschärft wurde, dass sie nun auf ungarischem Boden leben würden
und die ungarische Kultur daher auch im Alltag Eingang finden müsse. Dies kann als
Beispiel für die zunehmenden Magyarisierungsversuche durch die Besatzungsmacht in
diesem Gebiet verstanden werden.52 Miloš beschreibt, wie sich in dieser Zeit das Verhältnis zwischen den Dorfbewohnern wandelte: Obwohl man sich von früher kannte,
verhielten sich die ungarischen Bewohner nach der Machtübernahme im Dorf mit einem
Mal feindselig und misstrauisch (I, 21, 24–25).
Im Januar 1942 kam es zur sogenannten „Razzia“ von Novi Sad, einem Massaker, dem
mehr als 1000 Menschen durch Erschießungen am Donauufer zum Opfer fielen.53 Am
zweiten Tag der orthodoxen Weihnachten, so erinnert sich Miloš, wurde sein Vater von
zwei ungarischen Beamten abgeholt, und, wie 47 andere Männer aus dem Dorf, verhaftet.
Miloš konnte sich nur noch mit Hilfe von Hust-Signalen bei seinem Vater verabschieden.
Dass Milošs Vater und die restlichen Männer kurz darauf ermordet wurden, erfuhren
Miloš und seine Familie lange Zeit nicht. Miloš konnte nur ahnen, was passiert war:
Als Schlüsselmoment in dieser Hinsicht beschreibt er seine Entdeckung auf einer Flussinsel in der Donau nahe seines Heimatdorfes. Dort fand er einige Monate nach der „Razzia“
schrecklich entstellte Leichen, die angeschwemmt worden waren und ihn ahnen ließen,
was mit seinem Vater passiert sein musste (I, 27–32).
Nach den Ausschreitungen der „Razzia“ verfällt Milošs Ort jedoch wieder in eine
eigentümliche Ruhe, Miloš spielte im lokalen Fußballteam, und bestellte den Hof mit
seiner Mutter und seinem alten Großvater. Dennoch stellt die Verhaftung des Vaters
einen deutlichen Bruch in seiner Lebensgeschichte dar, die bis dahin nach dem Maßstab seines sozialen Umfelds in relativ geregelten Bahnen verlaufen war. Die Zentralität des Schicksals seines Vaters zeigt sich auch in seiner Antwort auf die Frage nach
52
Ebd., S. 197.
53
Zur „Razzia“ siehe: Katrin Boeckh, Serbien Montenegro. Geschichte und Gegenwart, Regensburg 2009,
S. 129. Siehe dazu auch: Jörg Paas, Von den Opfern nicht vergessen. Prozessauftakt gegen NS-Kriegsverbrecher Kepiro, 5. 5. 2011, in: tagesschau.de: http://www.tagesschau.de/ausland/prozesssandorkepiro100.html (letzter Zugriff: 23. 11. 2011).
18
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
seiner schönsten Kindheitserinnerung. Er spricht davon, dass er keine besondere habe,
und erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Ermordung seines Vaters (I, 13).
3.2 Volksbefreiungsbewegung und Verhaftung
Auch wenn Miloš die Zeit nach der „Razzia“ als relativ geordnet beschreibt, ist dies
genau die Phase in der er begann, sich in der Volksbefreiungsbewegung zu engagieren.
Als er von einem Schmied in seinem Zuhause angeworben wurde, geschah dies explizit
mit Hinweis auf den Verbleib des Vaters. Daraufhin schloss er sich der lokalen Widerstandszelle an und arbeitete ab 1942 als Kurier und Informant für die Volksbefreiungsbewegung (II, 3). Diese Bewegung wurde getragen von den jugoslawischen Partisanen
unter Josip Broz Tito, die während des Zweiten Weltkriegs den bewaffneten kommunistischen Widerstand gegen die Besatzungstruppen auf jugoslawischem Gebiet organisierten. Die Partisanen fanden aufgrund der zunehmend brutalen Vorgehensweise der
Besatzungsmächte relativ zügig Unterstützer in ganz Jugoslawien und zeichneten sich
so besonders durch die ethnische Heterogenität ihrer Mitglieder aus.54 Nach ihrem Sieg
im „antifaschistischen Volksbefreiungskrieg“ dienten der Partisanenmythos, der bereits
während des Krieges entstanden war, sowie der sich daraus ergebende Leitsatz „Brüderlichkeit und Einheit“ auch als Legitimationsbasis des neuen Staates und prägten das
Geschichtsbild des Zweiten Jugoslawiens.55
Milošs Untergrundarbeit für die Partisanen fand unter den Augen der ungarischen Besatzungstruppen statt, wodurch er sich immer in Gefahr befand, entdeckt zu werden, besonders,
da er häufig das Dorf verlassen musste, beispielsweise um Propagandamaterial zu verteilen
oder ankommende Partisanen aus anderen Teilen Jugoslawiens in sichere Verstecke zu
geleiten. In Kampfhandlungen war er jedoch zu keinem Zeitpunkt verwickelt (II, 4, 6).
54
Marie-Janine Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, Bonn 2010, S. 147–151.
55
Holm Sundhaussen, Die „Genozidnation“: serbische Kriegs- und Nachkriegsbilder, in: Nikolaus
Buschmann / Dieter Langewiesche (Hrsg.), Der Krieg in den Gründungsmythen europäischer Nationen
und der USA, Frankfurt a. M. / New York 2003, S. 351–371, S. 357–358.
19
IOS-Mitteilung Nr. 61
Mitte 1944 kam es zur Verhaftung eines von Milošs Vorgesetzten durch die ungarischen Besatzer. Im Verhör wurde dieser gezwungen, mehrere Namen anderer Partisanen zu nennen. Unter den genannten Namen war auch der von Miloš. Kurze Zeit danach
rückten Angehörige der ungarischen Besatzungstruppen in das Dorf ein und nahmen ihn
und andere Mitglieder der Bewegung fest. Zunächst wurden sie nach Novi Sad gebracht, danach folgte der Aufenthalt in einem ungarischen Lager auf dem Gebiet der
Vojvodina. Mit dem Näherrücken der russischen Front im September, so schildert es
Miloš, erwarteten sie bereits die Befreiung, wurden dann aber von den ungarischen
Soldaten nach Ungarn transportiert, wo sie erneut in einem Lager interniert wurden.
Während ihre Anführer dort von den Ungarn frei gelassen wurden, kam es zu einer
Übergabe von Miloš und einer Reihe weiterer Partisanen an die Gestapo (II, 10–15).
Wie Spoerer mit Blick auf das System der Zwangsarbeit im Deutschen Reich schreibt,
hatte schon
Mitte 1943 (…) der Bedarf an Arbeitern im Reich ein solches Ausmaß erreicht, dass gemäß einem entsprechenden Führerbefehl gefangengenommene serbische Partisanen nicht
mehr unbedingt hingerichtet werden mussten, sondern statt dessen ins Reich verschickt
werden konnten.56
Diese Entwicklung könnte möglicherweise auch Milošs Übergabe und weiteren
Transport ins Deutsche Reich und in das KZ Flossenbürg erklären.
3.3 In den Konzentrationslagern Flossenbürg und Hersbruck
Milošs erste Station als KZ-Häftling war das Konzentrationslager Flossenbürg. Diese KZAnlage existierte seit dem 3. Mai 1938 und entwickelte über die Jahre ein Netz von mehr
als 83 Außenlagern, das weit über die Region hinausreichte. Die Existenz des Konzentrationslagers in Flossenbürg ging auf die Ausbeutung der dortigen Granitsteinbrüche durch
Wirtschaftsunternehmen der Schutzstaffel (im Folgenden: SS) zurück. Zunächst wurden
zum Zweck der Zwangsarbeit Häftlinge im Lager interniert, die als Kriminelle eingestuft
20
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
worden waren, im Laufe der Zeit kamen dann aber auch immer mehr Kriegsgefangene
und Häftlinge aus den vom Deutschen Reich besetzten Ländern nach Flossenbürg.57 Bei
der Zivilbevölkerung wurde von der SS gezielt die Wahrnehmung gestreut, die im Lager
inhaftierten Menschen seien Verbrecher, auch um sicher zu sein, dass ihre Behandlung der
Häftlinge von den Bewohnern nicht hinterfragt werden würde.58
Besonders das Jahr 1944, in dem auch Miloš nach Flossenbürg kam, stellte einen
Schlüsselmoment dar. In diesem Jahr vergrößerte sich das Konzentrationslager deutlich,
auch in Hinblick auf die Schaffung zahlreicher Außenlager, und nahm eine zunehmend
ansteigende Zahl an Häftlingen auf. Bei Milošs Ankunft in Flossenbürg befanden sich
insgesamt ca. 31000 Gefangene im Lagerkomplex, davon über 8000 im Hauptlager und
die restlichen Häftlinge verteilt auf die große Zahl von Außenlagern. Zu diesem Zeitpunkt waren die Sterblichkeitsraten aufgrund der unmenschlichen Bedingungen im
Hauptlager bereits enorm hoch. Neu ankommende Häftlinge wurden nach der Ankunft
selektiert und je nach Arbeitskraft auf Aufgaben im Hauptlager oder in den Außenlagern verteilt.59 Daraus erklärt sich auch, dass Miloš, nach seiner Ankunft im November
1944, nur relativ kurze Zeit in Flossenbürg verblieb und nach nur etwas über zwei Wochen in das KZ-Außenlager Hersbruck verlegt wurde (II, 16–17).
Die Häftlinge im KZ-Außenlager Hersbruck mussten ab 1944 bei Happurg in einem
Berg ein Stollensystem anlegen, was als spätere Produktionsstätte für Flugzeugmotoren
vorgesehen war.60 Die Außenlager des KZ Flossenbürg waren von sehr unterschiedlicher
Natur, teilweise mit besseren Bedingungen als im Hauptlager, teilweise mit weitaus
56
Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und
Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart / München 2001, S. 68.
57
Wolfgang Benz / Barbara Distel, Einleitung, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel (Hrsg.), Der Ort des
Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen,
Ravensbrück, München 2006, S. 9–13, S. 9.
58
Jörg Skriebeleit, Flossenbürg – Stammlager, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel (Hrsg.), Der Ort des
Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen,
Ravensbrück, München 2006, S. 17–66, S. 24.
59
Ebd., S. 46–49.
60
Alexander Schmidt, Das KZ-Außenlager Hersbruck. Zur Geschichte des größten Außenlagers des KZ
Flossenbürg in Bayern, in: Dachauer Hefte (2004), Heft 20, S. 99–111, S. 101.
21
IOS-Mitteilung Nr. 61
schlechteren: Hersbruck war nach dem tschechischen Leitmeritz das zweitgrößte Außenlager von Flossenbürg und hatte entgegen der meisten Außenlager in der Region Nordbayern die Ausmaße eines ausgeprägten Lagers,61 mit einem eigenen Krematorium.62 Als
Miloš im Dezember 1944 nach Hersbruck kam, waren dort mehr als 2700 Häftlinge interniert.63 Wie in den meisten Konzentrationslagern waren für die Bewachung in Flossenbürg und Hersbruck Angehörige der SS zuständig.64 Die SS-Aufseher bestimmten über
Leben und Tod der Häftlinge, die ihrer Willkür völlig ausgeliefert waren; sie setzten zudem auch auf die Einbeziehung bestimmter Häftlinge in die Befehlskette, beispielsweise
in der Funktion als Kapos, wodurch es zu Konkurrenzen unter den Häftlingen kam, die
aufgespalten wurden in die, die Macht durch den Feind verliehen bekamen und die, die ihr
ausgeliefert waren.65 Auch wenn sich, wie Thomas Rahe schreibt,
heute eine Hierarchisierung der Opfer im Gedenken verbietet, so real war doch die Häftlingshierarchie im Konzentrationslager sowohl hinsichtlich der verfolgten Gruppen als
auch der Nationalitäten – eine Hierarchie, die in kaum zu unterschätzender Intensität die
Lebenssituation des einzelnen Häftlings bis hin zu seinen Überlebenschancen prägte.66
Die Kapos, die auch von Miloš häufig erwähnt werden, standen den „Arbeitskommandos“ vor. Sie waren „selbst von der Arbeit befreit“ und standen wie auch „Blockälteste und Lagerälteste (…) unter dem Schutz der Lagerführung“: es war also von fundamentaler Wichtigkeit, von diesen Personen akzeptiert zu werden.67 Die besondere
Macht der Kapos schildert auch Miloš u.a. in seiner Erzählung zur Häftlingsküche, die
61
Ebd., S. 101.
62
Jörg Skriebeleit, Flossenbürg – Stammlager, S. 51.
63
Alexander Schmidt, Happurg und Hersbruck, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel (Hrsg.), Der Ort des
Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen,
Ravensbrück, München 2006, S. 136–140, S. 138.
64
Jörg Skriebeleit, Flossenbürg – Stammlager, S. 51 u. Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, S. 122.
65
Hermann Langbein, … nicht wie die Schafe zur Schlachtbank. Widerstand in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern 1938–1945, Frankfurt a.M. 1980, S. 31.
66
Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 95.
22
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
von polnischen Kapos mit polnischen Häftlingen geführt wurde. Er als Jugoslawe konnte damit bei der Essensausgabe ohne Schwierigkeiten einfach übergangen werden, da er
in diesem Moment nicht über den Schutz dieser Gruppe verfügte (III, 20). Wie es bei
Langbein in einem Zitat von Himmler heißt, sollten bei der Wahl von Kapos auch gezielt „eine Nation gegen die andere ausgespielt [werden]“.68 Miloš als Serbe oder Jugoslawe war im KZ-Komplex Flossenbürg Teil einer, mit Verweis der Gedenkstätte auf
die Nummernbücher, relativ kleinen und daher nicht sehr einflussreichen Gruppe.69
Auch war die Wahrnehmung der jugoslawischen Häftlinge von Seiten vieler Mithäftlinge dadurch geprägt, dass sie die Gruppe durch die vielen unterschiedlichen ethnischen
Zugehörigkeiten der Mitglieder nicht als besonders homogen wahrnahmen,70 was den
Grad des Zusammenhalts möglicherweise ebenfalls beeinflusst haben könnte. Für Miloš
wurde es daher wichtig, auch von anderer Seite Schutz zu erhalten. Diese Schutzfunktion übernahm in seinem Fall eine Gruppe von russischen Häftlingen (III, 5).
Während der Zeit, die Miloš in Hersbruck interniert war, waren die Bedingungen im
Lager katastrophal, „fast jeder zweite Häftling [überlebte] den Winter 1944/45 (…)
nicht“, an manchen Tagen starben bis zu 30 Menschen an den Bedingungen der Lagerhaft oder durch Gewalt.71 Die Arbeitsbedingungen im Stollen waren extrem gefährlich
und im Lager waren die Häftlinge Überfüllung, Krankheiten und der Brutalität der Wachen schutzlos ausgeliefert.72 Am 7. April 1945 begann schließlich die Evakuierung des
KZ-Außenlagers Hersbruck. Diejenigen die nicht mehr in der Lage waren zu laufen,
wurden mit Zügen in das KZ Dachau gebracht, die übrigen, mehr als 3000 Häftlinge,
67
Hermann Langbein, … nicht wie die Schafe zur Schlachtbank, S. 31.
68
Ebd., S. 32.
69
Auskunft des Archivs der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: Für das KZ Flossenbürg und seine Außenlager lässt sich mit Bezug auf die jugoslawischen Häftlinge eine Zahl von 1.952 Inhaftierten feststellen.
Ihre Bezeichnung als Jugoslawen bezieht sich auf die Herkunft aus jugoslawischem Territorium während
des Zweiten Weltkriegs.
70
Hermann Langbein, … nicht wie die Schafe zur Schlachtbank, S. 186.
71
Alexander Schmidt, Happurg und Hersbruck, S. 138.
72
Ders., Das KZ-Außenlager Hersbruck, S. 107.
23
IOS-Mitteilung Nr. 61
wurden auf einen Todesmarsch mit dem gleichen Ziel getrieben.73 Diese an vielen Orten
ergriffene Maßnahme, die für viele der geschwächten Häftlinge endgültig den Tod bedeutete, war wohl auch aus der Absicht der SS hervorgegangen, die übriggebliebenen
Häftlinge nicht in die Hände der Alliierten fallen zu lassen.74 Wie Miloš schildert, war
die Lage verzweifelt, die meisten Häftlinge hatten nicht mehr die Kraft sich fortzubewegen, es gab nichts zu essen. Sie ernährten sich von Schnecken, um zu überleben.
Nach etwa 30 km war die Gruppe, in der sich Miloš auf dem Todesmarsch befand, nicht
mehr in der Lage weiterzugehen (III, 21–22).
Die ersten Häftlinge aus Hersbruck erlebten am 10. April 1945 die Befreiung durch
anrückende amerikanische Truppen.75 Zu dieser ersten Gruppe gehörte vermutlich auch
Miloš. Welche Dimensionen der Grausamkeit Miloš während seiner Haft überlebte,
zeigt sich an den folgenden Zahlen: Den Verhältnissen im KZ-Außenlager in Hersbruck
fielen während der extrem kurzen Zeit seines Bestehens von kaum einem Jahr mehr als
4000 Häftlinge zum Opfer.76 Für den gesamten Lagerkomplex Flossenbürg sind die
Zahlen noch wesentlich erschreckender:
In den sieben Jahren seines Bestehens waren über 100 000 Häftlinge im KZ Flossenbürg
und dessen Außenlagern interniert. Durch gezielte Tötungen, die katastrophalen Lebensbedingungen und das Inferno der Todesmärsche kamen im Komplex des KZ Flossenbürg
mehr als 30 000 Menschen um.77
Miloš erkrankte noch nach der Befreiung an Flecktyphus und musste mehrere Monate gepflegt werden, bevor er weiter geschickt werden konnte. Nach seiner Genesung
kam er für kurze Zeit nach Regensburg, dann nach München, von wo aus er vermutlich
in der zweiten Jahreshälfte 1945 zusammen mit einer kleinen Gruppe Jugoslawen mit
dem Zug nach Jugoslawien zurückkehrte (III, 24).
73
Ebd., S. 104.
74
Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 85.
75
Alexander Schmidt, Das KZ-Außenlager Hersbruck, S. 104.
76
Ebd., S. 104.
77
Jörg Skriebeleit, Flossenbürg – Stammlager, S. 57.
24
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
3.4 Rückkehr und das Leben nach 1945
Über verschiedene Stationen kehrte Miloš schließlich in sein Heimatdorf in der
Vojvodina zurück, zusammen mit drei weiteren Überlebenden aus seinem Dorf. Zwei
Männer ihrer Gruppe hatten in Hersbruck ihr Leben verloren (III, 27). Zunächst blieb er
in seinem Dorf und musste seinem Stiefvater, den seine Mutter während seiner Abwesenheit geheiratet hatte, auf dem heimischen Hof helfen. Wegen seiner angegriffenen
Gesundheit holte ihn dann jedoch der Bruder seines Vaters zu sich in die Stadt, nach
Novi Sad. Dort machte er den Führerschein und wurde Fahrer (III, 26).
Die Zeitspanne nach 1945 konnte im Interview aus Zeitgründen nur noch ansatzweise abgedeckt werden. Was jedoch auch aus Gesprächen mit Milošs Betreuer deutlich
wurde, ist, dass Miloš im ehemaligen Jugoslawien keinerlei Anerkennung von staatlicher Seite für seine KZ-Haft erhielt. Daran wird deutlich, dass Miloš als Überlebender
der nationalsozialistischen Konzentrationslager zu einer Gruppe gehört, an deren Erinnerungen besonders in der jugoslawischen Öffentlichkeit wenig bis kein Interesse bestand.78 Nach dem Krieg wurde das „was ‚erinnert‘ und was vergessen werden sollte“
von der Kommunistischen Partei unter Tito entschieden,79 wodurch die Erinnerungskultur der Nachkriegszeit stark geprägt war von einem „Gedächtnis der Sieger“.80 Im Kontext dieses Verständnisses vom aktiven Volksbefreiungskampf hatte das „Überleben im
Lager zu Kriegszeiten“ einen schweren Stand.81 In politischer Hinsicht bestand nur mäßiges Interesse und auch nur dann, wenn politische Gründe zur Verhaftung geführt hatten und der Aufenthalt im KZ nachweislich von politischem Widerstand bestimmt war.
Erst 1951 wurde im Veteranenbund eine Abteilung für ehemalige Kriegsgefangene und
eine für Deportierte und Internierte eingerichtet, wohl auch als Reaktion auf derartige
Entwicklungen im Ausland, jedoch ging es zu keinem Zeitpunkt darum, die leidvollen
78
Heike Karge, Steinerne Erinnerung – versteinerte Erinnerung? S. 170.
79
Holm Sundhaussen, Die „Genozidnation“, S. 358.
80
Natalija Bašić, „Wen interessiert heute noch der Zweite Weltkrieg?“ Tradierung von Geschichtsbewusstsein in Familiengeschichten aus Kroatien und Serbien, in: Harald Welzer (Hrsg.), Der Krieg der
Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedächtnis, Frankfurt a.M. 2007,
S. 150–185, S. 151.
25
IOS-Mitteilung Nr. 61
Erfahrungen der Überlebenden zu beschreiben, sondern ausschließlich ihren heldenhaften Widerstand.82 Auch nachdem man begonnen hatte, die Überlebenden der Konzentrationslager als Teil des Volksbefreiungskampfes zu erinnern, die nicht aufgrund von
politischen Gründen verfolgt worden waren, tat man dies in Form von Heldenverehrung, nicht die Opferaspekte ihrer Biographie interessierten.83 Auch heute noch engagiert sich Miloš im serbischen Veteranenverein. Doch wie wiederum aus Aussagen des
Betreuers zu schließen ist, spielt Milošs Geschichte dort bis heute keine zentrale Rolle,
bzw. wird von diesem Verein erst seit kurzem entdeckt (III, 28–29).
Nachdem das Lagerareal des KZ Flossenbürg über viele Jahrzehnte fast völlig vergessen wurde, lud der Freistaat Bayern im Jahr 1995 zum ersten Mal zu einer staatlichen Gedenkfeier, in deren Folge eine ganze Reihe von Gedenkveranstaltungen ins Leben gerufen wurden.84 Auch 2010, 65 Jahre nach der Befreiung von Flossenbürg, fand
eine große Gedenkfeier statt – etwa 100 ehemalige Häftlinge reisten dafür an.85 Auch
Miloš nahm an diesen Feierlichkeiten teil. Zuvor hatte er Flossenbürg bereits zwei Mal
in Begleitung seiner Schwester besucht, doch aufgrund fehlender Sprachkenntnisse,
konnten sie beide nicht wirklich am Gedenken teilhaben (III, 1). Eine zentrale Rolle in
Milošs Aktivwerden als Zeitzeuge, nimmt daher sein Betreuer ein, der Englisch spricht
und Miloš dadurch aktiver an der Erinnerungsarbeit teilhaben lassen kann. Er begleitet
Miloš seit dessen drittem Besuch in Flossenbürg bei der jährlichen Reise und nimmt
auch dokumentarische Filme auf, in denen Miloš von seinen Erfahrungen erzählt (III, 1,
II, 12). Seine Bezeichnung in dieser Arbeit ohne Namen, nur als ‚Betreuer‘, ist aber
durchaus nicht zufällig gewählt, sondern der Tatsache geschuldet, dass der Betreuer
zwar jede Anstrengung unternahm, um dem Zeitzeugen die Möglichkeit zu geben seine
81
Heike Karge, Steinerne Erinnerung – versteinerte Erinnerung?, S. 178.
82
Ebd., S. 173–174.
83
Ebd., S. 182.
84
Annette Kraus, Hinterlassenschaften. 1995–2010, in: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Hrsg.), Was bleibt –
Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg. Katalog zur Dauerausstellung, Flossenbürg 2011,
S. 160–163, S. 160.
85
Jörg Skriebeleit, Vorwort, in: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Hrsg.), Was bleibt – Nachwirkungen des
Konzentrationslagers Flossenbürg. Katalog zur Dauerausstellung, Flossenbürg 2011, S. 9–13, S. 9.
26
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Lebensgeschichte präsentieren zu können, selbst dabei aber deutlich im Hintergrund
blieb. Dies zeigt sich auch daran, dass er selbst einem Interview über seine Verbindung
zum Zeitzeugen nicht zustimmen wollte.
Die bisher vorgestellten Aspekte zu Milošs Biographie sollten nicht nur zeigen, welche historischen Entwicklungen für sein Leben bestimmend waren, sondern, neben einer ausführlicheren Schilderung der Bedingungen in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Hersbruck, auch dabei helfen, den lebensgeschichtlichen Hintergrund des
Zeitzeugen besser zu verstehen, da dieser auch der Rahmen für seine KZ-Erfahrung ist,
welche im Folgenden näher analysiert werden soll.
27
IOS-Mitteilung Nr. 61
4 Erinnerung und ‚erinnerte Erinnerung‘ an die nationalsozialistische Verfolgung
4.1 Das KZ Flossenbürg in der Erinnerung des Überlebenden Miloš
Wie bereits im Kapitel zur theoretischen Vorgehensweise dargelegt, soll es im Folgenden um eine Analyse der Lebensgeschichte des Zeitzeugen gehen. Wie auch Ulrike
Jureit betont, geht es bei einer solchen Analyse nicht darum, die interviewte Person zu
analysieren oder einzuordnen, sondern rein um die Analyse der lebensgeschichtlichen
Erzählung und die Präsentationsformen, die in dieser deutlich werden.86 Zunächst soll
untersucht werden, welche Motive in Milošs Erzählungen zu seiner Zeit im Konzentrationslager besonders stark hervortreten und wie er sie präsentiert. Daran anschließen
soll sich mit Hinblick auf seine ganze Lebensgeschichte die Frage, welche Faktoren zu
dieser oder jener Darstellungsweise führen, d.h. ob bestimmte Erzählungen unter Umständen funktionalisiert werden, um gesellschaftlichen oder anderen Rahmen entsprechen zu können. Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, wie der Zeitzeuge
im Rahmen seiner Lebensgeschichte mit der KZ-Erfahrung umgeht.
Bezeichnend für Milošs Lebensgeschichte, ist die Zentralität seiner KZ-Erfahrung.
Gleich zu Beginn des Interviews, auf die Frage nach seiner ganzen Lebensgeschichte,
fragt Miloš: „Životu ili logoru – ?“ 87 (I, 1), also ob er über sein Leben oder seine Zeit
im Konzentrationslager erzählen soll. Er versteht sich damit ganz selbstverständlich als
Autorität für die KZ-Erfahrung, nach der er wohl auch am häufigsten gefragt wird und
vergewissert sich, dass der Interviewer tatsächlich auch an seinem restlichen Leben interessiert ist. Die Reaktion des Zeitzeugen kann damit sehr wohl auch daher rühren,
dass er einfach davon ausgeht, dass ein Interview für eine geschichtswissenschaftliche
Arbeit sehr wahrscheinlich an diesem bestimmten Aspekt seiner Biographie interessiert
ist. Ähnliches beschreibt Ulrike Jureit in Zusammenhang mit einem Projekt der
KZ-Gedenkstätte Neuengamme, wo einige Zeitzeugen, trotz der lebensgeschichtlich
86
Vgl. dazu: Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 377.
28
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
ausgerichteten Fragestellung, davon ausgingen, die KZ-Erfahrung sei für die Interviewer zentral. Damit befolgten sie im Prinzip völlig ungefragt ein bestimmtes „Rollenverhalten“.88 Dennoch sagt auch diese Reaktion viel darüber aus, wie sich der Zeitzeuge
selbst sieht und welch große Bedeutung er der KZ-Erfahrung in seinem Leben einräumt.89 So ordnet er seine Lebensgeschichte ganz selbstverständlich einem größeren
Thema unter: Was in einem Interview von seiner Lebensgeschichte erwartet wird, sind
keine Erzählungen über die Kindheit oder das Leben nach 1945, sondern über seine KZErfahrung. Dies zeigt sich auch an mehreren Stellen im Interview, an denen Miloš zu
Flossenbürg heute und der Gedenkstätte gefragt wird, darauf auch zu antworten beginnt,
dann aber direkt wieder auf Erinnerungen aus der Lagerhaft zurückfällt. Auch wenn der
Betreuer versucht, ihn direkt wieder zurück auf die ursprüngliche Frage zu lenken,
scheint für ihn beim Thema Flossenbürg die frühere Erfahrung deutlich näher zu sein
(III, 3). Auch wenn die Zeit nach 1945 / 46 in den Interviews, wie bereits erwähnt, nicht
mehr ausführlich zur Sprache kommen konnte, wird so auch deutlich, dass der Zeitraum
zwischen Verhaftung, Lagerhaft im KZ und der Befreiung, der etwa ein Jahr seines Lebens umfasst, den Großteil seiner lebensgeschichtlichen Erzählung einnimmt. Während
man sich im Interview noch bei Themen befand, die der Lagerhaft vorausgingen, wurde
ein gewisser Drang deutlich, zur Flossenbürg-Erfahrung voranzuschreiten (III, 1). Als
man diese dann abgedeckt hatte, wurde die Stimmung wesentlich entspannter, als
wäre nun alles Wichtige gesagt. Ein solches „Ungleichgewicht in dem Lebensrückblick“ beschreibt Jureit nachweislich als häufiges Merkmal von Interviews mit Überlebenden der Konzentrationslager.90
Neben dieser Zentralität der Verfolgungserfahrung in den Interviews überhaupt, treten bei der genaueren Analyse der Transkripte zudem mehrere Motive hervor, die für
Miloš den Lageralltag besonders bestimmt zu haben scheinen. Ein solcher Aspekt, der
in Milošs Lebensgeschichte in Verbindung mit den Konzentrationslagern Flossenbürg
87
„Vom Leben oder über das Lager – ?“
88
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 115 u. S. 96.
89
Ebd., S. 179.
29
IOS-Mitteilung Nr. 61
und Hersbruck auftaucht, ist der Verlust jeglicher Selbstbestimmung. Dies drückt sich
auch darin aus, dass die erste Erinnerung, die er auf die Frage nach einer spontanen Assoziation mit Flossenbürg nennt, seine Ankunft im Lager ist. Innerhalb weniger Minuten schildert er daraufhin seine gesamte Leidensgeschichte, von der Ankunft in Flossenbürg, über die Zeit in Hersbruck bis zum Todesmarsch in Richtung Dachau und die
Befreiung durch die Amerikaner (II, 16–17). Diese Beschreibung mag auf den ersten
Blick wie eine gehetzte Aneinanderreihung der Lagerereignisse aussehen, die er zudem
sicherlich bereits oft erzählt hat, da sie etwas einstudiert wirkt. Dennoch wird an ihr
deutlich, wie sich mit jedem Schritt, den er sich von zuhause wegbewegte, seine Lage
kontinuierlich verschlechterte. Im Vergleich zu den beiden ungarischen Lagern, in denen er zuvor interniert war und in denen er sich in einem bekannten Umfeld wohl relativ frei bewegen konnte (II, 12), muss der Kontrast bei der Ankunft in Flossenbürg besonders einprägsam gewesen sein. Von einem Moment zum nächsten, so beschreibt er
es, wurde ihm plötzlich bewusst, dass es ums Überleben ging (II, S. 16). Bei Ulrike
Jureit heißt es zur Ankunft der Häftlinge in den Konzentrationslagern:
Mit der Einlieferung ins Lager waren die Betroffenen im Zustand völliger Wehrlosigkeit
einer für sie zeitlich nicht absehbaren Inhaftierung ausgesetzt. Die Lagerhaft beinhaltete
eine lebensbedrohende Gesamtlage mit erschöpfender Zwangsarbeit und kaum vorhersehbaren Strafen für nicht zufriedenstellende Leistungen. (…) Jeder einzelne erfuhr individuelle Demütigungen und Degradierungen sowie systematische Beeinträchtigungen der
persönlichen Identität und des Selbstwertgefühls. Es kam zum Verlust individueller und
kollektiver Normen. (…) Der einzelne erfuhr seine eigene Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht angesichts systematischer Vernichtung.91
Der Schnee und die Kälte, die Orientierungslosigkeit, und die körperliche Gewalt,
das Chaos, dem sie nach Verlassen der Transportwagen in Flossenbürg ausgesetzt waren, kann von Seiten des Zeitzeugen daher auch als Ausdruck des Verlusts jeglicher
Autonomie und Selbstständigkeit verstanden werden. Bei seiner Ankunft konnte er
90
91
Ebd., S. 174–175.
Ebd., S. 119–120.
30
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
zwar noch nicht wissen, was genau ihn erwarten würde, aber rückblickend wird die Ankunft zum Inbegriff des Kontrollverlusts. Während er sich in den Erzählungen zuvor als
sehr selbstsicher und stets die Initiative ergreifend präsentierte, besonders im Rahmen
seiner Aufgaben für die Volksbefreiungsbewegung (II, 8) und auch bei der Schilderung
seiner Verhaftung, die sehr kühl und emotionslos wirkt (II, 10), nimmt diese Haltung
bei der Schilderung seiner KZ-Haft schlagartig ab, und verdeutlicht, wie er zunehmend
von der Willkür seiner Umgebung abhängig wird. Der Übergang der Erzählung auf die
Zeit in Hersbruck schließt somit ebenfalls mit einer inneren Logik an, da seine Aufgaben und Lebensbedingungen mit seiner Verlegung dorthin noch schwerer und unberechenbarer wurden. Die Dimension seines Leidens drückt er später in einer Erzählung
aus, in der er sie mit den Leiden Jesus Christi auf dem Kreuzweg vergleicht:
Onda sam u sebi pomislio kako je Istus Hristus nosio krs na leđi i tukli ga i mučili tako su
nas SSovci tuku da to moramo odnjeti pa se molim Bogu u sebi hoću li izdržati da mogu
da odnesem da preživim to. I tako sam kad treba da se nosi najviše se sećam Isusa Hrista
kako je nosio krs i kako je patio i mučen bio to sam ja sebi uzeo u moje i da sam i ja
pačen kao Isus.92 (III, 11)
Ein weiteres Motiv in seiner Erzählung zu Flossenbürg stellen verschiedene Strategien
oder Verhaltensweisen dar, die ihm das Überleben ermöglichten. Darunter fallen die Aspekte ‚Nahrung‘, ‚Kleidung‘ und ‚Arbeit‘, aber auch ‚Hilfe durch andere‘, die nun vorgestellt werden sollen. Die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern bedeuteten, dass die
Häftlinge besonders durch die Schwächung aufgrund der auszehrenden körperlichen Arbeit und durch Krankheiten bedroht waren.93 Einer ausreichenden Ernährung kam deshalb
eine extrem wichtige Rolle zu. Die Verpflegung in den Lagern war jedoch zumeist nicht
92
„Dann stellte ich mir vor wie Jesus Christus das Kreuz auf dem Rücken trug und sie ihn schlugen und
marterten, so haben uns die SS-Leute geschlagen, dass wir das fortschleppen mussten und ich betete zu
Gott, dass ich es aushalte, dass ich es forttragen kann, dass ich das überleben kann. Und so habe ich,
wenn man es am meisten ertragen musste, an Jesus Christus gedacht wie er das Kreuz trug und wie er litt
und gemartert wurde, das habe ich mir in meins genommen und dass auch ich gequält werde wie Jesus.“
93
Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, S. 142.
31
IOS-Mitteilung Nr. 61
ausreichend, um dies zu gewährleisten.94 Es ging für einen Häftling wie Miloš, der wohl
die meiste Zeit unter Hunger leiden musste, und vom Lageressen allein nicht ausreichend
Kraft erhielt, in erster Linie darum, zusätzliches Essen aufzutreiben. In den Interviews
wird deutlich, wie zentral Nahrung für die Häftlinge wurde, so zentral, dass normales
menschliches Verhalten zeitweise völlig aussetzen konnte. Miloš beschreibt in diesem
Zusammenhang, wie sie nachts auf ihren Betten darauf warteten, dass das Licht gelöscht
wurde, um dann denen, die gerade von der Arbeit zurückgekommen waren, das Essen zu
stehlen. Wie bedeutend dieser Vorgang war, wird auch daran deutlich, dass Miloš in dieser Erzählung plötzlich von „mi“ / wir zu „ja“ / ich und „vas“ / euch wechselt:
Čekamo da se ugasi svetlo, čim se ugasilo svetlo, ja sam ispred vas ukrao vašu misku i
vaše jelo i ja pojeo (...) i vi ste ostali gladni a ja sam pojeo.95 (III, 4)
Zwischen den Häftlingen, so Miloš, habe das Gesetz des Stärkeren gegolten, allerdings beschreibt er das ganz pragmatisch als „Technik“. Sich durchzusetzen, notfalls
auch mit Gewalt, wurde nötig, um überleben zu können:
Nije bila sporazuma. Ako je nešto bilo koji je jači otimaš ti ruku, buni se i [Geräusch:
dum] i zdravo. To je bila tehnika, zakon jačeg. Čovek nije više bio čovek, već je vladala
snaga da živ čovek od čoveka otimao iz ruke pa će zaloga je da je uzmeš.96 (III, 4)
Ein weiteres Beispiel für die zentrale Rolle, die der Verpflegung zukam, ist die Beschreibung seines Aufenthaltes in der Krankenbaracke. Gegen Ende seiner Haftzeit erkrankte er an Dysenterie und wurde in die Krankenbaracke des Lagers geschickt, wo
jedoch entsetzliche Zustände herrschten (III, 18–19). Ein Mann, der ihm bekannt war,
riet ihm, dort nichts zu essen, aber Miloš ignorierte seine Warnung mit dem Hinweis,
lieber mit vollem als mit leerem Magen sterben zu wollen. Um eine größere Ration zu
94
Ebd., S. 126.
95
„Wir warten, dass das Licht gelöscht wird, sobald das Licht gelöscht ist, habe ich vor euch eure Schale
geklaut und euer Essen und verspeiste es (...) und ihr seid hungrig geblieben und ich habe aufgegessen.“
96
„Es gab keine Verständigung, wenn etwas war, der der stärker ist, du nimmst es in die Hand, lehnst
dich auf und [Geräusch: dum] und gut. Das war die Technik, das Gesetz des Stärkeren. Der Mensch war
nicht mehr Mensch, sondern die Stärke herrschte, dass der lebendige Mensch von einem Menschen aus
der Hand raubte und ...(?).“
32
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
erhalten, meldete er zudem den Tod seines Bettnachbarn zwei Tage lang nicht, um auch
dessen Essenszuteilung zu erhalten. Nachdem der Tote abgeholt worden war, findet er
auf dessen Seite der Pritsche altes Brot und ein Messer mit der Aufschrift „Sarajevo“.
Doch die Verbindung zur Heimat Jugoslawien scheint hinter der Bedeutung des Brotes
und der Notwendigkeit zu essen zurückzutreten. Da er kräftiger war als die anderen
Kranken, konnte er ihnen von draußen Wasser aus einem Brunnen holen und erhielt für
diesen Dienst auch noch ihre Verpflegung im Tausch. Tatsächlich verbesserte sich sein
Gesundheitszustand innerhalb von zehn Tagen deutlich und er vertritt die feste und
mehrfach geäußerte Meinung, dass das qualitativ hochwertigere Essen und die vielen
zusätzlichen Rationen in der Krankenbaracke ihn gerettet haben: „Od jela je stala
dizenterija“ 97 (III, 19). Nach seinem Aufenthalt in der Krankenbaracke, wurde er zur
Küchenarbeit eingeteilt. Die Verhältnisse in der Lagerküche wurden bereits während
der Rekonstruktion der Biographie kurz angesprochen. Miloš erinnert sich, dass in der
Küche neben ihm ausschließlich Polen gearbeitet hätten, unter der Aufsicht von polnischen Kapos. Als er die angesetzte Menge Kartoffeln bis zum Mittag nicht geschält
hatte, bekam er als einziger, obwohl andere das Soll auch nicht erfüllt hatten, Schläge
anstelle der Verpflegung (III, 20). Die Existenz solcher, durch nationale Zugehörigkeit
gekennzeichneten, Gruppen, wurde für Miloš in diesem Fall zu einer lebensbedrohenden Gefahr. Die Verweigerung von Nahrung konnte in der Realität des Lagers zum Todesurteil werden. So wurde auch die Gefahr bei einem Diebstahl erwischt zu werden zu
einem einkalkulierbaren Risiko. Er schmuggelte rohe Kartoffeln in seinen Ärmeln vorbei an den Kapos und aß sie auf dem Abort. Auch seine einzige Erinnerung an Einheimische im Umfeld des Lagers steht in Verbindung mit Nahrung: Eine Gruppe Menschen, die er aus der Ferne beim Schlachten eines Schweins beobachtete (III, 12). Das
Erhalten von Nahrung wurde für ihn für die Zeit im Lager zum Lebensinhalt, was sich
auch auf seine Erinnerung an die Zeit übertragen hat, da diese Passagen besonders ausgeprägt geschildert werden. Wie auch Irith Dublon-Knebel in einer Untersuchung von
Berichten von Überlebenden des Holocaust feststellt, sind
97
„Vom Essen hörte die Dysenterie auf.“
33
IOS-Mitteilung Nr. 61
die Angaben (…) dann am genauesten, wenn sie Bereiche betreffen, in denen es um das
unmittelbare Überleben ging. Auf die Frage nach den Namen der SS-Männer sagte die Zeugin: ‚Namen von Kommandanten etc. kenne ich nicht, da sich niemand mehr für irgend etwas anderes interessierte als für Essen‘.98
In Anbetracht der schweren körperlichen Arbeit bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit, kam dem Aspekt Kleidung für Miloš eine ähnlich wichtige Rolle zu, wie der
ausreichenden Ernährung. Miloš kam während des Winters in die KZ Flossenbürg und
Hersbruck, wo sie mit für die Jahreszeit viel zu dünner Kleidung ausgestattet werden
(II, 16). Spoerer beschreibt, dass KZ-Häftlinge generell „den typischen Anzug aus gestreiftem Drillich“ trugen, der jedoch keinerlei Schutz vor der Witterung bot.99 Noch
problematischer, mit Blick auf die Arbeitseinsätze war jedoch unzureichendes oder fehlendes Schuhwerk. So erklären sich auch eine Reihe von Milošs Erzählungen, in denen
es um gestohlene oder kaputte Schuhe geht. Von ihm selbst kommt der Vorschlag davon zu erzählen, wie er einem italienischen Häftling die neuen Schuhe klaute, nachdem
seine nur noch aus Fetzen bestanden. Das ganze Unternehmen klingt äußerst waghalsig:
Miloš spähte bessere Schuhe aus, pirschte sich an, schnitt mit dem angespitzten Löffel
in die Kleiderrolle unter dem Kopf des Italieners und zog die Schuhe heraus. Dann
musste er im Dunkeln den Weg zurück zu seinem Bett finden. Doch keiner der anderen
Häftlinge hielt ihn auf und so kam er in den Genuss neuer Schuhe (III, 10).
Ein weiterer Aspekt der für das Überleben im Lager von zentraler Bedeutung war, und
der in Milošs Erzählungen deutlich hervortritt, ist der der ‚Arbeit‘. Um überleben zu können, musste er die Arbeiten, die ihm zugeteilt wurden, einwandfrei auszuführen, absoluter
Gehorsam war notwendig. Zwar wurden längere Anweisungen mit Dolmetschern kommuniziert (II, 16), die generellen Befehle und Anweisungen, auf die sofort reagiert werden
musste, wurden jedoch laut Miloš sowohl von den Wachen als auch von den Kapos auf
98
Irith Dublon-Knebel, Transformationen im Laufe der Zeit. Re-Präsentationen des Holocaust in Zeugnissen der Überlebenden, in: Insa Eschebach / Sigrid Jacobeit / Silke Wenk (Hrsg.), Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids, Frankfurt a.M. / New
York 2002, S. 327–342, S. 329.
99
Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, S. 137–138.
34
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Deutsch gegeben (III, 4). Miloš reagiert so auch mit Unverständnis auf die Frage wie sie
denn untereinander kommuniziert hätten. Dies scheint für ihn keine Frage im Lageralltag
gewesen zu sein. Kommunikation zwischen Verantwortlichen und Häftlingen fand in seiner Wahrnehmung nur in Form von Befehlen statt. Wie tief sich diese Befehle eingegraben haben, zeigt sich darin, dass Miloš, Ausdrücke wie z.B. „Kartoffel schäle“, nach so
vielen Jahren noch immer wiedergeben kann, obwohl er gar kein Deutsch spricht. In diesem Zusammenhang beschreibt er auch, wie er den Befehl hörte und dann im Prinzip aus
den Handlungen des Kapos auf die Aufgabe schließen musste. Neben der Bedrohung
durch die Aufseher bei ungenügender Arbeit, war er auch durch die harte Arbeit selbst
bedroht. Besonders die Arbeit im Stollen war zermürbend und schädigte u.a. auch sein
Gehör. Dennoch beschreibt er auch sie sehr ausführlich und mit vielen technischen Details, nimmt beispielsweise Bezug auf die genaue Beschaffenheit der Stollenanlage in der
Nähe von Hersbruck. Emotionen fehlen hingegen weitgehend (III, 7). Diese Genauigkeit
in der Beschreibung kann zum einen als Indiz dafür verstanden werden, dass Miloš
glaubwürdig erscheinen möchte, er möchte zeigen, dass er Bescheid weiß und nichts vergessen hat (III, 27).100 Zum anderen ist es aber auch ein Hinweis darauf, dass er trotz der
Natur der Zwangsarbeit, eben doch auch eine Würdigung seiner harten Arbeit erwartet.
Dazu passt, dass er an anderer Stelle betont, dass in seiner Heimat Serbien nicht nur das
„Lager“ sondern auch ihre „Arbeit“ vergessen worden sei (III, 29). Was sich in dieser,
aber auch in den zuvor geschilderten Lebensnotwendigkeiten spiegelt, ist die verkehrte
Welt des Lagers. Um unbedingten menschlichen Bedürfnissen, wie Nahrung und
Kleidung, nachkommen zu können, war Miloš gezwungen, sich nach den Standards
der Außenwelt gegen die Regeln zu verhalten. Besonders die Episoden, in denen er
die diversen Diebstähle schildert, machen dies deutlich. Für die Welt des Lagers waren
seine Vorgehensweisen jedoch absolut nachvollziehbar und normal. Mark Spoerer
schreibt: „Diebstahl und Verrat waren in den Lagern weit verbreitet, weil der quälende
100
Zur Thematik der „Formzwänge des Erzählens“ vgl.: Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 96.
35
IOS-Mitteilung Nr. 61
Hunger stärker als die Solidarität war“.101 Zugleich zeigt Milošs Handeln aber auch
die Verkehrung der Normalität ins Gegenteil. Miloš verhält sich in den geschilderten Situationen entgegen normalen menschlichen Verhaltens, aber genau dieses Anti-Verhalten
sichert sein Überleben.102
Ein weiterer zentraler Aspekt für den Zeitzeugen ist der Aspekt ‚Hilfe durch andere‘.
Dieser Aspekt, der wie bereits bei den zuvor angesprochenen Motiven, das Erhalten
zusätzlicher Nahrung und leichtere Arbeit in seinem Kern trägt, ist dahingehend interessant als dass er den Erwartungen eines Häftlings im Lager eigentlich größtenteils widerspricht. Zum einen waren die Häftlinge immer in Gefahr, zum Opfer der alltäglichen
Brutalität der Aufseher zu werden. Dies zeigt sich auch in Milošs Charakterisierung der
SS-Wachen, die er immer wieder mit den gleichen Worten beschreibt: „Kapija otvorena
SSovci s jedne strane i s druge korbače i tuku nas da ulazimo unutra“ und „kako
nas maltretiraju, tuku, (?) kidaju, deru se, postrojavaju nas“ (III, 13).103 Zum anderen
konnten die Häftlinge aber auch nie sicher vor ihren eigenen Mithäftlingen sein. Zum
Stichwort „Häftlingssolidarität“ schreibt Ulrike Jureit es sei
nicht gesagt, es habe in den Konzentrationslagern keinen Zusammenhalt unter den Häftlingen gegeben, nur seine Verbreitung muss angesichts des herrschenden Überlebenskampfes differenzierter betrachtet werden. In der Überbetonung der Solidarität steckt eine
Ausblendung der Gegebenheiten, die für die Masse der Gefangenen den Tod bedeuteten.
Diejenigen, die wir heute interviewen, haben häufig von solidarischer Hilfe profitiert beziehungsweise waren selbst in derartigen Zirkeln aktiv, ihre Erzählungen können aber
nicht als repräsentativ gelten.104
So war es für Häftlinge wie Miloš überlebenswichtig, sich der Unterstützung anderer
Häftlinge sicher zu sein, was schon aus kommunikationstechnischen Gründen wohl sehr
101
Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, S. 134.
102
Vgl. dazu: Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 124.
103
„Das Tor öffnete sich, die SS-Leute auf der einen Seite und der anderen, mit Peitschen und sie
schlugen uns, dass wir hineingehen.“ und „Wie sie uns malträtierten, schlugen, rissen, brüllten, uns antreten lassen.“
104
36
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 397.
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
oft zu nationalen Gruppenbildungen führte. Auch Miloš scheint sich in der Gruppe der
serbischen bzw. jugoslawischen Häftlinge bewegt zu haben (III, 5), wobei diese in den
Erzählungen sehr konturlos bleibt, möglicherweise auch aufgrund der bereits angesprochenen geringen Zahl an Häftlingen aus dieser Region. Was in Milošs Erzählungen jedoch sehr viel ausführlicher behandelt wird, ist die Unterstützung, die Miloš von einer
anderen nationalen Gruppe aus seiner Baracke erhielt, nämlich einer Gruppe von russischen Häftlingen. Ihre Hilfe erscheint Miloš heute immer noch wie ein Wunder: „Za
svoje vreme logora Rusi su me hranili krumpirom u večer“ (III, 5).105 Dass ihm ausgerechnet eine Gruppe von Russen zu essen gab, ist von daher signifikant, da Russen allgemein in den Konzentrationslagern, mit Ausnahme der jüdischen Häftlinge, die von
der Aufsicht am meisten diskriminierte Gruppe darstellten.106 Wie wichtig ihre Hilfe für
Miloš war, zeigt sich in der Erzählung, in der er Ivan, einem der Russen, die Schuhe
klaut. Er beschreibt zunächst, wie er praktisch zu dieser Tat gezwungen wurde, da jemand anders seine Schuhe geklaut hatte, er aber zur Arbeit hinaus in den Schnee musste. Dann schildert er jedoch, wie er von den Russen beim Diebstahl erwischt wird und
die Schuhe zurückgeben muss. Die zuvor geschilderte Not, ohne Schuhe zur Arbeit gehen zu müssen, wird nun abgelöst durch die sehr viel größer erscheinende Angst, die
Russen könnten ihm nun keine Kartoffeln mehr geben (III, 5–6).
Eine weitere Erzählung von Unterstützung im Lager handelt von einem tschechischen Vorarbeiter im Stollenbauprojekt und beginnt etwa zwei Monate vor der Befreiung (III, 14–15). Auch in dieser Erzählung zeigt sich wieder, wie der Gegensatz von
normalem Verhalten und Lagerverhalten Einfluss auf Miloš hat. Als ihn ein Vorarbeiter
anspricht und auffordert mitzukommen, ist er verwirrt, weil er sich natürlich nur vorstellen kann, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Außerdem hat er Angst, weil er
den Akzent des Mannes nicht zuordnen kann und so vermutet, er sei ein Donauschwabe
aus Jugoslawien. Dass der Mann ihm helfen will, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Als
105
„Während meiner ganzen Zeit im Lager verpflegten mich die Russen am Abend mit Kartoffeln.“
106
Hermann Langbein, … nicht wie die Schafe zur Schlachtbank, S. 166.
37
IOS-Mitteilung Nr. 61
der tatsächlich aber tschechische Vorarbeiter dann auch noch beginnt mit ihm auf Serbisch zu reden, da er zuvor in Serbien in einer Mine gearbeitet hatte, beginnt Miloš aus
Angst zu weinen, da er seine Donauschwabentheorie für bestätigt hält. Stattdessen versichert ihm der Vorarbeiter, dass er von nun an für ihn sorgen werde und er nicht mehr
hart arbeiten müsse, damit er die Befreiung erleben kann. Er nehme sich seiner an, da er
einen Sohn etwa im Alter von Miloš habe, der von den Deutschen fortgebracht wurde.
Dieses Erlebnis ist auch nach über 65 Jahren noch so emotional für Miloš, dass er zu
weinen beginnt. Im Kontext des Lageralltags muss die Geste des Vorarbeiters tatsächlich wie ein Wunder gewirkt haben und Miloš beginnt sogar aus der Perspektive des
Tschechen zu sprechen:
I tu češ da radiš sad kod mene, ništa raditi nečeš da dočekas oslobođenje“ a ja kažem „neću
dočekati, ja ću umreti”, kaže „dočekat ćeš, nećes raditi ništa a i ja ću te hraniti.107 (III, 14)
Hinzu kommt noch, dass er vom Vorarbeiter ab diesem Zeitpunkt nicht nur leichtere
Arbeit und zusätzliche Verpflegung zugeteilt bekam, sondern auch Holz, das er im Lager wiederum gegen Essen eintauschen konnte. Für Miloš ist klar, dass er nur deshalb
bis zur Befreiung überlebt hat, weil er zusätzlich zur Grundnahrung, durch die russischen Häftlinge und den Vorarbeiter mehr Verpflegung zur Verfügung hatte, sowie weniger schwere Arbeit verrichten musste. Nahrung und Schutz werden von ihm also explizit als Gründe für sein Überleben genannt (III, 17).
Aus diesem Motiv der Überlebensstrategien, ergibt sich zugleich auch ein weiteres
Motiv, nämlich das der ‚Rechtfertigung des Überlebens‘ im Angesicht des Todes anderer.
Das Krematorium des KZ Flossenbürg wird für Miloš zum Ausdruck dessen, was er als
Häftling vom Vernichtungsapparat nur erahnen konnte. Erst bei seiner Rückkehr, nach
über 60 Jahren, war er in der Lage die komplette Lageranlage zu besuchen, er bekommt
also plötzlich die Außensicht zu seiner bisherigen Innensicht geliefert (III, 2). Bestimmte
Bereiche des Lagers hat er als Überlebender nie gesehen, sonst hätte er nicht zu denen
107
„Und da wirst du nun bei mir arbeiten, du wirst nichts arbeiten, damit du die Befreiung erlebst, aber
ich sagte, ich werde es nicht erleben, ich werde sterben, er sagte du wirst sie erleben, du wirst nichts
arbeiten und ich werde dich verpflegen.“
38
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
gehört, die die Befreiung erlebten, will heißen, als Überlebender erlebte er nur einen Teil
der Vernichtung, im Gegensatz zu denen, die das Lager nicht überlebten.108 Diese Erkenntnis, dass er selbst überlebt hat, viele andere aber nicht, zeigt sich an vielen Stellen im
Interview und ist häufig mit dem hilflos erscheinenden Versuch verbunden, sich für das
eigene Überleben zu rechtfertigen. So äußert er an mehreren Stellen die Befürchtung, auf
Kosten anderer gehandelt zu haben. Seine oben bereits zitierte Erzählung zum Diebstahl
des Abendessens drückt diese Möglichkeit aus: Während er essen konnte, hatten die Bestohlenen kein Abendessen, etwas was ihm offensichtlich noch immer sehr nah geht
(III, 4). Auch bei der Erzählung zur Krankenbaracke rechtfertigt er sich dahingehend, dass
er betont, er habe das eingetauschte Brot nicht auf Kosten der Kranken genommen: „Oni
ne mogu da jedu imali su veliku temperaturu što god mi ko daje ja pojedem“ (III, 19).109
Während die Lage des italienischen Häftlings, dem er, wie bereits beschrieben, einmal die
Schuhe klaute, aus damaliger Sicht zweitrangig war, hat er aus heutiger Perspektive doch
Schuldgefühle entwickelt: „Niko ne brani i ja sam došao do dobrih cipela a kako je on
posle bio ja ne znam. Ja sam njemu ukrao i cipele“ (III, 10).110
Insgesamt bewegt sich die Erklärung seines Überlebens zwischen der Beschreibung
seiner eigenen Willenskraft (III, 3) und der Erkenntnis, dass es viele kleine Hilfestellungen waren, die außerhalb seiner Kontrolle lagen. Diese Feststellung ist eine, die Ulrike Jureit als charakteristisch für lebensgeschichtliche Interviews mit KZÜberlebenden beschreibt, also der Versuch „ihr eigenes Überleben angesichts millionenfachen Mordes“ verständlich zu machen und der Kampf mit der Feststellung, dass
sie ihr Überleben keiner Logik verdanken, sondern einem Zufall.111 Dies zeigt sich vor
allem in den Figuren seiner Retter, die, obwohl sie einander unbekannt waren, sich seiner annahmen. Nach der Befreiung war es Miloš noch nicht einmal möglich wieder
108
Siehe dazu Zitat von Primo Levi in: Hanno Loewy, Erinnerungen an Sichtbares und Unsichtbares, in:
Reinhard Matz, Die unsichtbaren Lager. Das Verschwinden der Vergangenheit im Gedenken, Reinbek
bei Hamburg 1993, S. 20–32, S. 32.
109
„Sie konnten nicht essen, sie hatten hohes Fieber, was immer man mir gab aß ich.“
110
„Niemand hielt mich ab und ich kam zu guten Schuhen, aber wie es ihm danach ging, das weiß ich
nicht. Ich habe ihm auch die Schuhe gestohlen.“
111
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 388.
39
IOS-Mitteilung Nr. 61
Kontakt zu ihnen herzustellen, da er weder ihre Namen noch ihren Herkunftsort genau
kannte. Wohl aus diesem Grund bedankt er sich heute stellvertretend beim russischen
und tschechischen Volk für ihre Hilfe (III, 21). Aber genauso zeigt es sich auch in Szenen wie der des Appells, bei dem zehn Männer abgezählt und jeder zehnte abgeführt
und nie wieder gesehen wurde. Miloš erzählt, wie er die Nummer 9 war und der
Mann neben ihm abgeführt wurde. Im gleichen Atemzug schildert er aber wieder seine
besonders große Moral, seinen Willen zu überleben, von einem Tag zum nächsten
zu leben (III, 3).
Auch beschreibt er an mehreren Stellen Ereignisse, bei denen er aus heutiger
Sicht fahrlässig handelte. So z. B. die Erzählung zur Arbeit im Stollenbau, als er und ein
Mithäftling sich entschieden, einen der schwer beladenen Waggons auf dem Weg zum
Förderband loszulassen, wodurch sich dieser überschlug und die Produktion für eine
halbe Stunde unterbrochen wurde. Ob sie es nun tatsächlich mit Absicht taten, oder es
sich aus Unachtsamkeit und Erschöpfung einfach so ergab und er es rückwirkend als
viel bewusstere Handlung wahrnimmt, wichtig ist in diesem Zusammenhang in erster
Linie, dass sie überraschenderweise mit dem Leben davonkamen. Die Vorarbeiter
schlugen sie „nur“ mit Schaufeln. Es hätte aber auch ihren Tod bedeuten können. Miloš
betont, sie hätten absichtlich losgelassen, um zu sehen was passiert (III, 8). Dieses
Herausfordern des „was vielleicht sein wird“ kann so auch als Test des Schicksals
verstanden werden, in einem Umfeld, in dem es keine wirkliche Möglichkeit gibt,
sich „richtig“ zu verhalten. Die Möglichkeit zu sterben war für sie zu diesem Zeitpunkt
bereits so allgegenwärtig und die Wahrscheinlichkeit zu überleben so viel geringer, dass
sie der Situation nur noch mit Gleichgültigkeit begegnen konnten:
Die Realität des Lagers war für die Betroffenen sozusagen bei vollem Bewusstsein nicht
zu ertragen. Sie waren nur fähig, ihre Umwelt insofern wahrzunehmen, wie es für das
Funktionieren im Sinne ihrer Verfolger notwendig war. Die Regression, das Sich-ZurückZiehen aus der Realität, schützte vor der Überforderung, die die Lagerrealität auch psychisch bedeutete. Dieses nicht von Emotionen begleitete, gleichsam routinierte
Handeln konnte sich aber auch als umfassende Anpassungsleistung manifestieren. (…)
Dieser emotionale Rückzug gleicht einer inneren Erstarrung, die den Menschen vor einer
Überflutung mit lebensbedrohenden Eindrücken schützt. Wenn Angst und Schmerz zu
40
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
groß werden, reagiert der Mensch mit Auslöschen seiner Gefühle. Das Vernichtungssystem zielte auf die Zerstörung von Individualität und Identität, eben auf Entstrukturierung ab.112
Ein weiterer Fall, in dem Miloš auf ähnliche Weise reagiert, ist als er einem
seiner deutschen Vorarbeiter ein Butterbrot aus der Jackentasche stiehlt (III, 9).
Als der bemerkt, dass sein Brot fehlt, meldet sich Miloš auf Nachfrage sogar, um
mitzuteilen, dass ein Häftling vorbeigegangen sei und wahrscheinlich das Brot
genommen habe. Als er dem vor Wut schäumenden Meister zeigen soll, wer es war,
zeigt er auf alle möglichen Leute und sagt, dass er nicht gesehen habe, wie der Häftling aussah. Mit seinem Verhalten hat er nicht nur sich selbst in Gefahr gebracht,
sondern auch seine Mithäftlinge, und dennoch ist es Ausdruck extremer Hilflosigkeit, da er keinen anderen Weg sieht, sich zu retten. Bei Ulrike Jureit heißt es in diesem Zusammenhang:
Die Betroffenen empfinden eine tiefe Scham, ihrem eigenen Überlebenswunsch gefolgt
zu sein und gleichzeitig individuellen und kollektiven Wert- und Normvorstellungen
nicht entsprochen haben zu können. Im Lager herrschten andere Gesetze, die nicht sie,
sondern ihre Verfolger bestimmten. Der persönliche Konflikt, der die Überlebenden bis
heute bewusst oder unbewusst quält, ist somit Ausdruck einer Lagerrealität, in der es die
SS und ihre Handlanger zu bestimmen hatten, wem überhaupt eine Chance zum Überleben zugestanden wurde.113
Milošs oben geschilderte Erzählungen spiegeln damit genau diese Irrationalität des
Lagers wider, in dem ein Pausenbrot zur Lebensgefahr werden konnte und sich alles
einer logischen Erklärung entzog. Egal wie er sich verhielt, ob vermeintlich richtig
oder auch falsch, er konnte sich nicht sicher sein, dass er überlebt oder verhindern, dass
andere zu Schaden kommen. Eine sich daraus ergebende Verpflichtung gegenüber den
verstorbenen Mithäftlingen wird deutlich an Milošs sehr ausführlicher Schilderung des
Todesmarsches und ihres Halts in Schmidtmühlen. Im Hof der dortigen Kirche begrub
112
Ebd., S. 121–122.
113
Ebd., S. 124.
41
IOS-Mitteilung Nr. 61
er zusammen mit italienischen Häftlingen einen Italiener und einen Serben, nahe der
Kirchenmauer. Der Betreuer unterbricht ihn während dieser Erzählung mehrmals und
weist ihn darauf hin, dass es nicht nötig sei, derart detailliert von dem Geschehen zu
sprechen. Für Miloš hat diese Erzählung aber eine ganz zentrale Bedeutung. Es ist
wichtig für ihn erzählen zu können, dass er sich an alles erinnern kann, dass er genau
weiß wo das Grab ist und dass es ihn irritiert, weil der Ort heute ganz anders aussieht, er
die Straße von früher nicht kannte und den zweiten Eingang zum Friedhof. Dies deutet
daraufhin, dass er bei einem noch nicht lange zurückliegenden Besuch Schwierigkeiten
hatte sich nach so langer Zeit im dortigen Kirchhof zu orientieren. Hinter seinen
Bemühungen steckt das Wissen, dass der Mann, den er dort begraben hat, es doch nicht
mehr schaffte bis zur Befreiung zu überleben. Da er selbst dieses Privileg aber genoss,
empfindet er heute Verantwortung für die Erinnerung an diesen Mann. Wie wichtig in
diesem Zusammenhang die Örtlichkeit und das Grab sind, zeigt sich auch an seiner
selbst gezeichneten und sehr detaillierten Karte der dortigen Umgebung, auf die er auch
während des Interviews verweist (III, 22).114
Was sich also auch mit Blick auf Milošs gesamte lebensgeschichtliche Erzählung
schließen lässt, ist, dass sie sich einreiht in andere Erinnerungen von Überlebenden der
nationalsozialistischen Konzentrationslager. Diesen Erinnerungen ist gemeinsam, dass sie
sich um das Thema Überleben im Umfeld von unglaublichem Leid drehen und nach Begründungen für ihr eigenes Schicksal suchen, wodurch ihre Erzählungen zugleich zu
„Überlebensdiskurse[n]“ werden.115 Nachdem nun eine Vielzahl von Motiven aus Milošs
Erzählung herausgearbeitet wurde, soll im Folgenden untersucht werden, welche Faktoren
deren Darstellungsweise beeinflusst haben. Schließlich sind „in die Interviews mit Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager (…) zahlreiche Nachkriegsdiskurse
eingeflossen, die dazu geführt haben, dass die individuellen Deutungen der Verfolgung in
114
Dieser Thematik der empfundenen Verpflichtung gegenüber den Mithäftlingen widmet sich Thomas
Rahe, vgl.: Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 85.
115
42
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 398.
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Frage gestellt, anders gewichtet oder verändert wurden“.116 Die Lebensgeschichte eines
Zeitzeugen ist so immer auch als „halböffentliches Arrangement“ zu verstehen, d. h. es
wird bewusst an ein Publikum gerichtet.117 In dieser Hinsicht ist in Milošs Erzählungen
ein Punkt besonders auffällig: der Kontrast zwischen der Erzählung zu seiner Zeit als
Partisane und der sich daran anschließenden Erzählung zur KZ-Erfahrung.
Während Milošs Erzählung bis zur Verhaftung zwar gekennzeichnet ist durch den
Verlust des Vaters, so zeichnet sie sich doch, wie bereits angesprochen, durch ein großes Maß an Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Gemeinschaftsgefühl aus. Mit
der Deportierung nach Flossenbürg und später Hersbruck, fällt eine Erwähnung der Partisanen zunehmend weg, es scheint auszudrücken, wie er mehr und mehr auf sich allein
gestellt ist. Bei den Erzählungen im Lager bekommt man den Eindruck, er sei tatsächlich „allein“, daher vielleicht auch die kaum bemerkbare Erwähnungen seiner jugoslawischen Gruppe. Dieser Bruch in der Darstellung ist dahingehend interessant, da er
Rückschlüsse auf die rückwirkende Betrachtung der Lebensgeschichte zulässt. Mit seinen Schilderungen des Partisaneneinsatzes kann Miloš als Teilnehmer des Volksbefreiungskampfes an gesellschaftliche Muster des ehemaligen Jugoslawiens anknüpfen.
Als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung kann er das nicht, wie bereits mit Bezug auf die Einstellung des jugoslawischen Veteranenbunds gezeigt wurde.
Im Rahmen ihrer bereits angesprochenen lebensgeschichtlichen Studie zu weiblichen
KZ-Häftlingen aus Slowenien im KZ Ravensbrück, beschreibt Silvija Kavčič, wie die
Erzählungen ihrer Interviewpartner auffallend einheitliche Erzählmuster aufweisen.
Diese Muster betonen in besonderem Maße die Solidarität innerhalb der slowenischen
Gruppe, die Themen Widerstand und Heldenmut, d.h., dass sich die Häftlinge ganz im
Sinne der jugoslawischen Nachkriegsordnung verhalten hätten. Das Leiden, die Brutalität und die geringen Handlungsspielräume hatten in diesem Bild keinen Platz118 und
eben auch nicht die Realitäten des Lagers, wie auch die alles bestimmende „Häftlings-
116
Ebd., S. 392.
117
Ebd., S. 32.
118
Silvija Kavčič, Etablierung eines Erzählmusters, S. 222.
43
IOS-Mitteilung Nr. 61
hierarchie“, die über Leben und Tod entscheiden konnte.119 Kavčič’s Schlussfolgerung
ist, dass diese wiederkehrende Darstellungsweise in den Erzählungen als Reaktion auf
den „öffentlichen Diskurs im Jugoslawien der Nachkriegszeit“ zu verstehen ist:
Die unmittelbare Nachkriegszeit [in Jugoslawien] war (…) geprägt von der Konsolidierung einer neuen Gesellschaftsordnung nach sowjetischem Vorbild. Die ehemaligen KZHäftlinge sahen sich ebenfalls auf der Seite der Sieger, da sie für die Ziele der Befreiungsfront gekämpft hatten und sogar im KZ inhaftiert gewesen waren. Doch in Slowenien und Jugoslawien sahen dies viele anders. Die heimkehrenden Überlebenden nationalsozialistischer Konzentrationslager erhielten im neu gegründeten Staat nicht die Anerkennung, die sie sich erhofft hatten. Stattdessen begegnete man ihnen mit einem hohen
Maß an Misstrauen und äußerte Verdächtigungen.120
Es wurde den Rückkehrerinnen also im Prinzip unterstellt, dass sie nur deshalb überlebt hatten, weil sie mit dem Feind kollaborierten.121 Um überhaupt gehört zu werden,
waren die von Kavčič interviewten Häftlinge also gezwungen, ihre Erzählungen anzupassen. Allerdings scheinen sich die von ihnen entwickelten Erzählmuster derart verselbstständigt zu haben, dass Kavčič diese noch während der 90er Jahre in lebensgeschichtlichen Interviews antreffen konnte.122 Mit Blick auf Milošs lebensgeschichtliche
Erzählung ist in diesem Zusammenhang vor allem interessant, dass er von diesen Mustern des heldenhaften Widerstands im KZ deutlich abweicht und seine Hauptmotive
stattdessen vom Leiden, der Unmenschlichkeit (aller), und der Passivität handeln. Die
Motive, die bei ihm besonders hervortreten, der Verlust der Selbstbestimmung und jeglicher Kontrolle, die täglichen Überlebensstrategien, aber auch die Willkür, die sein
Leben jederzeit verlängern oder beenden konnte, das Fokussieren auf das passive Überleben, entsprechen auf den ersten Blick ganz und gar nicht dem gesellschaftlichen
Rahmen, in dem er sich nach seiner Rückkehr nach Jugoslawien bewegt haben muss.
119
Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 95.
120
Silvija Kavčič, Etablierung eines Erzählmusters, S. 225–226.
121
Dies., Überleben und Erinnern, S. 278.
122
Ebd., S. 280.
44
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Das stetige Ansteigen der Verzweiflung und des Leidens, das Miloš erfährt, zeigt sich
besonders im Moment der Befreiung, als er bei Ankunft der Amerikaner in einen
Schock verfällt. Die Erzählung der Befreiung verdichtet sich so extrem auf einen Moment, den Moment des Schocks, in dem er völlig hilflos ist. Er schildert alles, als ob es
in einem einzigen Moment passiert: „Vidim Nemac koji me mogao ubiti sada viši nije
niko ni ništa mogu ga ja ubiti.“123 Zugleich sieht er einen Amerikaner, der ihm hilft,
bevor er sich mit einem Aufschrei aus der Passivität befreit (III, 23).
Nun ließe sich argumentieren, dass diese vom Leiden geprägte Darstellungsweise
eben erst relativ neu ist, dass Miloš erst heute so über seine Erfahrungen spricht, wo der
gesellschaftliche Druck möglicherweise nachgelassen hat. Dieser Betrachtungsweise
widerspricht allerdings, dass sich durchaus Anzeichnen finden lassen, dass auch in
Milošs Präsentationsweise, durch die klare Zweiteilung seiner Lebenserfahrung in Partisane und KZ-Häftling, der Einfluss des jugoslawischen Nachkriegsdiskurses seine
Spuren hinterlassen hat.
In seiner Erzählung zu den Partisanen betont er die Gemeinschaft und das Leiden
seiner Mitmenschen. Er beschreibt die Partisanen als sehr gebildet, darunter neben
Handwerkern auch viele akademische Berufsgruppen wie Ärzte und Anwälte, und ist
stolz auf die gute Arbeit, die er als einfacher Bauer einbringen konnte (II, 6). Er schildert seine Mitgliedschaft in der Volksbefreiungsbewegung als einen ganz normalen,
vorgezeichneten Weg, gerade so als hätte es keine Alternativen gegeben. Er betont, dass
er für die Bewegung sein Leben riskieren musste, da es seine Aufgabe war, immer wieder als Kurier nachts das Dorf zu verlassen und er nie wissen konnte, ob er es lebend an
den Grenzern vorbei zurück schaffen würde (II, 4). Er beschreibt, wie er die schwere
Tätigkeit dennoch auf sich nahm, als einziger unter seinen Freunden (II, 7), spricht dabei jedoch nie genauer von seinen Ängsten oder Befürchtungen. Der Fokus liegt vielmehr darauf, wie gut er seine Aufgaben meisterte, wie gewitzt er wiederholt mit der
Gefahr umging und wie sehr man sich auf ihn verlassen konnte (II, 8). Ängste, die si-
123
„Ich sehe einen Deutschen, der mich töten konnte, jetzt ist er nicht höher als niemand und nichts, ich
kann ihn töten.“
45
IOS-Mitteilung Nr. 61
cherlich existiert haben müssen, schon mit Hinblick auf das Schicksal seines Vaters,
werden ausgeklammert, und auch die Tatsache, dass er sich damals aller Konsequenzen
seiner Tätigkeit nicht bewusst gewesen sein kann. Dass er zu einem Opfer nationalsozialistischer Verfolgung werden und was dies letztlich beinhalten würde, hätte er damals
noch nicht gänzlich einschätzen können. Dennoch beschreibt er seinen Weg bei den
Partisanen als den einzig richtigen, obwohl es ja auch genau dieser Weg ist, der zu seiner Verhaftung und Inhaftierung im KZ führt. Diese geradlinige Darstellung, die nachträgliche Konstruktion von Sinn in der Erzählung, bricht aber genau dann ab, wenn es
zum Lager kommt. An diesem Punkt beginnt eine anders geartete Erzählung, was auf
einen Bruch zwischen Miloš, dem Partisanen, und Miloš, dem KZ-Häftling, hindeutet.
Miloš, der immer gute und besonders gefährliche Arbeit für die Partisanen leistete und
explizit mit Hinweis auf die Ermordung seines Vaters angeworben wurde, gerät in die
Hände des Feindes. Nicht aus eigener Schuld, sondern weil sein Name in einem Verhör
von einem Mitkämpfer genannt wurde, der ausgerechnet auch der Mann ist, der ihn anfangs angeworben hatte. Was Miloš unterschwellig immer noch zu beschäftigen scheint,
ist, weshalb der Mann, trotz Warnungen von Milošs Seite, der den sicheren Weg kannte,
nicht auf ihn wartete und stattdessen alleine versuchte, das Dorf zu verlassen:
On je izašao na izlaz i naišao na graničare i patrolu, koji su ga zaustavili i uhapsili. A taj
iz [Ort], P. je skočio u kukuruz i pobegao. T. je isto mogao da pobegne, ali je on ostao da
se preda, jer je govorio perfektno mađarski i ne znam iz kakvih još namera. A nije se
smelo iz sela izaći posle deset sati nikako.124 (II, 10)
Sein Vorgesetzter, der für sie alle im Dorf verantwortlich war, brachte ihr Leben anscheinend ohne Grund in Gefahr und wurde, wie Miloš es beschreibt, abtrünnig. Eine
ähnliche Episode schildert Miloš mit Bezug auf das ungarische Lager, in das sie nach
ihrer Verhaftung und Vernehmung gebracht wurden. Als die näher rückende russische
Front sie sicher sein ließ, dass sie bald frei sein würden, so schildert er, wären ihre Par-
124
„Er ging zum Ausgang des Dorfes und stieß auf die Grenzpatrouille, die ihn anhielt und verhaftete.
Und der aus [Ort], P. sprang in den Mais und entfloh. T. hätte ebenso fliehen können, aber er blieb stehen
um sich zu stellen, weil er perfekt Ungarisch sprach und ich weiß nicht aus was noch für Gründen. Aber
man durfte in keinem Fall nach 10 Uhr aus dem Dorf gehen.“
46
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
tisanenanführer mit den ungarischen Lageraufsichten einen Deal eingegangen, der beinhaltete, dass sich alle Parteien in Anbetracht des baldigen Endes der Internierung ruhig
verhalten sollten:
A Mađari su rekli našim rukovodiocima da mi budemo mirni i da ne pravimo nekakve
nelagodnosti, jer rat neće trajati dugo i mi ćemo uskoro biti slobodni. Tako su naši
rukovodioci nama prenosili, da budemo dobri i mirni i da ništa ne pravimo, jer ćemo onda
i oni i Mađari i mi svi stradati. Mi smo to prihvatili kako su nam rukovodioci prenosili i
bili mirni.125 (II, 13–14)
Miloš und seine Mitstreiter befolgten also die Anweisungen ihrer Vorgesetzten, ließen sich sogar wenig später nach Ungarn transportieren, obwohl sie sich die ganze Zeit
über bewusst waren, wie Miloš schildert, dass sie, hätten die Anführer ein Zeichen gegeben, sich jederzeit aus eigener Kraft hätten befreien können. Da dieses Zeichen aber
nicht kam, überquerten sie die ungarische Landesgrenze als Gefangene. Während ihre
Anführer dort dann freigelassen wurden, wurden Miloš und die übrigen Partisanen, wie
bereits geschildert, kurz darauf an die Gestapo ausgeliefert (II, 15). Wie zuvor bei seiner
Verhaftung, kommt es zu einer Verschlechterung seiner Lage nicht aus eigenem Handeln heraus, sondern, weil er wiederholt von den eigenen Leuten im Stich gelassen
wurde. In diesem Zusammenhang ist auch seine Betonung darauf zu verstehen, dass er
vor seiner Verhaftung zwar stets eine Pistole bei sich trug, diese jedoch nie benutzte (II,
6) und somit niemandem direkt Schaden zugefügt hat. Dennoch muss er all das Leiden
in Flossenbürg und Hersbruck erleben. Die Partisanengemeinschaft, die ihn bis zu einem gewissen Grad vielleicht noch vor der direkten Gefahr der „Ungarn“ in seinem
Heimatort zu schützen schien, lässt schließlich zu, dass „die Ungarn“ und „die Deutschen“ ihm Leid zufügen können.
125
„Und die Ungarn sagten unseren Anführern, dass wir ruhig sein sollen und dass wir nicht irgendwelche Unpässlichkeiten auslösen, weil der Krieg nicht mehr lange dauern wird und wir bald frei sein werden. So gaben uns unsere Anführer weiter, dass wir gut und ruhig sein sollen und dass wir nichts machen,
weil dann sowohl sie als auch die Ungarn als auch wir alle draufgehen werden. Wir nahmen das an wie
uns die Anführer das weitergaben und blieben ruhig.“
47
IOS-Mitteilung Nr. 61
Dennoch musste er nach seiner Rückkehr an einem gesellschaftlichen Bild teilhaben
und wurde mit einer Form der gesellschaftlichen Erinnerung konfrontiert, in dem das Leiden als KZ-Häftling, das er erlebt hatte, meist nicht gebührend anerkannt wurde. So beschreibt er zwar einerseits, wie ihn eine große Gruppe von Menschen nach seiner Rückkehr aus dem Konzentrationslager vom Bahnhof abholte und dass nach dem Krieg durchaus viele Menschen in seinem Dorf an seinen Erzählungen interessiert waren (III, 27). Auf
einer sehr viel persönlicheren Ebene sieht es jedoch zugleich so aus, dass seine eigene
Mutter nicht unter den Wartenden am Bahnhof war, weil sein Stiefvater sie nicht gehen
lassen wollte, eine Erfahrung, die Miloš sehr schmerzte. Auch ließ ihn dieser Stiefvater
nach seiner Rückkehr ohne Rücksicht auf seinen gesundheitlichen Zustand hart für sich
arbeiten, auch wenn er damit Milošs ohnehin schon geschwächte Gesundheit aufs Spiel
setzte. Von seinem engsten Umfeld wurde sein Überleben also wenn überhaupt nur am
Rande gewürdigt, zumindest bis ihn sein Onkel zu sich nach Novi Sad holte (III, 26).
Während er für die Partisanenerinnerung in seiner heimischen Gesellschaft immer
Raum hatte, hat er aber mit der Platzierung seiner KZ-Erinnerungen bis heute Schwierigkeiten.126 Am Morgen des dritten Interviewtages hatte er gerade einen Brief von seinem Veteranenbund erhalten, mit einer Einladung zu einer traditionellen „Zusammenkunft“ der Überlebenden. Laut Aussage des Betreuers hat dieses Treffen jedoch noch
nie zuvor stattgefunden und die Überlebenden würden erst jetzt langsam in den Fokus
des Vereins rücken (III, 28). Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg bietet Miloš so gesehen
das bedeutendste Forum, um aktiv seine Erinnerungen zu präsentieren und sein Leiden
gewürdigt zu sehen. Dies spiegelt sich auch in dem von ihm genannten Motiv für seine
Rückkehr nach Flossenbürg: Viele wollten ihn abhalten, aber es war ihm ein großes
Bedürfnis zu zeigen, was er dort gemacht hat, wie er dort überlebt hat (III, 31). Schließlich ist auch diese Erfahrung ein bedeutender, wenn nicht der bedeutendste Teil seines
Lebens und es ist ihm wichtig, davon zu erzählen und auch gehört zu werden. Aber
auch hier zeigen sich die Spannungen, die Miloš in seiner Heimat erfährt. Miloš be-
48
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
schreibt, wie er bei einer offiziellen Gedenkfeier vor wenigen Jahren vor der jugoslawischen Grabplatte auf dem „Platz der Nationen“ stand und dabei zusehen musste, wie
Vertreter der Slowenen und Kroaten dort Kränze niederlegten, während er, als einziger
anwesender serbischer Überlebender weder einen Kranz noch irgendeine politische
Repräsentation vorweisen konnte. Erst auf sein eigenes Bemühen hin nahm im darauffolgenden Jahr ein serbischer Vertreter an der Gedenkveranstaltung teil (III, 2). Auf
Milošs Eigeninitiative geht auch eine Plakette zurück, die er in diesem Jahr in der
KZ-Gedenkstätte anbringen ließ, und die explizit den Opfern aus der Vojvodina
gewidmet ist.
Betrachtet man die Würdigung seiner vergangenen Erfahrungen, so hat sich für
Miloš mit dem Zusammenbruch Jugoslawiens Ende der 80er Jahre zunächst einmal
nicht wirklich viel geändert. In seinen Erzählungen zeigt sich so auch ein ambivalentes
Verhältnis zwischen seiner Vergangenheit und seinem starken Gefühl von Nationalstolz, indem immer wieder die Frage durchzuschimmern scheint, ob sowohl seine als
glorreich wahrgenommene Partisanenvergangenheit als auch das grausame Leiden und
Opferdasein im KZ mit diesem vereinbar sind, also die Frage ob sein nationaler Hintergrund als Serbe auch dem Leidensaspekt seiner Biographie Raum lässt.
Abschließend lässt sich aus den vorangehenden Feststellungen ein Umgang des Zeitzeugen mit seiner Vergangenheit feststellen. Zum einen wird deutlich, dass die Darstellungsweise der Motive in ihrer Fokussierung auf das Überleben sehr persönlich gehalten ist, auch wenn sich darin trotzdem auch der Einfluss verschiedener Vergangenheitsdiskurse zeigt. Seine Lagererfahrung fungiert als die zentrale Lebenserfahrung, die ihn
nachhaltig geprägt hat, dennoch ist sie gewissermaßen autark zwischen Vorgeschichte
und dem Leben danach geschaltet. Sie umfasst eine Reihe von Episoden, nicht so sehr
eine zusammenhängende Erzählung. Wie Jureit beschreibt, kann in dieser Schaffung
von festen Erzählabschnitten und der Abkapselung der Erfahrung innerhalb der Lebensgeschichte auch eine Art des Umgang liegen, der es möglich macht, die erschütternden
126
Silvija Kavčič schreibt dazu: „Obwohl viele KZ-Häftlinge wegen ihrer Unterstützung oder sogar
Teilnahme an diesem bewaffneten Kampf inhaftiert wurden, waren sie nicht Teil der Helden- bzw. Sie-
49
IOS-Mitteilung Nr. 61
Erinnerungen unter Kontrolle zu halten.127 Vor allem aktive Zeitzeugen bezeichnet sie
als eine Gruppe, die sich dieser Muster bedienen, da sie sich so ohne Schwierigkeiten in
Projekten und der Erinnerungsarbeit engagieren können und mit dem „Rückgriff auf
eine bereits vorstrukturierte Darstellung“ emotional fähig sind, sich ihren Erinnerungen
in einem Interview zu stellen.128 Zu dieser Gruppe ist auch Miloš zu zählen, der seine
Aufgabe als Zeit-„Zeuge“ zudem sehr ernst nimmt. So ist Miloš der Umgang mit der
wissenschaftlichen Forschung nicht unbekannt und die Interviewsituation nicht fremd
(III, 28). Miloš gesteht zwar ein, dass ihn das Erzählen anfangs sehr belastete (III, 27),
aber er hat seine Erinnerungen auch bereit gemacht für die Präsentation, das Aufmerksam machen auf sein Schicksal und derer, die nicht mehr selbst davon berichten können.
Darauf deutet auch seine Ankündigung hin, seine Memoiren einem deutschen Historiker schicken zu wollen, damit dieser sie zusammenstellt (III, 27). Auch seine widerholte
Betonung, er sei nur eine sehr unbedeutende Person, ohne jeglichen Einfluss, sollten
daher nicht zu genau genommen werden, da er mit seinen Erzählungen doch ein Ziel
verfolgt. Denn in dem schwierigen Versuch, sein eigenes Überleben zu erklären, manifestiert sich zugleich auch seine grundlegende Erfahrung, nämlich was passieren kann,
wenn, wie er sagt, jemand absolute Macht über andere bekommt (III, 30). Der Kommunikation dieser Erfahrung haftet allerdings zugleich auch ein Dilemma an, das auch Rahe in Erzählungen anderer KZ-Überlebender festgestellt hat. Dieses Dilemma drückt
sich aus durch eine „oft verzweifelt gespürte Spannung zwischen dem auch als Verpflichtung empfundenen Bedürfnis, berichten zu müssen und dem Bewusstsein, dass
ihre Erfahrung des Konzentrationslagers nur sehr eingeschränkt mitteilbar“ sind.129
Miloš muss etwas erzählbar machen, was an sich schon nicht wirklich erzählbar ist, für
ein Publikum, das nicht verstehen kann, weil es nicht das gleiche erlebt hat. Dieses Dilemmas ist er sich durchaus auch bewusst: Neben der Aussage „čovek koji nije proživeo
gerkollektive.“ Silvija Kavčič, Überleben und Erinnern, S. 17.
127
128
129
50
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 174–175, 184.
Ebd., S. 378.
Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 86.
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
to ne može da shvati ni da pomisli šta je bilo i kako je bilo”130 (III, 3) steht am Ende des
dritten Interviews die Hoffnung, dass die Menschen, die sich von faschistischen Ideen
leiten lassen, dies nur aus Unkenntnis über das tun, was ihm widerfahren ist (III, 33).
4.2 Das KZ Flossenbürg in der ‚erinnerten Erinnerung‘ von Milošs
Betreuer
An dieser Stelle soll nun der Frage nachgegangen werden, welchen Einfluss der Betreuer durch seine Teilnahme am Interview auf die Lebensgeschichte des Zeitzeugen hatte,
und wie er die Erzählungen in seinen gedolmetschten Redeanteilen darstellt bzw. ergänzt und verändert. Anschließend soll es darum gehen zu zeigen, in welchem Verhältnis in seiner Präsentation des Erzählten Gegenwart und Vergangenheit, eigene und gesellschaftliche Erfahrungen und Sichtweisen, stehen, um davon, in Anlehnung an die
Fünf Modi der Rhetorik des kollektiven Gedächtnis nach Astrid Erll, auf seine Version
der ‚erinnerten Erinnerung‘ im Vergleich zur Erinnerung des Zeitzeugen zu schließen.
Zunächst einmal beeinflusste der Betreuer das Interview schlicht durch seine Anwesenheit. Die Problematik eines gedolmetschten Interviews wurde an anderer Stelle in dieser Arbeit bereits beschrieben. In der konkreten Interviewsituation führte das Dolmetschen häufig dazu, dass es Momente gab, in denen das Interview auf zwei Ebenen stattfand, einmal zwischen Dolmetscher und Interviewer und einmal zwischen Dolmetscher
und Zeitzeuge. Auf jeder der beiden Ebenen war jeweils einer der Teilnehmer außenstehend. Während der Betreuer dolmetschte, musste der Zeitzeuge zudem warten, bevor er
mit seiner Erzählung fortfahren konnte. In diesen Momenten konnte er nur erahnen, was
der Betreuer wiedergab. Ein Beispiel hierfür ist der Fall in dem der Betreuer dem Interviewer eine bestimmte „Anekdote“ vorschlug, welche für ihn interessant sein könnte
(III, 8). Miloš versteht in den englischen Ausführungen des Betreuers das Wort „Sabotage“ und fragt, ob er davon erzählen soll. Hieran zeigt sich, dass durch die verschiedenen
Ebenen der Kommunikation vor allem auch der Zeitzeuge nur bedingt am Interview teil-
130
„Ein Mensch, der das nicht erlebt hat, kann es weder begreifen, noch sich ausdenken was war und wie
es war, wie wir dort lebten.“
51
IOS-Mitteilung Nr. 61
haben, bzw. nur erahnen kann, was von ihm erwartet wird, und so abhängig von seinem
„Sprachrohr“, dem Betreuer, wird.131 Ein zweiter Aspekt, der sich hieran anschließt, und
für den Interviewer eine schwierige Situation darstellte, war das zeitweilige Auftreten von
Betreuer und Zeitzeuge als eingespieltes Zeitzeugen-Team. Viele der Fragen, die der Betreuer dem Zeitzeugen zwischendurch stellte, waren bereits auf Miloš zugeschnitten, weil
der Betreuer dessen Reaktion kennt. Der Betreuer spezifizierte z.B. bei der Frage nach
Milošs Wahrnehmung des Dorfes bei seiner Rückkehr nach Flossenbürg „samo mesto“132,
weil er weiß, dass Miloš von sich aus tendenziell immer auf das Lager zu sprechen kommen würde (III, 29). Zudem scheint Milošs Betreuer mit dem Zeitzeugen bereits so gut
wie jeden Ort seiner Vergangenheit besucht zu haben, wodurch Miloš bei seinen Erzählungen den Vorteil hat, dass der Betreuer immer schon die richtige Geographie im Kopf
hat und ihm ohne Mühe folgen kann (II, 8–9, 11). So fallen seine Erzählungen häufig weniger detailliert aus, als sie es für sein Gegenüber eigentlich sein dürften. Wäre der Zeitzeuge auf sich allein gestellt, müsst er gewährleisten, dass seinem Zuhörer in der Erzählung ausreichend Details zur Verfügung stehen, damit dieser problemlos folgen kann.133
Möglicherweise bewirkte die Anwesenheit des Betreuers jedoch genau das Gegenteil, da
er diese Aufgabe an Stelle von Miloš übernimmt. Das, was der Betreuer an vielen Stellen
hinzufügt, wie historische Fakten (I, 14) und genaue Rückfragen an den Zeitzeugen, wie
dieses und jenes nun tatsächlich funktioniert habe (I, 5), seine Erklärungen und zusätzlichen Informationsgaben in den gedolmetschten Redeanteilen, sollen offensichtlich gewährleisten, dass auch der Interviewer den jeweiligen Kontext versteht. So gibt er beispielsweise Erklärungen zu Begriffen des „concentration camps slang“ (III, 11), also Bezeichnungen für bestimmte Häftlingsgruppen und Personen, die Miloš an verschiedenen
Stellen benutzt oder erklärt, weshalb es rückblickend sicherer war, auf dem Todesmarsch
zu Fuß zu gehen, da die Züge schneller in Dachau ankamen (III, 22).
131
Zur Beobachtung einer gewissen Ohnmacht der Beteiligten vgl.: Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 304.
132
„Nur der Ort“.
133
Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung, S. 142.
52
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Auch wenn Betreuer und Zeitzeuge ein eingespieltes Team sind, so zeigen sich doch
auch zwischen ihnen Konfliktlinien. Bereits in der Einleitung wurde darauf eingegangen, dass der Zeitzeuge und sein Betreuer als Angehörige unterschiedlicher Generationen auch unterschiedlichen Erfahrungswelten entstammen. Dass der Betreuer einer anderen Generation angehört und sich dessen bewusst ist, zeigt sich auch in seinen Kommentaren. Auf eine von Milošs Beschreibungen aus der Kindheit reagiert er mit: „Ja
great fun I’m so happy I was born when I was born and where I was born” (I, 9). Auch
dieser Generationenaspekt hat Einfluss auf die Repräsentationen des Betreuers, der die
Ereignisse unweigerlich aus einer anderen Perspektive sieht, als der Zeitzeuge. So entsteht auch zwischen diesen beiden Parteien, Betreuer und Zeitzeuge, ein Konflikt, der
sich daraus ergibt, dass sie teilweise unterschiedliche Schwerpunkte setzen: Milošs
detailierte Ausführungen zur Region (I, 7) und den technischen Details der Lagerarbeit
(III, 7) stehen damit dem Beharren des Betreuers auf individuelle Erlebnisse und seine
eigene Person gegenüber (I, 7).
Der Konflikt zeigt sich auch in der Strukturierung des Interviews. Wie bereits geschildert, sollte das Interview zwar mit der Kindheit begonnen werden, nicht aber zwingend chronologisch weitergeführt werden. Im Interview wurde aber relativ schnell deutlich, dass der Betreuer keinen Ausbruch aus diesem Rahmen erlaubte. Er begann zunehmend über die chronologische Vorgehensweise zu wachen und holte Miloš wenn
nötig auch zurück zu einer früheren Episode, auf die er noch nicht eingegangen war:
[unterbricht] „Čekaj Miloš – ali nisi rekao šta si imao od odeće šta si imao od cipela to
pa to –“ (I, 2).134 Oder im folgenden Beispiel, wo ihn auch der Hinweis des Interviewers
nicht von einer Intervention abhalten konnte (I, 5):
B: [unterbricht] Čekaj čekaj samo da se vratimo idemo ono tridesetšesta godina putovanje
dеreglijom sa lubenicama135
M: Aha e da
134
„Warte Miloš – aber du hast nicht erzählt was du als Kleidung hattest, was du an Schuhen hattest das
und ja das – .“
135
„Warte warte nur damit wir zurückkommen, gehen wir zu dieser Reise im Jahr 1936 mit dem
Lastkahn, mit den Wassermelonen.“
53
IOS-Mitteilung Nr. 61
B: Ok his first –
I: But he can also go on if he wants to
B: No we better keep the chronology right
Denn, wie er an anderer Stelle noch einmal betont, muss die Kontrolle über das Interview und damit auch den Zeitzeugen erhalten bleiben: „If you let him go he is beyond
control (alle lachen) trust me!“ (III, 27). Thomas Rahe schildert, wie auch in Interviews
die „Formzwänge des Erzählens“ eingehalten werden müssen, d.h. damit die Selbstdarstellung im Interview und gegenüber dem Publikum gelingt, dürfen Aspekte wie ein
„Mindestmaß (…) an chronologischer Struktur, an Kohärenz und stringenter Darstellung“
nicht außer Acht gelassen werden.136 Genau diese Aspekte sind es, auf die der Betreuer
achtet und dies zeigt sich nicht nur in Bezug auf die chronologische Vorgehensweise,
sondern vor allem auch in den Momenten, in denen er von Miloš Logik und einen vernünftigen Blick auf seine Erlebnisse einfordert. Das passiert beispielweise als Miloš vehement darauf beharrt nicht verstanden zu haben, dass Krieg ausgebrochen sei, obwohl er
Kampfflugzeuge gesehen hatte (I, 17). Zudem versichert sich der Betreuer immer wieder
der Richtigkeit bestimmter Daten und Fakten, was sich auch in der Diskussion um den
Tag von Milošs Verhaftung zeigt (II, 10) oder darin, dass er an bestimmten Stellen Beweise für Milošs Aussagen sehen möchte, z. B. was dazu geführt habe, dass Miloš den Lagerkommandanten im ungarischen Lager als „krvolok strahovito“ 137 bezeichnete (II, 12).
Neben dem Überwachen der Vorgehensweise, hatte der Betreuer aber auch Einfluss
darauf welche Erzählungen besonders ausführlich oder gekürzt wiedergegeben wurden.
Bereits im vorigen Kapitel wurde angesprochen, dass auch für den Zeitzeugen das Bedürfnis bestand, zu den Aspekten seiner Biographie zu kommen, die für seine Verfolgungserfahrung relevant sind. Dieser Wunsch war sehr deutlich auch von Seiten des
Betreuers zu spüren. Er versuchte an mehreren Stellen aktiv, die Erzählung in Richtung
Flossenbürg voranzutreiben:
136
Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 96.
137
„Schrecklicher Blutsauger.“
54
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Eh ja basically they got to Komarno and eh ok I’ll move things along a little bit here in
Komarno when they were in Komarno eh there was a change of power in Hungary Horty
was ousted and the Nilasi took over and the Nilasi were actually the ones who transferred
them to Germans who took them to Flossenburg – o. k. ispričao sam ukratko da su bili
Nilaši i da se u Komarnu promenila vlast i tako dalje.138 (II, 15)
Zudem betont der Betreuer an anderer Stelle: „Mnogo je bitniji tvoj odnos prema
Flosenburgu nego da li si ti prebacio tri čamca levo, šest desno i tako.“ (II, 8).139 Die
Phase zu Flossenbürg wird vom Betreuer so als wichtiger bezeichnet als eine detaillierte
Erzählung zu Milošs Partisanenarbeit. Dies setzt voraus, dass der Betreuer die Erzählungen gut kennt und deshalb über die Relevanz der Episoden entscheiden kann. An
dieser Stelle deutet sich eines der auffälligsten Merkmale in der Erzählung des Betreuers an: die Wahrnehmung, dass eine Art von „richtiger“ Version von Milošs Lebensgeschichte existiert, quasi festgeschrieben ist und aus der nun je nach Bedarf Episoden
herausgenommen werden können. Dieses Verständnis zeigt sich u.a. darin, dass der Betreuer Milošs Erzählungen praktisch wie ein Buch liest. Zu Beginn des Interviews,
schlägt er Miloš nicht nur verschiedene Episoden aus seiner Kindheit zum Erzählen vor,
er nimmt die Erzählungen dann auch mit den Worten „Ok in this chapter Miloš is going
to tell about (…)“ (I, 1) vorweg. An anderer Stelle betont er: „You’re lucky for me I
only heard this like about a million times so I know how to navigate through the text“
(III, 28). Dieses Begreifen der Lebensgeschichte als Text, deutet in der Wahrnehmung
des Betreuers eben auf die Existenz einer solchen festgeschriebenen Version hin, in der
er genauso wie der Zeitzeuge in der jeweiligen Situation die relevanten Aspekte finden
kann: „Eh ja but let’s you asked what has changed he I know the stories so I’ll just
prompt him –“ (I, 25). Er leitet nicht nur den Zeitzeugen in bestimmte Erzählbahnen,
auch dem Interviewer unterbreitet er Vorschläge zu in seinen Augen besonders interessanten Fragen:
138
„ … – o.k. ich habe kurz erzählt, dass es die Nilaši gab und dass in Komarno die Regierung wechselte
usw.“
139
„Dein Verhältnis zu Flossenburg ist sehr viel wichtiger als ob du drei Boote nach links übergesetzt
hast oder sechs nach rechts und so.“
55
IOS-Mitteilung Nr. 61
I think it would be a very good point to ask Miloš how did he become involved – Hajde
sad pričaj o onome kad su te pozvali da postaneš član Narodnooslobodilačkog pokreta.
Kako ste bili organizovani? Pričaj o onom Kovaču i sve ostalo!140 (II, 2)
Der Betreuer entscheidet auch durch die Detailliertheit seiner Übersetzung, was wichtig und was unwichtig ist. Als Miloš z. B. eine Liste mit den Namen derer, die in seinem
Dorf der „Razzia“ zum Opfer gefallen waren, zeigen möchte, darunter auch der Name
seines Vaters, reagiert der Betreuer mit: „Ok just a bunch of names that really don’t do
anything for your thesis. – OK!“ (II, 1). Obwohl diese Liste für Miloš offensichtlich wichtig ist, wehrt der Betreuer sie mit dem Hinweis auf die Interessen des Interviewers ab. An
anderer Stelle reagiert er hingegen wesentlich begeisterter, z. B. auf die Bitte, Miloš
nach dem Moment der Befreiung auf dem Todesmarsch zu fragen: „Yes, that’s really a
strong story! – Idemo tačno oslobođenje. Ono kad se video tenkovi i to“ (III, 22).141
Der Betreuer geht aber nicht nur von einer „richtigen“ Erzählung aus, an die man
sich halten muss, es scheint auch die Wahrnehmung durch, dass der Betreuer, als Eingeweihter in die Lebensgeschichte genauso gut die Erzählung übernehmen könnte:
I: Can you ask him how he got to Flossenbürg or just how
B: He got arrested yes – what happened I’ll give you a little prequel someone was arrested and someone started to talk – Hajde ovako- lepo ispričaj kako su ga uhvatili, iako si
mu rekao da ne ide u patrolu i kako je on propevao i sve odao?142 (II, 9)
Da es anscheinend nicht so wichtig ist, wer die Details nun erzählt, solange es die „richtigen“ sind und der Betreuer weiß, welche in diesem Moment gefragt sind, kann er eben
dieses „prequel“ geben, bevor die Sicht des Zeitzeugen überhaupt zur Sprache kommt.
Bei Jureit findet sich in diesem Zusammenhang der Begriff „sekundäre Zeugenschaft“,
eine Entwicklung, die sich zunehmend darin erkennen lässt, dass die von Zeitzeugen an
Angehörige der nächsten Generation weitergebenen Erfahrungen dazu führen, dass diesen
140
„ … – Auf jetzt erzähle davon als sie dich gerufen haben, dass du Mitglied der Volksbefreiungsbewegung wirst. Wie wart ihr organisiert? Erzähle von diesem Schmied und alles andere.“
141
142
„ … – Lasst uns genau zur Befreiung gehen. Diese (Episode) als du die Panzer gesehen hast und das.“
„ … – Weiter geht es folgendermaßen – bitte erzähle wie sie ihn gefangen haben, obwohl du ihm sagtest, er solle nicht zur Patrouille laufen und wie er zu singen anfing und alles verriet?“
56
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Angehörigen zugleich die Berechtigung verliehen wird, an Stelle der Zeitzeugen die Erinnerung kommunizieren zu dürfen.143 Wie sehr sich der Betreuer mit Milošs Erzählung
identifiziert, zeigt sich auch in dem Versuch, dem Interviewer die Tatsache näherzubringen, dass Miloš in der Krankenbaracke zwei Tage lang neben einem Toten lag:
One evening Miloš woke up realised there is something cold around him and he looked
and he realised this guy died so he decided to risk for the next two days so whenever
Zimmerdienst came with food and asked what’s with the other guy Miloš said „Oh he’s
sleeping” so the Zimmerdienst would leave his portion and Miloš ate it and then only after two days he repeat that so basically he was sleeping in the same bed with the corpse
for two days which I don’t really have to tell you how terrible that was! (III, 19).
Da er die Situation nicht selbst erlebt hat, kann er natürlich nicht sagen, wie schlimm
das war, er kann nur Mutmaßungen anstellen. Und doch klingt seine Aussage danach,
dass er derart nah an der Erinnerung des Zeitzeugen ist, dass er durchaus meint, darüber
urteilen zu können. Dieses Mitredenkönnen des Betreuers, verhindert allerdings auch,
dass Miloš sein eigenes „Relevanzsystem“144 aufbauen kann, da der generelle Fortgang
der Erzählung vom Betreuer gesteuert wird:
Čekaj, čekaj, čekaj! – because eh I’m trying to make this short and I’ve heard these stories
millions of times it’s a room on the first floor empty – Koliko vas je bilo u sobi? (M: U sobi
nas je bilo oko šedeset.) sixty of them and it’s empty I mean without furniture and they were
sitting in a very special way Miloš will show you that and they were being heavily guarded –
sad opiši kako ste morali da sedite, gde ste morali da gledate i gde je bila mašinka?145 (II, 11).
Durch das versuchte Vorspulen der Erzählung, springt er für Miloš viel zu weit in der
Erzählung: „E čekaj sada, prvo ide ovo dolazi agent u šest sati…“ (II, 11).146 Er unter-
143
Ulrike Jureit / Christian Schneider, Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, Bonn
2010, S. 86–87.
144
Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung, S. 142.
145
„Warte, warte, warte! – … – Wie viele von euch waren im Zimmer? (M: Von uns waren im Zimmer
etwa 60) … – jetzt beschreibe wie ihr sitzen musstet, wo ihr hinschauen musstet und wo die Maschinenpistole war.“
146
„E warte nun zuerst kommt das hier, um 6 Uhr kam ein Agent ...“
57
IOS-Mitteilung Nr. 61
bricht damit den „Erinnerungsfluss“ des Zeitzeugen, der sich so nicht wirklich in die
Vergangenheit hineinversetzen kann, sondern immer wieder in die Gegenwart geholt
wird.147 Neben der Bestimmung des Fortgangs der Erzählung, übernimmt der Betreuer
an manchen Stellen sogar völlig die Erzählung. Als Miloš beispielsweise erwähnt, dass
er während der ungarischen Besatzungszeit im örtlichen Fußballclub aktiv war, kommt
die genaue Erzählung dazu und eine ergänzende Beobachtung zur Zeit nach der „Razzia“ von Seiten des Betreuers mit dem Hinweis: „Miloš will testify this“ (I, 27). Allerdings kann seine Version natürlich nicht identisch sein mit der, die Miloš möglicherweise erzählt hätte. Worauf Ulrike Jureit in Verbindung mit der oben angesprochenen
„sekundären Zeugenschaft“ auch hinweist, ist, dass diese Entwicklung zugleich auch
eine Veränderung der Zeitzeugenerinnerung impliziert, da sich diese mit den bereits
vorhandenen Erfahrungen und Erinnerungen der Stellvertreter vermischen werden.148
Dies zeigt sich in der Version des Betreuers, in der er nicht nur auf Milošs Erinnerungen eingeht, sondern auch andere miteinbezieht: „Whoever I speak from that period
everybody said that there was some kind of calm“ (I, 27).
Dass der Betreuer die Erinnerungen nicht einfach übernimmt, zeigt sich auch darin,
dass er nicht immer mit der Zeitzeugenversion einverstanden ist und diese in Frage stellt:
Ok eh I’m confused here cause I think in the earlier stories he said it was a Hungarian
controlled camp now first he said that that it was a Hungarian camp but the guy who was
in charge was an SS officer from the eastern front who got transferred now he says that
the camp was completely run by the SS which I find unlikely because it’s still the Hungary is still ruled by Horty and not by the so called Nilases so the Hungary is still isn’t occupied by Germans despite the fact that it’s 1944 but now M. says that this was let’s say a
this camp was sort of a exception and was run by the SS because the SS made sure that
whoever came to this camp was sent to the death camps in Germany so I’m a little bit
confused here (II, 12).
147
Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung, S. 142–143.
148
Ulrike Jureit / Christian Schneider, Gefühlte Opfer, S. 86–87.
58
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Er weist nicht nur auf die Abweichungen zu früheren Erzählungen des Zeitzeugen
hin, er versucht zugleich auch eine logische Version der Erinnerung zu finden. Auch
Aussagen des Zeitzeugen, die möglicherweise als kontrovers verstanden werden könnten, versucht der Betreuer an mehreren Stellen zu entschärfen, bzw. entlarvt Äußerungen als Stereotype (I, 30). Ein Beispiel hierfür ist auch Milošs Schilderung der Machtübernahme der ungarischen Minderheit in seiner Heimatregion. Der Betreuer reagiert
darauf mit der Aussage: „Now this is a very unusual situation and I’m probing Miloš for
the smallest details because eh if you get it wrong you could be discredited here“ (I, 19).
Das gleiche gilt für Milošs Erzählung von einem katholischen Priester, der an vorderster
Linie an der Machtübernahme der Ungarn in seinem Dorf beteiligt gewesen sein soll.
Diese Aussage will der Betreuer so nicht stehen lassen und betont in der Übersetzung:
„Now I am telling you this is very debatable yeah but because it’s hearsay (…) and I
don’t really agree I just I really think it’s an interpretation“ (I, 33).
Doch obwohl der Betreuer mehrmals vermeintliche (Fehl)-Interpretationen des Zeitzeugen entlarvt, finden sich auch in seiner Version der Lebensgeschichte Interpretationen und Hypothesen. In Bezug auf Milošs Verhaftung vermutet er:
The next morning the Croatian patrol the Ustaše were shouting across the river something
basically „hey you stupid Hungarians (lacht) eh your boats are here the partisans have
stolen your boats you idiots“ I guess so that in a way was prompted Hungarians to be
more vigilant in their daily guard duties or nightly guard duties which in a way
[Unterbrechung durch Telefon] which led to Milošs arrest but we will come to that later
[verlässt das Zimmer] (II, 9).
Zu diesem Schluss kommt er, da er den Überblick über Milošs gesamte Lebensgeschichte hat und sich Sinnzusammenhänge eben nachträglich auch selbst rekonstruiert.
Seine Interpretationen führen aber teilweise auch zu einer problematischen Umdeutung
der Episoden. Als Beispiel sei hierfür Milošs Erzählung zum bereits erwähnten Diebstahl eines Butterbrotes aus dem Mantel eines Vorarbeiters genannt. Miloš schildert den
Diebstahl als unüberlegte Zwangshandlung aufgrund des Hungers. Indem der Betreuer
aber die Naivität der Vorarbeiter, die sich einfach von Miloš täuschen lassen, in den
Vordergrund stellt, klingt Milošs panische Reaktion, sich zu melden und zu sagen, je-
59
IOS-Mitteilung Nr. 61
mand anderes habe das Brot gestohlen, nicht wie eine spontane Abwehrreaktion, sondern indirekt wie ein Aufbegehren, bei dem Miloš sich besonders selbstbewusst verhält
(III, 9). Indem er auch an anderer Stelle die Naivität des Blockältesten nicht verstehen
kann, der Miloš mit einem gegen Essen getauschten Stück Holz alleine lässt, sodass er
die Möglichkeit hat, es wieder mitzunehmen und in einer anderen Baracke nochmals
gegen Essen zu tauschen (III, 17), verfälscht er die beim Zeitzeugen eigentlich meist
passive Repräsentation der Häftlinge zu einer aktiveren Rolle.
Ob sich der Betreuer seine Einflussnahme auf die Erzählung nun bewusst macht oder
nicht, er verfolgt das Ziel eine „richtige“ Version der Lebensgeschichte zu präsentieren,
die den vergangenen Ereignissen genauso genügt, wie dem heutigen Blick auf sie. Um das
zu erreichen, versucht er eine Version zu schaffen die durch ihre Genauigkeit unangreifbar ist, zugleich aber auch niemanden angreift. An anderer Stelle warnt er sogar den Zeitzeugen, der kurzzeitig in tagespolitische Themen abgedriftet war, sich gut zu überlegen,
was er erzählt, da sonst möglicherweise das, was er zuvor aus seiner Lebensgeschichte
erzählt hatte, in einem unschönen Licht erscheinen könnte (III, 32). In diesem Zusammenhang können auch die häufigen Hinweise des Betreuers auf die von ihm mit dem
Zeitzeugen produzierten Filmdokumente verstanden werden. Zu Milošs Verhör in Novi
Sad sagt er:
Ok eh just make a mental note here Milošs complete treatment in the interrogation centre
called the armia is on the video that you will get it’s very it’s all photographs it’s all on
video it’s all the places are filmed and the whole story is edited in a very coherent way so
we are going to move now to Bačka Topola which was a transit camp (II, 12).
Da das Filmdokument ordentlich editiert und geordnet ist, besteht für ihn nicht mehr
die Notwendigkeit des mündlichen Erzählens, die Version auf dem Video ist akzeptiert
und festgeschrieben.
Zu welchem Zweck eine solche festgeschriebene Version der Lebensgeschichte hilfreich sein könnte, zeigt sich in der Betrachtung des Verhältnisses von Vergangenheit
und Gegenwart in den Ausführungen des Betreuers. Dabei verbinden sich in seinen
Darstellungen eigene Erfahrungen, bzw. ganz allgemein auch heutige Vorstellungen mit
den Erlebnissen des Zeitzeugen, sowie heutige Bilder der Vergangenheit mit der vom
60
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Zeitzeugen präsentierten damaligen Zeit. So vergleicht er beispielsweise den harten
Winter während der „Razzia“ 1942 mit seinem Erleben des Winters 1993 während des
Bosnienkrieges (I, 30). Noch viel persönlicher werden die Vergleiche u.a. in Reaktion
auf Milošs Erzählungen von diversen Diebstählen im Lager:
and I remember like the second day when I was in the army you know it’s army and prison thing things are always missing people are always stealing from each other so you
don’t see M. as like some kind of you know animal who because of whom somebody else
had problems it was just like that. (III, 11)
Indem er Milošs Erzählung mit eigenen Erfahrungen verbindet, möchte er Verständnis
schaffen für die Bedingungen, die Milošs Verhalten erzwungen haben und damit Milošs
Verhalten auch aus heutiger Sicht verständlich machen. Neben den persönlichen Vergleichen, abstrahiert er aber auch, wie bei seiner Übersetzung der im vorigen Kapitel bereits
analysierten Episode, in der Miloš Mithäftlingen das Abendessen raubte: „If they were
still eating their dinner when the lights were turned off at ten or ten something eh you
would probably try to steal eh that eh his plate and eat it quickly“ (III, 4, Hervorhebung
d. Autor). Während Miloš bei dieser Erzählung deutlich von der Wir-Perspektive in die
Ich-Perspektive wechselte, erreicht es der Betreuer, mit seiner Übersetzung eine Wahrnehmung zu schaffen, dass in diesem Moment jeder so gehandelt hätte. Entsprechend dieser Wahrnehmung, verbindet er Milošs Erinnerungen nicht nur mit seinen eigenen oder
denen, die er von anderen gehört hat (II, 1), sondern setzt sie auch in einen gesellschaftlichen Kontext. Bezeichnend hierfür ist auch seine Erklärung zu der Szene in der Miloš vor
dem jugoslawischen Grabstein in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg steht. Der Betreuer
schildert diesen Moment sehr ausführlich und bringt ihn vor dem Hintergrund des
ehemaligen Jugoslawiens auf den Punkt: „As you know in Flossenburg there are these
grave places for each country and we are still represented with Yugoslavia“ (III, 2). In
seiner Übertragung erscheint Miloš, der allein, ohne Repräsentant, vor dem Grab steht,
auch als Ausdruck des serbischen Erinnerungsverständnisses wie es von den Veteranenvereinen seiner Meinung nach gesehen wird, nämlich, dass ein einfacher Mann wie Miloš
von ihnen nicht gut vermarktet werden kann. Auch die Tatsache, dass die russischen Gefangenen in seiner Baracke Miloš Kartoffeln schenkten, beschreibt der Betreuer nicht ein-
61
IOS-Mitteilung Nr. 61
fach als solches, sondern im größeren Kontext der serbisch-russischen Freundschaft:
„there is this unspoken bond between the Russians and Serbs“ (III, 5). Auf diese Weise
wird aus den persönlichen Erinnerungen des Zeitzeugen durch den Betreuer eine Erinnerung, die in einem wesentlich komplexeren Kontext existiert als die ursprünglichen es
getan haben. Besonders bezeichnend für diesen Vorgang ist eine Stelle im Interview in
dem der Betreuer ausgehend von Milošs Erzählung feststellt:
Ok now this is a very a very story that you hear all over the Holocaust that people maybe
I need strong words but people acting like sheep because their leaders the partisan leaders
who were arrested there in Bačka Topola they spoke with their Hungarian guards and the
Hungarian guards said „ok let’s just let’s make a deal let’s all of us walk eh march into
Hungary proper the end of war is near we need you as we need you as a human shield or
whatever and as soon as we get to Hungary you will be liberated but if you make any
trouble during the way we’ll deal with you“ now as M. said and probably if you interviewed the Jewish concentration camp prisoners eh first of all they were well fed you
have to remember that that we already said it was night eh the soldiers were carrying their
guns on their shoulders there was one soldier with a gun which was not cocked for every
three eh every three prisoners so if the prisoners were better organised if they had let’s
say more guts they could have taken over easily but they didn’t (II, 14).
Der Betreuer stellt Milošs Verfolgungserfahrung hier ganz explizit in den Kontext
des Holocaust. Mit Holocaust meint der Betreuer hier, auch wenn er sich vergleichend
auf die „Jewish concentration camp prisoners“ bezieht, nicht ausschließlich die Verfolgung und Ermordung von Millionen von Menschen jüdischen Glaubens durch die Nationalsozialisten, sondern vertritt eine wesentlich globaler orientierte Auslegung des Begriffes.149 Dubiel erklärt diese zunehmende Verwandlung des Begriffes, weg von der
Beschreibung eines Ereignisses und hin zu einer Metapher, einer Art von „metanarrative“ für das Leid, das sich Menschen gegenseitig zufügen.150 Auch Jureit spricht
von einer zunehmenden Entwicklung, den Holocaust als eine „universale Deutungska-
149
Zur Entwicklungsgeschichte des Begriffs Holocaust siehe: Harold Marcuse, Holocaust Memorials.
The Emergence of a Genre, in: The American Historical Review (2010), Heft 115, S. 53–89, S. S. 53–54.
62
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
tegorie“ zu sehen.151 Indem der Betreuer Milošs Lebensgeschichte in den gesellschaftlichen Kontext einordnet und einer derart bekannten Deutungskategorie wie dem Holocaust zuordnet, ebenso wie wenn er sie mit seinen eigenen Erfahrungen zusammenbringt, versucht er, sowohl Milošs Schicksal als auch die Dimension seiner Erlebnisse
aus heutiger Sicht greifbar und verständlich zu machen. Das Vergangene und das Heute
rücken in den Schilderungen des Betreuers näher zusammen.152
Wozu diese Verschiebung in der ‚erinnerten Erinnerung‘ des Betreuers führt,
lässt sich anschaulich mit Hilfe von Astrid Erlls Fünf Modi der Rhetorik des kollektiven
Gedächtnisses zeigen. Auf die zugrunde liegende Theorie dieses Ansatzes und die
Frage, ob und wie er sich neben literaturwissenschaftlichen Texten auch in der Analyse
lebensgeschichtlicher Interviews eignet, wurde bereits im Methodenkapitel zu Beginn
dieser Arbeit eingegangen. Für die Zwecke der folgenden Analyse soll nun nur auf
die Verbindung von erfahrungshaftigem und monumentalem Modus, sowie darauf aufbauend dem antagonistischen Modus, in den Redeanteilen des Betreuers, eingegangen
werden. Der erfahrungshaftige Modus, lässt sich in den Redeanteilen des Betreuers
häufig dann feststellen, wenn er bei seiner Erklärung der Zeitzeugenerfahrung auf eigene Erfahrungen zurückgreift, sich mit Milošs Erinnerungen also im Prinzip im Rahmen
des kommunikativen Gedächtnisses bewegt,153 womit er eine Annäherung der Zeitzeugenerfahrung an heutiges Empfinden erreicht. Der monumentale Modus lässt
sich dort feststellen, wo er Milošs individuelle Erinnerungen in Verbindung mit gesell-
150
Helmut Dubiel, The Remembrance of the Holocaust as a Catalyst for a Transnational Ethic?, in: New
German Critique (2003), Heft 90, S. 59–70, S. 59–61.
151
Ulrike Jureit / Christian Schneider, Gefühlte Opfer, S. 94–95.
152
Zum Holocaust als „global anerkannte[s] Paradigma im Kampf um Anerkennung“ siehe: Aleida Assmann,
Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, S. 258.
153
Nach Jan und Aleida Assmann bilden kommunikatives und kulturelles Gedächtnis zwei Seiten des
kollektiven Gedächtnisses ab. Das kommunikative Gedächtnis ist geprägt durch den Alltagsgebrauch, es
ist immer in Bewegung und jedes Mitglied einer Gesellschaft hat daran teil. Es bezieht sich auf die eigenen Erfahrungen und Erinnerungen der Mitglieder, es finden aber keine Festschreibungen der Erfahrungen statt. Das kulturelle Gedächtnis hingegen ist auf die abgeschlossene Vergangenheit gerichtet, es beinhaltet Traditionen und bestimmten Sichtweisen auf Vergangenes, die eine Gesellschaft vertritt, also die
gemeinsame Interpretation der Vergangenheit zur Bestimmung der eigenen Position. Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 27–28 u. 113.
63
IOS-Mitteilung Nr. 61
schaftlichen Wahrnehmungsmustern bringt und sie so als Teil des kulturellen Gedächtnisses präsentiert. Das gemeinsame Auftreten dieser beiden Modi beschreibt Erll
wie folgt:
Durch eine Verbindung von erfahrungshaftigem und monumentalen Modus können
literarische Texte [oder in diesem Fall die Lebenserinnerung] zwei wichtige erinnerungskulturelle Funktionen erfüllen: Sie vermögen zum einen überkommene Elemente des
kulturellen Gedächtnisses durch Erfahrungshaftigkeit anzureichern und damit in die
Kontaktzone der Gegenwart (zurück)zuführen – was zugleich aber auch einen gewissen
Verlust an Verbindlichkeit impliziert. Sie können zum anderen (bzw. häufig zugleich) Erfahrung, die im Rahmen außerliterarischer individueller und kommunikativer
Gedächtnisse kodiert wird, exemplarisch als Gegenstand des ‚kulturellen Fernhorizonts‘
darstellen und damit die Transposition von ‚lebendiger Geschichte‘ etwa des Generationengedächtnisses in das kulturelle Gedächtnis literarisch mitformen. Das Oszillieren
zwischen beiden Modi dient im literarischen Text daher der Überführung alltagsweltlicher Erinnerung in kulturelles Gedächtnis ebenso wie der Anreicherung von Inhalten
des kulturellen Gedächtnisses durch Erfahrungshaftigkeit.154
In der ‚erinnerten Erinnerung‘ des Betreuers, erhält Milošs Erinnerung nicht nur eine
Aktualisierung und dadurch eine Bedeutung auch außerhalb der Erlebnisgeneration. Es
findet auch eine Einordnung seiner Erinnerung in das kulturelle Gedächtnis seiner Gesellschaft und in Phänomene statt, die, obwohl sie noch nicht sehr lange zurückliegen
und noch Zeitzeugen dieser Ereignisse leben, bereits ein Teil des gesellschaftlichen
Vergangenheitsbildes geworden sind, wie beispielsweise, in einem Großteil der europäischen Staaten, der Holocaust.155 Dass auch der antagonistische Modus in den Redeanteilen des Betreuers auftaucht, weist darauf hin, dass diese aktive Einschreibung von
Milošs Erinnerungen in das kollektive Gedächtnis nötig scheint, da sie bisher noch nicht
aufgenommen waren. Eine solche, den antagonistischen Modus andeutende, Gegen-
154
155
Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 175.
Astrid Erll schreibt dazu: „In einem gegebenen historischen Kontext [kann] dasselbe Ereignis Gegenstand
des kulturellen und des kommunikativen Gedächtnisses zugleich sein.“ Als Beispiele nennt sie u. a. den
Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 115.
64
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
überstellung von unterschiedlichen Erinnerungsversionen durch den Betreuer, zeigt sich
in seiner Betonung von Milošs „media presence“, in Deutschland wie auch in Serbien
(III, 33). Dieser öffentlichen Person steht jedoch, wie aus mehreren Aussagen des
Betreuers deutlich hervorgeht, ein offensichtliches Desinteresse der serbischen Gesellschaft an Milošs Schicksal entgegen:
Miloš here has a lot of problems of keeping this Holocaust memory alive because eh
according to the leaders now I’m saying this because he didn’t say it so you need to
understand according to the leaders of the war veterans what should be commemorated
here in Serbia is the are the glorious battles and and the [raid?]“ (III, 2)
Diese vom Betreuer betriebene Gegenüberstellung von Erinnerungsversionen in Verbindung mit der Einordnung des Opferaspekts in Milošs Vergangenheit in anerkannte Muster des kommunikativen wie auch kulturellen Gedächtnisses, dient so nach Erll „zur Legitimierung eigener und zur Delegitimierung anderer Gedächtnisnarrative“.156 Die ‚erinnerte
Erinnerung‘ des Betreuers strebt also auch eine Sensibilisierung der eigenen Gesellschaft
für Milošs Schicksal und damit auch für das Schicksal anderer serbischer KZ-Gefangener
des Zweiten Weltkriegs an.157 In diesen Zusammenhang passt auch sein Wunsch, eine
Publikation von Milošs Erinnerungsberichten in Serbien zu erreichen (III, 28).
Im Unterschied zur Erinnerung des Zeitzeugen, tritt in der ‚erinnerten Erinnerung‘
des Betreuers die persönliche Kohärenz der Lebensgeschichte in den Hintergrund
vor der heutigen Sicht auf die Narration, weniger wer erzählt ist wichtig als wem
die Geschichte erzählt wird. Indem also die Person des Erzählers hinter der Erzählung
zunehmend zurücktritt, kristallisiert sich aus den Schilderungen des Betreuers ein
abstrakteres Bild von Milošs Verfolgungserfahrung heraus. Während Miloš, wie be-
156
Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 182.
157
Zur erinnerungskulturellen Bedeutung des Zweiten Weltkriegs in Serbien schreibt Natalija Bašić:
„Untersuchungen zur gegenwärtigen Erinnerungskultur in Kroatien und Serbien zeigen insgesamt, dass
der Zweite Weltkrieg weiterhin großes Interesse in der politischen und medialen Öffentlichkeit findet,
wobei die Ansichten über Kollaboration und Widerstand kontrovers sind und man kaum von einer
konsensuellen Lesart der Vergangenheit sprechen kann, die im Stande wäre, so etwas wie neue Basiserzählungen zu begründen.“ Natalija Bašić, „Wen interessiert heute noch der Zweite Weltkrieg?“, S. 153.
65
IOS-Mitteilung Nr. 61
schrieben, bestimmte feste Muster entwickelt hat, um von seinem eigenen Überleben
sprechen zu können, dienen diese Muster dem Betreuer sogleich auch dazu, diese
festgeformte und genau umrissene Erzählung an größere Erinnerungskollektive
anzuknüpfen.
66
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
5 Lebensgeschichtliche Erzählungen als Erinnerungsorte?
5.1 Einordnung der „Lebensgeschichte“ in die Erinnerungstheorie
Indem der Betreuer Milošs Lebensgeschichte in einen größeren Sinnzusammenhang
stellt, wird sie gerade auch im Rahmen des kollektiven Gedächtnisses für einen weitreichenden Personenkreis, und dessen Blick auf die Vergangenheit, relevant. Abschließend
ist nun deshalb der Frage nachzugehen, ob eine Lebensgeschichte (auch in Verbindung
mit anderen Lebensgeschichten) zu einem „Ort der Erinnerung“ an die nationalsozialistische Verfolgung werden kann.
Laut Pierre Nora manifestiert sich das kollektive Gedächtnis einer sozialen Gruppe an
sogenannten „Lieux de mémoire“, Erinnerungsorten oder auch Gedächtnisorten. Der Begriff „Ort“ ist dabei sehr weit gefasst und bezieht sich nicht nur auf materielle Objekte,
sondern auch auf symbolische Vorstellungen.158 Zu Erinnerungsorten im eigentlichen
Sinn, werden tatsächliche Orte oder Symbole jedoch erst dann, wenn sie neben einer materiellen und funktionalen Bedeutung auch eine symbolische Ebene aufweisen, also eine
Art „symbolische Aura“.159 Der Gedanke, eine Lebensgeschichte als Erinnerungsort zu
begreifen steht damit im Gegensatz zur Gruppe der traditionelleren Erinnerungsorte, wie
beispielsweise Gedenkstätten oder Denkmäler, die tatsächlich „fassbare Gegenstände“160
darstellen. Dass ein Interview jedoch auch als Text verstanden werden kann, wurde mit
Hinweis auf die „Dokumentarliteratur“ bereits zu Anfang dieser Arbeit beschrieben und
zeigt sich eben auch darin, dass Milošs Betreuer die Erzählung als „Text“ begreift (III,
28). Damit wird die im Interview aufgezeichnete Lebensgeschichte gleichsam zu einem
materiell greifbaren Objekt. Funktional ist sie mit Hinblick auf die Forschung ebenso und
auch als Möglichkeit für den Zeitzeugen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.161 Die symbolische Ebene der Lebensgeschichte ist darin zu sehen, dass sie einen
sehr persönlichen Einblick aus dem heute in die nationalsozialistische Verfolgungsver-
158
Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt a. M. 1998, S. 7–8.
159
Ebd., S. 32.
160
Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 24.
67
IOS-Mitteilung Nr. 61
gangenheit bietet. Schließlich lässt sich argumentieren, dass obwohl die erlebte Geschichte nur in der Rekonstruktion der erzählten Geschichte wieder auflebt, sie dennoch nicht
erfunden ist, sondern symbolisch für die Vergangenheit stehen kann.162
Die Erinnerungsorte selbst sind für Nora „zunächst einmal Überreste“, „nicht mehr
ganz das Leben und noch nicht ganz der Tod“, mehr oder weniger noch das, was „eine
Gemeinschaft, die bis in ihre Grundfeste in Wandel und Erneuerung hineingerissen ist,
künstlich und willentlich ausscheidet, aufrichtet, etabliert, konstruiert, dekretiert, unterhält“.163 Diese „Orte“ stehen für die Gesellschaft demnach nicht im Mittelpunkt,
sondern sind stattdessen immer in Gefahr zu verschwinden. Gedächtnisorte bei Pierre
Nora sind Orte, an denen sich das kollektive Gedächtnis festklammert164, um ihre
Bedeutung noch ein bisschen länger wach zu halten.165 Auch die Erinnerung der Zeitzeugen befindet sich im Übergang. Ihre Lebensgeschichten können zwar archiviert und
erhalten werden, die Zeitzeugen selbst aber werden nicht mehr lange erzählen können.
Die Erzählungen werden also ohne ihre Autoren zurückbleiben. Dennoch besteht für
eine Gesellschaft die Notwendigkeit, die persönlichen Erfahrungen der Zeitzeugen zu
nutzen, um einen direkten Zugang zu einer Vergangenheit zu erhalten, die für nachkommende Generationen immer weiter entfernt sein wird.166 Um die Verbrechen der
Nationalsozialisten also auch in Zukunft wach halten zu können, bedarf es einer festen
Verankerung der Erinnerung daran im kollektiven Gedächtnis. Julia Herzberger beschreibt, wie diese Verankerung beispielsweise mit Hilfe der Holocaust-Literatur der
Zweiten Generation funktionieren kann. Auch Lebensgeschichten bieten die Möglichkeit sich anderen mitzuteilen, und die Erfahrung so zu einem Bestandteil des kollekti-
161
Thomas Rahe, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte, S. 85.
162
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 93.
163
Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, S. 19–20.
164
Pierre Nora, Das Abenteuer der Lieux de mémoire, in: Etienne François (Hrsg.), Nation und Emotion.
Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 1995, S. 83–92, S. 83.
165
166
Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, S. 21.
Nina Leonhard, Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus im
Verlauf von drei Generationen, in: Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg (Hrsg.), Erinnern des Holocaust?
Eine neue Generation sucht Antworten, Bielefeld 2006, S. 63–80, S. 79.
68
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
ven Gedächtnisses werden zu lassen.167 Dies wird umso wichtiger je weiter die Erfahrungswelt in den Lebensgeschichten von der heutigen wegrückt. Auch Nora sieht die
Bedeutung der Erinnerungsorte dort entstehen, wo die Erinnerung der Menschen
von der Phase des Gedächtnisses, also der direkt erlebten Erinnerung, übergeht in die
Geschichte, wo die Erinnerungen rekonstruiert werden müssen, da sie aus der direkten
Erlebniswelt verschwunden sind.168 Mit dem Sterben der Zeitzeugengeneration befindet
sich die heutige Gesellschaft genau an diesem Punkt.
Allerdings haben die Erinnerungsorte Noras keine wirklich eigene Dynamik: Würde
man ihrer nicht gedenken, und sie damit im Gedächtnis halten, würden sie, so Nora, aus
dem Gedächtnis herausfallen und zu Geschichte werden.169 Aufgabe der Nachkommen
wird aber sein, eine Möglichkeit zu finden, Erfahrungen wie die von Miloš im kollektiven Gedächtnis aufrechtzuerhalten.170 Wie Andrzej Szczypiorski schreibt, bedeutet
das Nichtwissen um die Kriegsgeschehnisse (...) also ein Nichtwissen um die menschliche
Natur. Ein Mensch, der nie von Auschwitz gehört oder zwar gehört, aber es nicht
geglaubt hat, kennt sich selber nicht und weiß wenig über seine eigenen Möglichkeiten,
Böses zu tun.171
So sehen sich viele Überlebende auch heute noch „Rechtfertigungsansprüchen einer
Gesellschaft gegenübergestellt, die entsprechend ihrer ‚freien‘ Normen argumentiert, ohne
die fundamentale Negation, die die Massenvernichtung bedeutete, wahrzunehmen“.172
In dieser Hinsicht bieten die Erinnerungen der Zeitzeugen der nationalsozialistischen
Verfolgung eine Chance: Ihre Lebensgeschichten, die die Erfahrung und die Folgen dieser
167
Julia Herzberger, Erinnerungsarbeit der Holocaustliteratur der zweiten Generation. Am Beispiel von
Gila Lustiger, Minka Pradelski und Viola Roggenkamp, Göttingen 2009, S. 114.
168
Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, S. 18–19.
169
Ebd., S. 20–21.
170
Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg, Vorwort, S. 14.
171
Andrzej Szczypiorski, Kampf wider die Dummheit, in: Reinhard Matz, Die unsichtbaren Lager. Das
Verschwinden der Vergangenheit im Gedenken, Reinbek bei Hamburg 1993, S. 11–14, S. 12.
172
Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster, S. 125.
69
IOS-Mitteilung Nr. 61
„fundamentalen Negation“ in sich tragen, können in ihrer persönlichen Veranschaulichung der Vergangenheit zu bleibenden Mahnungen im kollektiven Gedächtnis werden.
Betrachtet man Lebensgeschichten als Erinnerungsorte, so wird es jedoch auch notwendig werden, sie nicht nur als etwas zu verstehen, das nach Nora im Stande ist, „die
Zeit anzuhalten, der Arbeit des Vergessens Einhalt zu gebieten, einen bestimmten Stand
der Dinge festzuhalten“.173 Denn das würde bedeuten, dass sie mit der Zeit doch wieder
aus dem kollektiven Gedächtnis fallen würden, da sie irgendwann nicht mehr in vorherrschende Sichtweisen passen.174 Maurice Halbwachs beschreibt in seiner Theorie zu
den sozialen Rahmen einer Gesellschaft dazu, dass
das gesellschaftliche Denken wesentlich ein Gedächtnis ist, und dass dessen ganzer Inhalt
nur aus kollektiven Erinnerungen besteht, dass aber nur diejenigen von ihnen und nur das
an ihnen bleibt, was die Gesellschaft in jeder Epoche mit ihren gegenwärtigen Bezugsrahmen rekonstruieren kann.175
Der Verweis auf die „Bezugsrahmen“ ist hier besonders hervorzuheben. Damit ist
gemeint, dass wir uns beim individuellen Erinnern z.B. innerhalb eines gesellschaftlichen Bezugsrahmens bewegen, der allein es uns ermöglicht, diese Erinnerung zu rekonstruieren.176 Nach Halbwachs rückt damit jede Generation eine Erinnerung oder in
diesem Fall einen Erinnerungsort wieder auf ihre Art in den Mittelpunkt, indem sie ihm
innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens eine für diese Generation neue und allgemein
relevante Bedeutung zuweist.177 Die große Herausforderung dabei bleibt selbstverständlich, zu berücksichtigen, dass „die Gegenwart und ihre sozialen Rahmungen das
Gedächtnis stärker prägen als die Vergangenheit selbst, und dass sich Erinnerungsgemeinschaften auf der Basis der hiermit verbundenen Sinnwünsche, Deutungsab-
173
Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, S. 33.
174
Ebd., S. 33–35.
175
Maurice Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Berlin 1985, S. 390.
176
Ebd., S. 21 u. 146.
177
Ebd., S. 149 u. 197.
70
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
sichten und Gefühlslagen zusammenfinden“.178 Das bedeutet, dass Erinnerungen nicht
einfach so rekonstruiert werden, sondern immer auch die Notwendigkeit besteht, die
Erinnerungsorte in einem aktuellen Kontext zu erklären, um sie so „den Denkweisen
der Menschen von heute und ihrer Art, sich die Vergangenheit vorzustellen, anzupassen.“179 Nur so kann gewährleistet werden, dass eine Gesellschaft in den Erinnerungsorten etwas für sie Relevantes findet. Auch in diesem Zusammenhang bietet gerade ein
Erinnerungsort „Lebensgeschichte“ weitreichende Möglichkeiten, insbesondere in Form
der „interaktiven Weitergabe“ der Erinnerungen im „Generationendialog“.180 Ein Beispiel für diesen Dialog und die damit verbundene Wandlung der Erinnerung sind Miloš
und sein Betreuer. Aber auch für die Zeit nach den Zeitzeugen und auch außerhalb des
Generationenbegriffs, besteht die Möglichkeit, dass Lebensgeschichten eine zentrale
Rolle in der Kommunikation von Vergangenheitserfahrungen darstellen. Vor allem
die Gedenkstättenarbeit kann in Zukunft als ein Bereich gesehen werden, in dem
die Bedeutung von Zeitzeugenerzählungen für die Gegenwart verdeutlicht wird. Aus
diesem Grund soll nun abschließend noch ein Ausblick auf die Erinnerungsarbeit der
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg gegeben werden.
5.2 Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und ihre Überlebenden
Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg hat in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Wandel durchlaufen. Zwar gab es schon direkt nach dem Krieg mit dem Ehrenfriedhof eine
Gedenkstätte, doch das Areal des Lagers wurde in den Folgejahren ohne Rücksicht auf
seine Vorgeschichte zu wirtschaftlichen und wohnungsbautechnischen Zwecken verändert. Auch die Schaffung einer „friedhofs- und parkähnlich gestaltete Erinnerungslandschaft in der Gedenkstätte“ führte zu einer Überdeckung der Lagervergangenheit. Davon ausgehend dominierte in Flossenbürg für lange Zeit das „Totengedenken“, d. h. der
Fokus lag explizit auf dem Vergangenen, das im Prinzip in Ruhe gelassen werden
178
Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg, Vorwort, S. 13.
179
Maurice Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 231.
180
Ulrike Jureit, Generationenforschung, S. 69.
71
IOS-Mitteilung Nr. 61
sollte. Allerdings waren diverse Stellen über Jahre darum bemüht, es nicht bei der rein
symbolischen Aussage des Ortes zu belassen, sondern ein Forschungs- und Dokumentationszentrum aufzubauen.181
Mit der schrittweisen Neugestaltung der Gedenkstätte ab Mitte der 90er Jahre rückte
schließlich zunehmend der Fokus auf die Vergangenheit des Lagers, viel relevanter für
diese Arbeit, jedoch auch auf die wenigen Überlebenden des Lagers.182 Dies drückt sich
im Konzept der ersten Dauerausstellung „Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945“
aus, die im Jahr 2007 eröffnet wurde. Im Konzept dieser Ausstellung heißt es explizit,
dass besonders die „Binnenperspektive der Häftlinge auf das unmenschliche Lagersystem in den Mittelpunkt der Erzählung“ gestellt werden soll, was u.a. in der Präsentation
von Einzel- und Gruppenschicksalen realisiert wurde.183 In der sich an den Betrachtungszeitraum der ersten Ausstellung anschließenden, im Jahr 2010 eröffneten, zweiten
Dauerausstellung „WAS BLEIBT – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg“, geht es schließlich um die Frage, was in den 65 Jahren nach der Befreiung mit
dem Konzentrationslager passiert ist. Dabei wird sowohl die Frage nach dem Ort selbst,
als auch den Tätern und den Opfern aufgeworfen. Eine zentrale Rolle in der Ausstellung
kommt gerade auch den Überlebenden des Konzentrationslagers zu, vor allem in Form
der Frage: „Wie leben die ehemaligen Gefangenen mit der schrecklichen Erfahrung der
KZ-Haft weiter?“ 184
In diesem Kontext werden damit auch wieder Lebensgeschichten, wie die von Miloš
bedeutsam, da sie neben der Lagererfahrung, auch die Folgen des nationalsozialistischen
Terrors aufzeigen können, die für sie unter Umständen weit über die Lagerhaft hinausgingen. Die Erinnerungen der Überlebenden, neben den in der Ausstellung auch behandelten
Geschichten der Täter, bieten durch eine Beschäftigung mit „der Gegenwart der Vergan-
181
Jörg Skriebeleit, Flossenbürg – Stammlager, S. 59–60.
182
Laut Aussage des Archivs der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg befinden sich die Mitarbeiter heute in
Verbindung mit 250 ehemaligen Häftlingen, von denen 50 am diesjährigen Treffen der Überlebenden
teilnahmen.
183
Alexander Schmidt, Geschichte auf zwei Ebenen. Die neue Dauerausstellung „Konzentrationslager
Flossenbürg 1938–1945“, in: Dachauer Hefte (2007), Heft 23, S. 236–246, S. 237, 240–241.
72
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
genheit“, wie es im Ausstellungskatalog heißt,185 in dieser Hinsicht auch eine Möglichkeit
zur Sensibilisierung der Menschen heute für die Ursachen, die zu solch menschenverachtenden Systemen wie dem des Nationalsozialismus führten und für die Folgen, die noch
lange nach der Erlebnisgeneration spürbar bleiben.186 Besonders deutlich macht dies
schließlich auch eine 2011 eröffnete Fotoausstellung in der KZ-Gedenkstätte, mit dem
Titel „In uns der Ort“, in der Portraits einer Reihe von Überlebenden gezeigt werden, eingerahmt von Fotografien des Lagergeländes. Der Fokus dieser Ausstellung auf die Jetztzeit, unterstreicht einmal mehr, dass die Ereignisse von damals in Form der Überlebenden
noch immer sprichwörtlich unter uns weilen. Die Portraits der alternden Zeitzeugen verdeutlichen aber auch, dass die Gedenkstätte sich nicht nur für die Zeit ihres Lebens interessiert, die sie im KZ verbringen mussten, sondern dass auch das ganze restliche Leben
für die historische Aufarbeitung relevant ist.187 Die Verbindung zu den Überlebenden bietet die Möglichkeit, einem der Ansprüche der zweiten Dauerausstellung gerecht zu werden, nämlich „das Gestern mit dem Heute und Morgen in Beziehung zu setzen“.188
Auch das jährlich stattfindende Treffen der Überlebenden in der KZ-Gedenkstätte,
deutet an, dass die Überlebenden eine zentrale Stellung in der Erinnerungsarbeit der Gedenkstätte einnehmen und die Lücke zwischen damals und heute zu schließen versuchen,
auch wenn klar ist, dass die Zeitzeugen mit ihren Erinnerungen nicht mehr lange zur Verfügung stehen werden. Darauf und auf die zentrale Bedeutung der Überlebenden für die
Gedenkstätte wird auch im Rahmen des neuen Ausstellungskatalogs Bezug genommen:
184
Jörg Skriebeleit, Vorwort, S. 10.
185
Ulrich Schwarz, Gestaltungskonzept, in: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Hrsg.), Was bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg. Katalog zur Dauerausstellung, Flossenbürg 2011,
S. 14–17, S. 14.
186
Vgl. dazu die Äußerung von Charlotte Knobloch: „Wir müssen uns gemeinsam bewusst machen, was
passieren konnte, um zu begreifen, was passieren kann. Nur wenn wir die Vergangenheit aufarbeiten,
sind wir in der Lage, die richtigen Lehren für die Gestaltung unserer Zukunft zu ziehen. (…)“ Charlotte
Knobloch, Rede anlässlich der Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit im Festsaal Werdenfels
am Richard-Strauss-Platz, Garmisch-Partenkirchen 5. 10. 2011, S. 25–28.
187
Siehe dazu auch ein Interview mit der Fotografin Renate Niebler: Wilhelm Warning, Interview mit
Renate Niebler zur Ausstellung „In uns der Ort“, 9. 9. 2011, in: Bayern 2 Kulturwelt: http://www.br.de/
radio/bayern2/sendungen/kulturwelt/Flossenbuerg-ausstellung100.html (letzter Zugriff: 23. 11. 2011).
188
Ulrich Schwarz, Gestaltungskonzept, S. 16.
73
IOS-Mitteilung Nr. 61
Die Gedenkstättenarbeit wird in dem Bewusstsein geleistet, dass die Überlebenden nur
noch kurze Zeit persönlich Zeugnis ablegen können. Es ist nicht zuletzt den ehemaligen
Häftlingen und ihren Verbänden zu verdanken, dass Flossenbürg zu einem europäischen
Erinnerungsort geworden ist. Ihre Erfahrungen an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben – das sehen sie als ihre Aufgabe und ihr Vermächtnis.189
Unterstützung erhalten die Überlebenden dabei auch von der Gedenkstätte, die es
durch ihr Konzept ermöglicht, dass die Erinnerungen der Überlebenden weiteren Generationen zugänglich gemacht werden, indem eine Ausweitung des Betrachtungszeitraumes stattfindet. Das Zurückblicken auf die schrecklichen Ereignisse im KZ Flossenbürg
und seinen Außenlagern wird nicht aus dem Blick verloren, aber zugleich wird der
Blick geöffnet auf die Zeit zwischen 1945 und heute. Dadurch bietet die Gedenkstätte
die Möglichkeit weiter zu gehen, die Ursachen des Leids mitzunehmen in eine aktuellere Zeit, und so (zukünftig) auch die Einsicht zu unterstreichen, dass „die Entscheidung
für Völkermord, ethnische Säuberungen, Deportationen nicht das Problem einer abgeschlossenen Vergangenheit darstellt, sondern eines der Gegenwart ist“.190
Wie bei Miloš und seinem Betreuer wird es auch für die Gedenkstätte in Zukunft darum
gehen, mit Blick auf die Vergangenheit der Überlebenden sowohl die damalige als auch die
heutige Perspektive zu verhandeln. Dass die Lebensgeschichten der KZ-Opfer bereits jetzt
von neuen Generationen in Perspektive gesetzt werden, zeigt sich nicht nur darin, dass viele Angehörige die Gedenkstätte mit den Zeitzeugen besuchen und auch selbst von einer
engen Verbindung zu diesem Ort sprechen, sondern auch darin, dass an vielen Stellen Angehörige der nächsten Generation das Sprechen für die Zeitzeugen übernehmen.191 Dieser
Entwicklung wird auch in der Dauerausstellung „WAS BLEIBT“ durch die offene Gestaltung Raum gegeben: Im Ausstellungskatalog wird darauf hingewiesen, dass dies notwendig
sei, da „Erinnerung (…) stets ein offener Prozess [ist], denn sowohl die Akteure als auch
189
190
Annette Kraus, Hinterlassenschaften, S. 163.
Harald Welzer, ‚Ach Opa!‘. Einige Bemerkungen zum Verhältnis von Tradierung und Aufklärung, in:
Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg (Hrsg.), Erinnern des Holocaust? Eine neue Generation sucht Antworten, Bielefeld 2006, S. 47–62, S. 60–61.
74
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
die Haltungen wandeln sich mit dem jeweiligen Zeitkontext“. Aus diesem Grund hat „die
Ausstellung (…) bewusst keinen Schluss, sondern einen Epilog, der abermals die Frage
nach dem stellt, WAS BLEIBT und die Besucherinnen und Besucher zu einer eigenen
Meinungsäußerung auffordert“.192 Es wird wichtig sein, sich in Zukunft auch die Wahrnehmung der Nachkommen anzusehen. Auch wenn sie nur indirekt von der Vergangenheit
der Erlebnisgeneration betroffen sind, sind sie doch Ausdruck dafür, dass „das Erfahrungsreservoir einer Generation“ nicht einfach mit dem Tod der Zeitzeugen endet, sondern neue
Formen annimmt.193 In Anlehnung an den Titel der Fotoinstallation ließe sich der „Ort“
wohl auch in den nächsten Generationen auf die eine oder andere Weise finden.
Indem die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg mit ihrer Herangehensweise „die Grenzen
bisheriger zeithistorischer Präsentationsformen bewusst überschreite[t]“,194 läuft sie
dennoch nicht Gefahr, seinen Bezug zum tatsächlichen Ereignis, der Verfolgung im
Konzentrationslager, zu verlieren und so zu einer „Entleerung“ der Erinnerung beizutragen.195 Stattdessen schafft man es, die KZ-Erinnerungen an diesem Ort in einen größeren Kontext zu setzen. Die Dauerausstellungen kombinieren sowohl ein Zurück- als
auch ein Nachvorneschauen und wie das Gestaltungskonzept vorsieht, ist der Titel der
Dauerausstellung „WAS BLEIBT“ zugleich auch mit der Frage nach dem „was wird“
verbunden.196 Damit zeichnet sich die Erinnerungsarbeit der KZ-Gedenkstätte dadurch
aus, dass sie den Besuchern einen historischen Rahmen, zugleich aber auch einen
Wegweiser für die Frage nach der zukünftigen Erinnerung an diesem Ort bietet.
191
Fazit einer Besucherbefragung der Autorin beim Treffen der ehemaligen Häftlinge des KZ Flossenbürg am 16. Juli 2011.
192
Jörg Skriebeleit, Vorwort, S. 12.
193
Ulrike Jureit, Generationenforschung, S. 85.
194
Jörg Skriebeleit, Vorwort, S. 12.
195
Oliver Marchart, Umkämpfte Gegenwart. Der „Zivilisationsbruch Auschwitz“ zwischen Singularität,
Partikularität, Universalität und der Globalisierung der Erinnerung, in: Heidemarie Uhl (Hrsg.), Zivilisationsbruch und Gedächtniskultur. Das 20. Jahrhundert in der Erinnerung des beginnenden 21. Jahrhunderts, Innsbruck / München 2003, S. 35–65, S. 56–57.
196
Ulrich Schwarz, Gestaltungskonzept, S. 17.
75
IOS-Mitteilung Nr. 61
6 Fazit
Ziel dieser Arbeit war es, die Lebenserinnerungen des KZ-Überlebenden Miloš zu analysieren, um so einen Einblick in seinen Umgang mit der Vergangenheit zu erhalten und
sie den ‚erinnerten Erinnerungen‘ seines Betreuers gegenüberstellen zu können.
Milošs Erinnerungen sind von einem zentralen „Überlebensdiskurs“ gekennzeichnet, wie ihn Ulrike Jureit auch für andere lebensgeschichtliche Erzählungen mit
Opfern der Konzentrationslager beschreibt. Dies umfasst ein Beschreiben zugleich
aber auch eine Rechtfertigung seines Überlebens. Die KZ-Erfahrung sticht in Milošs
Lebenserzählung besonders deutlich hervor, da sie auch einen Bruch in seiner
Lebensgeschichte andeutet, der sich auf den jugoslawischen Nachkriegsdiskurs die
Überlebenden der Konzentrationslager betreffend bezieht. Die Zweiteilung seiner
Lebensgeschichte in Partisanenvergangenheit und KZ-Vergangenheit ist Ausdruck
dieses Bruches und drückt die unbeantworteten Frage aus, ob beide Aspekte seiner
Biographie, das Heldenhafte und das Leidvolle, vor seinem nationalen Hintergrund
bestehen können, da weder in Jugoslawien noch im heutigen Serbien seine Vergangenheit bedeutend gewürdigt wird. Davon geprägt ist auch sein Umgang mit der
Vergangenheit, die er als aktiver Zeitzeuge mithilfe seiner Lebensgeschichte anderen
näher bringen möchte, um so auf die Folgen von Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen.
Milošs Betreuer erzählt in seinen gedolmetschten Redeanteilen gleichsam eine
leicht andere Version von Milošs Lebensgeschichte, die in dieser Arbeit als seine ‚erinnerte Erinnerung‘ bezeichnet wurde. Er verfügt über eine Art sekundäre Autorität
über die Lebensgeschichte und übernimmt an manchen Stellen selbst die Erzählung,
die er durch zusätzliche Informationen, Erklärungen und Interpretationen ergänzt.
Indem er zudem Milošs Erzählungen mit eigenen Erfahrungen verbindet und in den
Kontext von Ereignissen setzt, die Eingang ins kulturelle Gedächtnis gefunden haben,
wie beispielsweise dem Holocaust, aktualisiert er zum einen Milošs Erinnerungen,
hebt sie zum anderen aber auch auf eine abstraktere Ebene. Milošs persönliche Erzählung wird von seinem Autor losgelöst und zu einer Erfahrung des kollektiven
76
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Gedächtnisses. Für Milošs Betreuer ist diese Einordnung vor allem auch wichtig in
Hinsicht auf die Erinnerungskultur seiner Heimat Serbien, in der seiner Meinung nach
die Lebenserfahrung von Menschen wie Miloš nicht ausreichend gewürdigt wird.
Ausgehend von der durch den Betreuer vorgenommenen Einordnung der Zeitzeugenerinnerung in das kollektive Gedächtnis bietet sich eine Wahrnehmung von Lebensgeschichten als Erinnerungsorte für die nationalsozialistische Verfolgungserfahrung an.
Nach Nora stellen sich diese Orte schließlich gegen das Vergessen und halten die betreffende Erfahrung im kollektiven Gedächtnis. Um jedoch ein Weiterbestehen der Erinnerung über den Tod der Zeitzeugen hinaus zu gewährleisten, wird es, mit Halbwachs
gesprochen, nötig sein, die Bezüge, die mithilfe der Lebensgeschichten zur Vergangenheit hergestellt werden können, den sozialen Rahmen der Gesellschaft anzupassen und
jeder Generation die Möglichkeit zu geben, für sie relevantes darin neu zu entdecken.
Ein Ort wo dies bereits passiert ist die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, die nicht nur ein
Zeichen setzt durch die rege Beteiligung der Überlebenden an der Erinnerungsarbeit,
sondern auch durch ihre wegweisenden Ausstellungsprojekte, die durch ihre kontextuelle Ausweitung des zu erinnernden Ereignisses Raum lassen für das Miteinander von
Erinnerung und ‚erinnerter Erinnerung‘.
77
IOS-Mitteilung Nr. 61
7 Quellen- und Literaturverzeichnis
7.1 Primärquellen
Lebensgeschichtliche Interviews mit Miloš
(Auf Anfrage einsehbar im Archiv der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg)
– Interview I am 25. Mai 2011 in Novi Sad
– Interview II am 26. Mai 2011 in Novi Sad
– Interview III am 27. Mai 2011 in Novi Sad
7.2 Sekundärliteratur
Assmann, Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006.
Bašić, Natalija, „Wen interessiert heute noch der Zweite Weltkrieg?“ Tradierung von Geschichtsbewusstsein in Familiengeschichten aus Kroatien und Serbien, in: Harald Welzer
(Hrsg.), Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedächtnis, Frankfurt a.M. 2007, S. 150–185.
Benz, Wolfgang / Distel, Barbara, Einleitung, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel (Hrsg.), Der
Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück, München 2006, S. 9–13.
Bethke, Carl, Deutsche und ungarische Minderheiten in Kroatien und der Vojvodina 1918–1941.
Identitätsentwürfe und ethnopolitische Mobilisierung, Wiesbaden 2009.
Birkmeyer, Jens / Blasberg, Cornelia, Vorwort, in: Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg (Hrsg.),
Erinnern des Holocaust? Eine neue Generation sucht Antworten, Bielefeld 2006, S. 7–15.
Boeckh, Katrin, Serbien Montenegro. Geschichte und Gegenwart, Regensburg 2009.
Breckner, Roswitha, Von den Zeitzeugen zu den Biographen. Methoden der Erhebung und
Auswertung lebensgeschichtlicher Interviews, in: Berliner Geschichtswerkstatt (Hrsg.), Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte. Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte,
Münster 1994, S. 199–222.
Calic, Marie-Janine, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, Bonn 2010.
Dubiel, Helmut, The Remembrance of the Holocaust as a Catalyst for a Transnational Ethic?,
in: New German Critique (2003), Heft 90, S. 59–70.
78
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Dublon-Knebel, Irith, Transformationen im Laufe der Zeit. Re-Präsentationen des Holocaust in
Zeugnissen der Überlebenden, in: Insa Eschebach / Sigrid Jacobeit / Silke Wenk (Hrsg.), Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids, Frankfurt a.M. / New York 2002, S. 327–342.
Erll, Astrid, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart / Weimar 2005.
Halbwachs, Maurice, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Berlin 1985.
Herzberger, Julia, Erinnerungsarbeit der Holocaustliteratur der zweiten Generation. Am Beispiel
von Gila Lustiger, Minka Pradelski und Viola Roggenkamp, Göttingen 2009.
Hirsch, Marianne, Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory, Cambridge Mass. /
London 1997.
Jeggle, Utz, Verständigungsschwierigkeiten im Feld, in: Utz Jeggle (Hrsg.), Feldforschung.
Qualitative Methoden in der Kulturanalyse, Tübingen 1984, S. 93–112.
Jureit, Ulrike, Erinnerungsmuster. Zur Methodik lebensgeschichtlicher Interviews mit Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager, Hamburg 1999.
Jureit, Ulrike, Generationenforschung, Göttingen 2006.
Jureit, Ulrike / Schneider, Christian, Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung,
Bonn 2010.
Karge, Heike, Steinerne Erinnerung – versteinerte Erinnerung? Kriegsgedenken in Jugoslawien
(1947–1970), Wiesbaden 2010.
Kavčič, Silvija, Etablierung eines Erzählmusters. Slowenische KZ-Überlebende im sozialistischen Nachkriegsjugoslawien, in: Julia Obertreis / Anke Stephan (Hrsg.), Erinnerungen nach
der Wende. Oral History und (Post-)sozialistische Gesellschaften, Essen 2009, S. 221–232.
Kavčič, Silvija, Überleben und Erinnern. Slowenische Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager
Ravensbrück, Berlin 2007.
Knobloch, Charlotte, Rede anlässlich der Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit im
Festsaal Werdenfels am Richard-Strauss-Platz, Garmisch-Partenkirchen 5. 10. 2011.
Kraus, Annette, Hinterlassenschaften. 1995–2010, in: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Hrsg.).
Was bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg. Katalog zur Dauerausstellung, Flossenbürg 2011, S. 160–163.
79
IOS-Mitteilung Nr. 61
Langbein, Hermann, … nicht wie die Schafe zur Schlachtbank. Widerstand in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern 1938–1945, Frankfurt a.M. 1980.
Leonhard, Nina, Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus im Verlauf von drei Generationen, in: Jens Birkmeyer/Cornelia Blasberg (Hrsg.), Erinnern des Holocaust? Eine neue Generation sucht Antworten, Bielefeld 2006, S. 63–80.
Lindner, Rolf, Ohne Gewähr: Zur Kulturanalyse des Informanten, in: Utz Jeggle (Hrsg.), Feldforschung. Qualitative Methoden in der Kulturanalyse, Tübingen 1984, S. 59–71.
Loewy, Hanno, Erinnerungen an Sichtbares und Unsichtbares, in: Reinhard Matz, Die unsichtbaren Lager. Das Verschwinden der Vergangenheit im Gedenken, Reinbek bei Hamburg
1993, S. 20–32.
Marchart, Oliver, Umkämpfte Gegenwart. Der „Zivilisationsbruch Auschwitz“ zwischen Singularität, Partikularität, Universalität und der Globalisierung der Erinnerung, in: Heidemarie
Uhl (Hrsg.), Zivilisationsbruch und Gedächtniskultur. Das 20. Jahrhundert in der Erinnerung
des beginnenden 21. Jahrhunderts, Innsbruck / München 2003, S. 35–65.
Marcuse, Harold, Holocaust Memorials. The Emergence of a Genre, in: The American Historical
Review (2010), Heft 115, S. 53–89.
Nora, Pierre, Das Abenteuer der Lieux de mémoire, in: Etienne François (Hrsg.), Nation und
Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen
1995, S. 83–92.
Nora, Pierre, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt a.M. 1998.
Paas, Jörg, Von den Opfern nicht vergessen. Prozessauftakt gegen NS-Kriegsverbrecher Kepiro,
5. 5. 2011, in: tagesschau.de: http://www.tagesschau.de/ausland/prozesssandorkepiro100.html
(letzter Zugriff: 23. 11. 2011).
Rahe, Thomas, Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte für die historische Forschung zur Geschichte der Konzentrations- und Vernichtungslager, in: Kurt Buck (Hrsg), Kriegsende und
Befreiung, Bremen 1995, S. 84–98.
Ramet, Sabrina, Die drei Jugoslawien. Eine Geschichte der Staatsbildungen und ihrer Probleme,
München 2011.
Rosenthal, Gabriele, Die Biographie im Kontext der Familien- und Gesellschaftsgeschichte, in:
Bettina Völter / Bettina Dausien / Helma Lutz / Gabriele Rosenthal (Hrsg.), Biographieforschung
im Diskurs, Wiesbaden 2005, S. 46–64.
Rosenthal, Gabriele, Interpretative Sozialforschung: Eine Einführung, Weinheim/München 2005.
80
Das Konzentrationslager Flossenbürg in der Erinnerung und der ‚erinnerten Erinnerung‘
Schlehe, Judith, Formen qualitativer ethnographischer Interviews, in: Bettina Beer (Hrsg.), Methoden ethnologischer Feldforschung, Berlin 2008, S. 119–142.
Schmidt, Alexander, Das KZ-Außenlager Hersbruck. Zur Geschichte des größten Außenlagers
des KZ Flossenbürg in Bayern, in: Dachauer Hefte (2004), Heft 20, S. 99–111.
Schmidt, Alexander, Geschichte auf zwei Ebenen. Die neue Dauerausstellung „Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945“, in: Dachauer Hefte (2007), Heft 23, S. 236–246.
Schmidt, Alexander, Happurg und Hersbruck, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel (Hrsg.), Der
Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück, München 2006, S. 136–140.
Schwarz, Ulrich, Gestaltungskonzept, in: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Hrsg.), Was bleibt –
Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg. Katalog zur Dauerausstellung, Flossenbürg 2011, S. 14–17.
Skriebeleit, Jörg, Flossenbürg – Stammlager, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel (Hrsg.), Der
Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück, München 2006, S. 17–66.
Skriebeleit, Jörg, Vorwort, in: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Hrsg.), Was bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg. Katalog zur Dauerausstellung, Flossenbürg 2011,
S. 9–13.
Spoerer, Mark, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart /
München 2001.
Sundhaussen, Holm, Die „Genozidnation“: serbische Kriegs- und Nachkriegsbilder, in: Nikolaus Buschmann / Dieter Langewiesche (Hrsg.), Der Krieg in den Gründungsmythen europäischer Nationen und der USA, Frankfurt a. M. / New York 2003, S. 351–371.
Sundhaussen, Holm, Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall,
Mannheim 1993.
Szczypiorski, Andrzej, Kampf wider die Dummheit, in: Reinhard Matz, Die unsichtbaren Lager.
Das Verschwinden der Vergangenheit im Gedenken, Reinbek bei Hamburg 1993, S. 11–14.
Warning, Wilhelm, Interview mit Renate Niebler zur Ausstellung „In uns der Ort“, 9. 9. 2011, in:
Bayern 2 Kulturwelt: http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kulturwelt/Flossenbuergausstellung100.html (letzter Zugriff: 23. 11. 2011).
81
IOS-Mitteilung Nr. 61
Welzer, Harald, ‚Ach Opa!’. Einige Bemerkungen zum Verhältnis von Tradierung und Aufklärung, in: Jens Birkmeyer / Cornelia Blasberg (Hrsg.), Erinnern des Holocaust? Eine neue Generation sucht Antworten, Bielefeld 2006, S. 47–62.
82