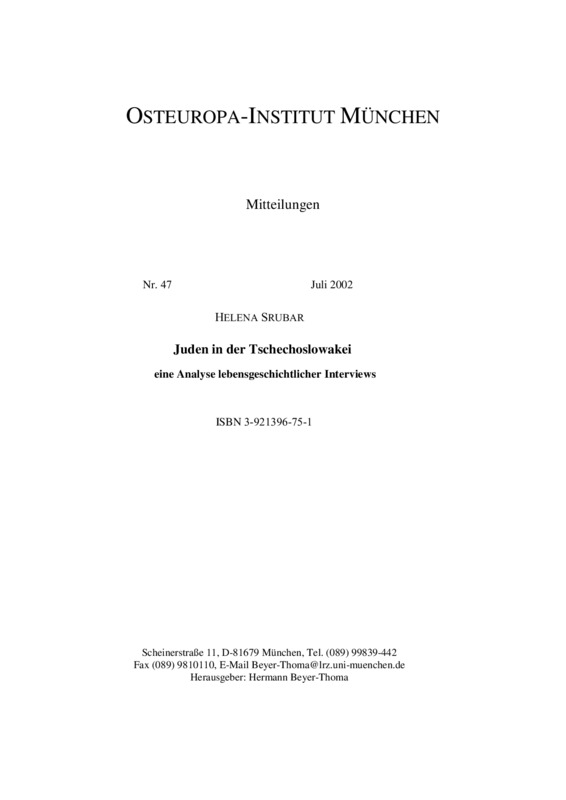https://www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_47.pdf
Media
- extracted text
-
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN
Mitteilungen
Nr. 47
Juli 2002
HELENA SRUBAR
Juden in der Tschechoslowakei
eine Analyse lebensgeschichtlicher Interviews
ISBN 3-921396-75-1
Scheinerstraße 11, D-81679 München, Tel. (089) 99839-442
Fax (089) 9810110, E-Mail Beyer-Thoma@lrz.uni-muenchen.de
Herausgeber: Hermann Beyer-Thoma
2
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
INHALTSVERZEICHNIS
A. Einleitung ..................................................................................................................... 7
B. Theorie ......................................................................................................................... 8
1. Mündliche Quellen in der deutschen Geschichtswissenschaft................................ 8
1.1. Geschichte wird zur Wissenschaft ................................................................... 9
1.2. Die deutsche Historiographie nach 1945 ....................................................... 11
1.3. Methodenstreit................................................................................................ 14
2. Was ist Oral History? ............................................................................................ 16
3. Exkurs: Die tschechische Historiographie und Oral History ................................ 19
4. Methode................................................................................................................. 21
4.1. Einflußnahme des Forschers auf die Quellenproduktion ............................... 22
4.2. Das Problem der Subjektivität und Repräsentativität .................................... 23
4.3. Erinnerung...................................................................................................... 25
C. Juden in der Tschechoslowakei – ein historischer Überblick.................................... 27
1. Die Erste Tschechoslowakische Republik 1918-1938........................................... 28
2. Die Tschecho-Slowakei 1938/39 ........................................................................... 34
3. Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945......................................................... 35
3.1. Ausgrenzung aus der Gesellschaft, 1939 bis Herbst 1941 ............................. 37
3.1.1. Die Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen und
wirtschaftlichen Leben ........................................................................ 37
3.1.2. Einschränkungen und Diskriminierungen im privaten Bereich .......... 38
3.1.3. Auswanderung..................................................................................... 39
3.2. Deportation und Vernichtung......................................................................... 40
4. Neubeginn nach 1945............................................................................................ 48
5. Nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 ............................................. 49
6. Nach der Wende 1989 ........................................................................................... 51
D. Juden in der Tschechoslowakei – eine Analyse lebensgeschichtlicher
Interviews................................................................................................................... 52
1. Analytischer Rahmen ............................................................................................ 52
1.1. Analyseschritte ............................................................................................... 53
1.2. Interviewbedingungen .................................................................................... 56
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
3
2. Marta N. .................................................................................................................57
2.1. Subjektive Sinnstruktur .................................................................................. 57
2.1.1. Zeit vor der Verfolgung .......................................................................57
2.1.2. Okkupation...........................................................................................58
2.1.2.1. 1939 bis Herbst 1944 ..............................................................59
2.1.2.2. Herbst 1944 bis 1945 ..............................................................62
2.1.3. Nach 1945 ............................................................................................69
2.1.4. Zusammenfassung................................................................................71
2.2. Soziale Identität .............................................................................................. 71
3. L.R. ........................................................................................................................72
3.1. Subjektive Sinnstruktur .................................................................................. 72
3.1.1. Zeit vor der Verfolgung .......................................................................72
3.1.2. Okkupation...........................................................................................73
3.1.2.1. 1939-1942 ...............................................................................73
3.1.2.2. Theresienstadt .........................................................................74
3.1.2.3. Familienlager ..........................................................................75
3.1.2.4. Auflösung des Familienlagers ................................................ 77
3.1.2.5. Deportation nach Hamburg.....................................................79
3.1.2.6. Zwangsarbeit...........................................................................79
3.1.2.7. Bergen-Belsen.........................................................................80
3.1.3. Nach 1945 ............................................................................................82
3.1.4. Zusammenfassung................................................................................83
3.2. Soziale Identität .............................................................................................. 84
4. Eva R......................................................................................................................85
4.1. Subjektive Sinnstruktur .................................................................................. 85
4.1.1. Zeit vor der Verfolgung .......................................................................85
4.1.2. Erste Diskriminierungen und Flucht.................................................... 85
4.1.3. Theresienstadt ......................................................................................87
4.1.3.1. ,Eingewöhnung‘ ......................................................................88
4.1.3.2. ,Normalisierung‘ .....................................................................89
4.1.3.3. Das ,Ende‘...............................................................................91
4.1.4. Nach 1945 ............................................................................................92
4.1.5. Zusammenfassung................................................................................93
4.2. Soziale Identität .............................................................................................. 94
4
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
5. Jirka K. .................................................................................................................. 96
5.1. Subjektive Sinnstruktur .................................................................................. 96
5.1.1. Zeit vor der Verfolgung....................................................................... 96
5.1.2 Erste Diskriminierungen...................................................................... 99
5.1.3 Okkupation .......................................................................................... 99
5.1.3.1 Vor der Deportation................................................................. 99
5.1.3.2 Theresienstadt........................................................................ 100
5.1.3.3 Herbsttransporte 1944 bis Kriegsende .................................. 101
5.1.4 Nach 1945.......................................................................................... 103
5.1.5 Zusammenfassung ............................................................................. 106
5.2 Soziale Identität............................................................................................ 108
E. Abschließende Bemerkung ...................................................................................... 109
1. Niederschlag sozialer und historischer Faktoren im subjektiven Erleben
der Biographen .................................................................................................... 109
2. Wechselwirkung zwischen Erleben, Erinnerung und biographischer
Selbstdarstellung ................................................................................................. 113
3. Soziale Identität................................................................................................... 117
F. Ausblick ................................................................................................................... 118
G. Literaturverzeichnis ................................................................................................. 120
Anhang.......................................................................................................................... 129
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
5
6
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
A. Einleitung
Bei der Beschäftigung mit zeitgeschichtlichen Themen besteht für den Historiker die
einmalige Chance, sich bei seiner Arbeit nicht nur auf schriftliche Quellen zu
beschränken, sondern auf Interviews mit Zeitzeugen zurückzugreifen. Dadurch kann die
auf Aktenwissen beruhende Ereignisgeschichte um neue Perspektiven ergänzt werden,
nämlich um die Geschichtserfahrung von denjenigen, die von den jeweiligen
Ereignissen direkt berührt wurden.
Grundlage dieser Arbeit bilden lebensgeschichtliche Interviews mit tschechischen
Holocaust-Überlebenden, die ich im Herbst 1998 in Prag geführt habe. Lebensgeschichtliches Interview bedeutet, daß die Interviewpartner aufgefordert wurden, ihre
gesamte Lebensgeschichte zu erzählen, angefangen bei der Kindheit bis zur Gegenwart,
also ohne Einschränkungen alles, was ihnen aus ihrer ganz persönlichen Erinnerung
wichtig erschien. Mein Anliegen wird sein, anhand dieser Interviews das subjektive Erleben von Geschichte derjenigen zu untersuchen, die in der Ersten Tschechoslowakischen Republik aufwuchsen und 1939 als Juden Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurden. Wer waren ,die Juden in der Tschechoslowakei‘?1 Welche Rolle
spielte für sie ihr ,Jüdischsein‘, bevor sie aufgrund dieses Charakteristikums Opfer der
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik wurden? Wie gingen sie mit ihrer jüdischen
Identität nach der Shoah um? Wie erlebten die Interviewpartner ihre Kindheit, die Verfolgung, die Rückkehr, wie sehen sie ihr Leben heute? Welchen Einfluß hatte der Holocaust auf ihre soziale Identität?
Zusammengefaßt stehen zwei Fragestellungen im Mittelpunkt. Zum einen wird nach
dem subjektiven Erleben gefragt, das die weitere Beurteilung der Ereignisse und auch
die heutige Sicht prägt. Da sich die subjektive Erfahrung und Bewertung von persönlichen wie historischen Ereignissen stets an sozialen Deutungsmustern orientiert, ist dann
zweitens zu untersuchen, wie die soziale Identität der Interviewpartner beschaffen ist.
Bevor ich jedoch zur Analyse der Interviews komme, werde ich mich zunächst mit
den theoretischen Hintergründen der Oral History befassen und den der Analyse zugrundeliegenden methodischen Zugang, der sich an die soziologische Biographie1 Der Begriff Tschechoslowakei wird hier im historisch-politischen Sinn verwendet, d.h. er steht für den
zeitlichen Rahmen seit der ersten tschechoslowakischen Staatsgründung über den Zweiten Weltkrieg
bis hin zur Bildung der Tschechischen Republik nach der Abspaltung der Slowakei am 1.1.1993. Da
die Gespräche im Herbst 1998 geführt wurden, reicht der behandelte Zeitraum sogar über den Zerfall
der Tschechoslowakei hinaus. Unter meinen Gesprächspartnern waren keine Slowaken, weshalb sich
die vorliegende Arbeit nur mit Juden aus den historischen Kronländern beschäftigt.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
7
forschung anlehnt, vorstellen. Darauf folgt ein historischer Überblick über die Juden in
der Tschechoslowakei, um die für das Verständnis der Interviews notwendige historische Wirklichkeit darzustellen, und gleichzeitig, um über eine ereignisgeschichtliche
Kontrastfolie für die subjektiven Erzählungen zu verfügen.
Erst dann wende ich mich der Analyse der Gespräche zu, wobei einleitend die durchzuführenden Analyseschritte vorgestellt werden und dann jedes Interview für sich auf
die formulierten Fragestellungen hin untersucht wird. Dabei wird versucht, aufeinander
aufbauend die jeweils gewonnenen Erkenntnisse in die weitere Analyse einzuarbeiten,
so daß Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den biographischen Erzählungen deutlich
werden.
B. Theorie
1. Mündliche Quellen in der deutschen Geschichtswissenschaft
Seit den achtziger Jahren hat sich in Deutschland unter dem Namen Oral History in den
Geschichtswissenschaften ein Zweig etabliert, der mit mündlichen Quellen in Form von
Interviews arbeitet. Allerdings dauerte es über ein Jahrzehnt, bis diese Forschungsrichtung als wissenschaftliche Methode im Kreise deutscher Historiker anerkannt wurde,
„war ihre Etablierung doch mit öffentlich artikuliertem Unbehagen oder sogar offenem
Widerspruch führender Historiker verbunden.“2 Als Lutz Niethammer 1978 seinen Artikel „Oral History in den USA“3 veröffentlichte, gelang es ihm zwar dadurch, Oral
History als eine Forschungsrichtung, die auf der Grundlage diachroner Interviews arbeitet, in Deutschland bekannt zu machen, gleichzeitig entfesselte er aber eine heftige
Debatte um ihre Wissenschaftlichkeit. Dieser Methodenstreit setzte hierzulande im internationalen Vergleich sehr verspätet ein, denn in anderen Ländern wie den USA und
Israel, aber auch in England, Frankreich und Skandinavien kann Oral History schon auf
eine lange wissenschaftliche Tradition zurückblicken. Die ablehnende Haltung der deutschen Geschichtswissenschaft hatte zur Folge, daß diese Methode weit mehr Verbreitung bei Laienhistorikern und Mitgliedern von Geschichtswerkstätten fand als an den
Universitäten.
2 BRIESEN, DETLEF / GANS, RÜDIGER Über den Wert von Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: BIOS
6 (1993), Heft 1, S. 1-32, hier S. 4.
3 NIETHAMMER, LUTZ „Oral History in den USA. Zur Entwicklung und Problematik diachroner Befragungen“, in: Archiv für Sozialgeschichte 18 (1978), S. 457-501.
8
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Bevor ich zu den inhaltlichen Kritikpunkten am wissenschaftlichen Umgang mit
mündlichen Quellen komme, ist zu fragen, worauf dieser verspätete deutsche
Methodendiskurs zurückzuführen ist. Briesen und Gans sehen die Ursache für die
spezifisch deutsche Skepsis gegenüber mündlichen Quellen in einer „sehr homogene[n]
Geschichtstheologie und eine[r] auf ihr basierende[n] standardisierte[n] Historik“,4 die
in der Tradition des deutschen Historismus steht und erst in den siebziger Jahren mit
dem Aufkommen der historischen Sozialwissenschaft entscheidend in Frage gestellt
wurde.
1.1. Geschichte wird zur Wissenschaft
Als sich im 19. Jahrhundert die Geschichte als Wissenschaft herauszubilden begann,
sahen sich die Historiker vor die Schwierigkeit gestellt, daß ihr Gegenstand, die Vergangenheit, nur über die Vermittlung von Quellen zugänglich war, die stets die historische Wirklichkeit nur ausschnittsweise und bereits interpretiert wiedergaben.
„Sie [die historische Forschung] entbehrt den Vorzug, das, was sie als Geschichte zusammenfassen will, in der ganzen Breite seiner Existenz gegenwärtig und vor sich zu haben.
[...] das zu Verstehende ist vergangen und längst vergangen bis auf die mehr oder minder
dürftigen Überreste und Erinnerungen, die davon noch in die Gegenwart hineinragen. Und
aus diesen Fragmenten muß sie das, was war und geschah und nicht mehr vorhanden ist, in
der Vorstellung zu rekonstruieren suchen.“5
Zudem war man sich bewußt, daß jede retrospektive Bewertung und Deutung dieser
Quellen von der Gegenwartsperspektive bzw. der Fragestellung des Historikers abhing,
der gemäß seines Erkenntnisinteresses die Vergangenheit in eine daraus abgeleitete
sinnvolle Ordnung brachte. Droysen sah daher die Aufgabe der Geschichtsforschung
nicht darin, die Vergangenheit ,objektiv‘ und
„in der vollständigen Breite ihrer einstigen Gegenwart festzustellen, sondern unsere
zunächst enge, stückweise, unklare Vorstellung von den Vergangenheiten, unser Verständ-
4 BRIESEN / GANS, S. 2.
5 DROYSEN, JOHANN GUSTAV Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, hrsg. v. Rudolf Hübner, München 1967, S. 187.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
9
nis derselben zu erweitern, zu ergänzen, zu berichtigen, nach immer neuen
Gesichtspunkten zu entwickeln und zu steigern.“6
Das historische Erkennen unterscheidet sich demnach grundlegend vom naturwissenschaftlichen Erklären und Ableiten aus Gesetzmäßigkeiten. Der Zugang zur Vergangenheit ist vielmehr nur über verstehende7 Annäherung möglich, und unter Geschichte ist
nicht das Vergangene selbst zu verstehen, sondern unsere Vorstellung von selbigem:
„Und diese Vorstellungen, [...], weit entfernt, die Vergangenheiten selbst zu sein, werden
denselben immer nur in gewisser Weise, nach gewissen Gesichtspunkten, bis zu einem
gewissen Grad entsprechen. [...] Nicht die Vergangenheiten sind die Geschichte, sondern
das Wissen des menschlichen Geistes von ihnen. Und dies Wissen ist die einzige Form, in
der die Vergangenheiten unvergangen sind, in der die Vergangenheiten als in sich zusammenhängend und bedeutsam, als Geschichte erscheinen.“8
Um diesen Vorgang der Geschichtsschreibung methodischen Regeln zu unterwerfen,
entwickelte Droysen in seiner „Historik“ verschiedene Kriterien zum Umgang mit dem
historischen Quellenmaterial. Im Kapitel „Heuristik“ werden verschiedene Formen der
Überlieferung klassifiziert: unabsichtlich überlieferte Überreste, absichtlich tradierte
Quellen und Denkmäler, die intentional und nichtintentional sein können.9 Ein weiteres
wichtiges Element der Droysenschen Historik ist die Quellenkritik10 bezüglich der
Echtheit, zeitlichen Einordnung usw. Die Interpretation schließlich versucht zu rekonstruieren, wie die Vergangenheit beschaffen war, auf die die Überlieferungen verweisen. Hierbei müssen gemäß den Regeln der Hermeneutik die spezifischen
historischen Umstände sowie die Intentionen des Urhebers bei der Entstehung der
Quelle berücksichtigt werden.
Droysens Historik wurde grundlegend für die weitere Entwicklung der deutschen
Geschichtswissenschaft. Dabei wurden die nichtintentionalen Überreste gegenüber den
Quellen, die von Bernheim in Traditionsquellen umbenannt wurden, als wissenschaftlich ergiebiger eingestuft, einmal aufgrund ihrer zeitlichen Nähe zum historischen Ereignis, zum anderen, da man der Auffassung war, nicht beabsichtigte Überlieferungen
6 Ebenda, S. 27.
7 Vgl. ebenda: „Das Wesen der historischen Methode ist forschend zu verstehen.“ S. 328, sowie S. 339:
„Die historische Forschung will nicht erklären, d.h. aus dem Früheren das Spätere, aus Gesetzen die
Erscheinungen, als notwendig, als bloße Wirkungen und Entwicklungen ableiten.“
8 Ebenda, S. 187.
9 Vgl. ebenda, S. 37f. sowie 232ff.
10 Ebenda, S. 98f. sowie 335ff.
10
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
seien weniger subjektiv gefärbt als beabsichtigte und dadurch „wahrhaftiger“.11 Ausschlaggebend hierfür war eine grundsätzliche Skepsis gegenüber „verdächtigen Formen
menschlicher Subjektivität“,12 die ihre Ursache in dem Legitimationskonflikt der Geschichte als Wissenschaft selbst hatte. Aufgrund der Besonderheit des Gegenstands und
des daraus resultierenden verstehenden Zugangs, der stets mit der Frage zu kämpfen
hat, wieviel Allgemeines im Einzelfall liegt, sah man sich veranlaßt, die Wissenschaftlichkeit der historischen Methode durch besonderen positivistischen Eifer unter
Beweis zu stellen.
Diesem Eifer fiel auch die Quellengattung der mündlichen Überlieferung zum Opfer,
obwohl sie seit der Antike zum traditionellen Methodenrepertoire des Historikers gehört
hatte.13 Mit der Fixierung auf nichtintentionale Überreste glaubte man, dem Anspruch
nach wissenschaftlicher Objektivität besser gerecht zu werden. Hierbei kam den Historikern zugute, daß im Zuge des Modernisierungsprozesses, d.h. der Ausbreitung des kapitalistischen Wirtschaftssystems, des Entstehens der bürgerlichen Gesellschaft und der
fortschreitenden Bürokratisierung des Staatswesens, eine riesige Masse von
schriftlichen Dokumenten, vor allem in Form von Akten, entstand, die sie zu ihren
„Leit-Quellen“14 erhoben. Das Forschungsinteresse des klassischen Historismus
konzentrierte sich vor allem auf Ereignis- und Politikgeschichte, d.h. den Nationalstaat,
die Außenpolitik und große Persönlichkeiten, die als die eigentlichen Triebfedern der
Geschichte angesehen wurden.15
1.2. Die deutsche Historiographie nach 1945
Auch nach 1945 kam es in der westdeutschen Historiographie zu keinen wesentlichen
methodischen Neuerungen. Niethammer sieht dafür folgende Gründe: Zum einen zeigte
sich im Zusammenhang mit der Entnazifizierung, und auch zum Teil in Memoiren, die
11 Vgl. hierzu BRIESEN / GANS, S. 12f.
12 Ebenda, S. 2.
13 Vgl. hierzu SIEDER, REINHARD Bemerkungen zur Verwendung des „Narrativinterviews“ für eine
Geschichte des Alltags, in: Zeitgeschichte 9 (1982), S. 164-178, hier S. 166, sowie BOTZ, GERHARD
Neueste Geschichte zwischen Quantifizierung und „Mündlicher Geschichte“. Überlegungen zur Konstituierung einer sozialwissenschaftlichen Zeitgeschichte von neuen Quellen und Methoden her, in:
Botz, Gerhard (Hg.): „Qualität und Quantität“: zur Praxis der Methoden der historischen Sozialwissenschaft, Frankfurt a. M. / New York 1988, S. 13-42, hier S. 24f. (Studien zur historischen Sozialwissenschaft Bd. 10).
14 BOTZ, S. 18.
15 Vgl. IGGERS, GEORG G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert, Göttingen 1993, S. 8f., sowie
Handbuch Qualitative Sozialforschung, hrsg. von Flick, U. / Kardoff, E.v. / Keupp, H. / Rosenstiel,
L.v. / Wolff, S., München 1991, S. 48.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
11
Unzuverlässigkeit der Erinnerungen bezüglich des Nationalsozialismus, da sie von persönlichen Rechtfertigungsversuchen und Verdrängungsmechanismen durchzogen
waren. „Dadurch wurde die Erinnerung als zeitgeschichtliche Quelle stigmatisiert,
obwohl sich an vielen Stellen Berge von Zeugenschrifttum auftürmten.“16 Man war bei
der Aufarbeitung des Nationalsozialismus auch nicht notwendig auf dieses Material
angewiesen, da man in völlig neuem Umfang auf traditionelle archivalische Quellen aus
den Reihen der politischen Entscheidungsträger zurückgreifen konnte.17
Aber nicht nur die umfangreiche Aktenlage und die Unzuverlässigkeit von Zeitzeugenerinnerungen begründeten die Ablehnung erfahrungsgeschichtlicher Methoden.
Vielmehr wird auch die nicht ganz einwandfreie Vergangenheit mancher führender Persönlichkeiten und Historiker der jungen BRD eine Rolle gespielt haben:
„Die Repräsentanten der frühen Nachkriegszeit, nicht nur die Historiker und Archivare,
konnten wenig Interesse an solchen Themen haben, weil das Dritte Reich als Vorerfahrung
und damit als Vorgeschichte der beiden deutschen Nachkriegsstaaten hätte behandelt werden müssen – vielleicht auch sie selbst.“18
Insofern zeigten nicht nur Memoirenschreiber und Entnazifizierungskandidaten Verdrängungserscheinungen, sondern im Gegenteil herrschte in den ,Wirtschaftswunderjahren‘ in den deutschen Eliten weitestgehender Konsens da-rüber, die Vergangenheit
ruhen zu lassen. Eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus hinsichtlich der Rolle
breiter Bevölkerungsschichten wurde „teils aus nationalapologetischen Gründen, teils
um innenpolitische Auseinandersetzungen über die Trägerschichten des Dritten Reichs
zu vermeiden“,19 abgelehnt. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus wurde
vielmehr auf die Person Hitlers und die ihn umgebenden Führungskreise reduziert.20
Erst mit der Studentenbewegung der 68er wurde die Frage nach der national16 NIETHAMMER, LUTZ Einführung, in: Niethammer, Lutz (Hg.): Lebenserfahrung und kollektives
Gedächtnis – Die Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1985, S. 7-33, hier S. 12.
17 Niethammer meint damit, daß erst durch den Niedergang eines Regimes Aktenbestände zugänglich
werden, die Einblicke in innere Funktionsmechanismen gewähren. Dies war nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus der Fall, so daß man keine neuen Forschungsmethoden brauchte:
„zur Entwicklung spezifisch zeitgeschichtlicher Dokumentationsmethoden sind die Zeithistoriker erst
gezwungen, seitdem sie sich verstärkt auch der Nachkriegszeit zugewandt haben und sich dabei den
unter den Bedingungen der Herrschaftskontinuität üblichen Verweigerungen des Einblicks in die arcana imperii gegenüberfanden.“ (NIETHAMMER Einführung, S. 13) Dies war aber sicherlich nicht der
einzige Auslöser für die Hinwendung zur Oral History.
18 VON PLATO, ALEXANDER Oral History als Erfahrungswissenschaft. Zum Stand der „mündlichen Geschichte“ in Deutschland, in: BIOS 4 (1991), Heft 1, S. 97-119, hier S. 100.
19 NIETHAMMER Einführung, S. 12.
12
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
sozialistischen Verstrickung der Väter-Generation öffentlich eingefordert.21
Der sich daraufhin in den siebziger Jahren etablierenden historischen Sozialwissenschaft gelang es, die Dominanz der ereignis- und personenzentrierten Politikgeschichte
zu durchbrechen und die einseitige Fixierung auf die nationalsozialistische Führungsclique zugunsten der Untersuchung bisher nicht thematisierter struktureller und institutioneller Kontinuitäten zu überwinden.22 Im Mittelpunkt ihres Forschungsinteresses
standen sozial- und strukturgeschichtliche Fragestellungen wie die Sozialstruktur von
Massenparteien oder die Wirkungsgeschichte bürokratischer Organisationen. In methodischer Hinsicht distanzierten sich ihre Vertreter vom qualitativ verstehenden Zugang
und suchten Anlehnung bei den Methoden der quantitativ-analytischen Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften.23
Dennoch hatte die historische Sozialwissenschaft etwas mit der traditionellen Politikgeschichte gemeinsam: die Orientierung an Herrschafts- und Steuerungsmechanismen
der Gesellschaft. An die Stelle von Ereignissen und Personen traten Institutionen und
soziale Kollektive wie Klassen und Schichten.
In beiden historischen Forschungsrichtungen fehlte die Perspektive der Betroffenen,
die Alltagserfahrung des ,Volkes‘, das subjektive Erleben von Geschichte, was zum
einen natürlich mit ihrem Erkenntnisinteresse, zum anderen aber auch mit dem ausgewerteten, nur auf schriftlichen Quellen beruhenden Material zusammenhing, das die
Perspektive der einfachen Bevölkerung nicht hergab. Neuere sozialgeschichtliche Forschungsansätze, denen an einer ,Geschichte von unten‘, d.h. der bisher von der offiziellen Geschichtsschreibung ausgeschlossenen Gesellschaftsgruppen, gelegen war,
orientierten sich daher an ausländischen Vorbildern, die bereits seit längerem die Pro-
20 Vgl. KÖLSCH, JULIA Nation heißt: sich erinnern...?, in: Nassehi, A. (Hg.): Nation, Ethnie, Minderheit,
Köln 1997, S. 287-307, hier S. 291.
21 „Der allgemeine Konsens war einer der Verdrängung und des Vergessens. Die Generation derer, die
den Nationalsozialismus als Erwachsene erlebt hatten, beherrschte noch immer das öffentliche Leben.
[...] Mitte der 1960er Jahre erschütterte eine erste Welle von Diskussionen diese Abwehrmauern. Die
Generation derer, die während oder gegen Ende des Krieges geboren worden waren, rückte nun ins
Licht der Öffentlichkeit; die Studentenrevolten der späten 60er Jahre und ihre Folgeerscheinungen
stellten viele Aspekte der zeitgenössischen Kultur ebenso in Frage wie den allgemeinen Konsens der
Lügen über die nationalsozialistische Epoche.“ FRIEDLÄNDER, SAUL Auseinandersetzung mit der
Shoah: Einige Überlegungen zum Thema Erinnerung und Geschichte, in: Geschichtsdiskurs Bd. 5,
Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945, Frankfurt a. M. 1999, S. 1529, hier S. 16f.
22 Vgl. WELSKOPP, THOMAS Westbindung auf dem „Sonderweg“. Die deutsche Sozialgeschichte vom
Appendix der Wirtschaftsgeschichte zur Historischen Sozialwissenschaft, in: Geschichtsdiskurs Bd.
5, S. 191-237.
23 Als wesentliche Vertreter der Historischen Sozialwissenschaft sind Hans-Ulrich Wehler und Jürgen
Kocka zu nennen. Vgl. hierzu IGGERS, S. 55ff.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
13
duktion von mündlichen Quellen für diese Zwecke nutzten. In den USA diente diese
Methode unter anderem zur Erforschung der Geschichte nichtschriftlicher Kulturen,
z.B. der Indianer und schwarzen Sklaven. In England und Frankreich wurde die Interviewpraxis vor allem mit alltags- und erfahrungsgeschichtlichen Fragestellungen verbunden und vorwiegend auf die Geschichte der sog. ,kleinen Leute‘ angewandt.24
Vorreiter der Oral History in Deutschland wurde eine Gruppe von Historikern um
Niethammer, der mit seinem bereits erwähnten Artikel diese Methode hierzulande
bekanntmachte. Sie starteten ein breit angelegtes Projekt zur Untersuchung der Faschismus-Erfahrung unter Arbeitern im Ruhrgebiet, dessen Ergebnisse in drei Bänden veröffentlicht wurden.25 Daneben waren es vor allem die Geschichtswerkstätten, die begannen, mit Hilfe von Interviews lokalhistorische Aspekte der NS-Zeit aufzuarbeiten.26
Parallel zur Verbreitung der Oral History in den Geschichtswissenschaften entstand
seit Ende der siebziger Jahre in der Soziologie als Reaktion auf die Dominanz des positivistischen Forschungsbetriebs die sogenannte Biographieforschung, die auf der Basis
von lebensgeschichtlichen Interviews versucht, soziale Milieus und soziales Handeln zu
rekonstruieren.27
1.3. Methodenstreit
Die Kritik, die an den beiden Methoden von Vertretern ihres Faches geäußert wird, läßt
sich auf den grundsätzlichen Dualismus zwischen den ,harten‘ Fakten der analytischempirischen Sozialforschung und der positivistisch ausgerichteten deutschen Historiographie einerseits und den ,weichen‘ Fakten der verstehenden Soziologie und der erfahrungsgeschichtlichen Ansätze wie der Oral History andererseits zurückführen. Interessant ist hierbei, wie weit sich die deutsche Historiographie von Droysen entfernt hat
und dem Glauben verfallen ist, durch ihre Fixierung auf Akten objektive Tatbestände
24 Vgl. NIETHAMMER Postskript. Über Forschungstrends unter Verwendung diachroner Interviews in der
Bundesrepublik, in: Niethammer, Lutz (Hg.): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis – Die
Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1985, S. 471-477, hier S. 472.
25 NIETHAMMER, LUTZ / VON PLATO, ALEXANDER (Hg.): Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960: „Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute hinsetzen soll.“ Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet, Bd.1, „Hinterher merkt man, daß es richtig war, daß es schiefgegangen ist.“
Nachkriegserfahrungen im Ruhrgebiet, Bd.2, beide Berlin / Bonn 1983, und „Wir kriegen jetzt andere
Zeiten.“ Auf der Suche der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern, Bd. 3, Berlin / Bonn
1983.
26 Vgl. VON PLATO Oral History als Erfahrungswissenschaft, S. 102f.
27 Vgl. FUCHS, WERNER Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden, Opladen
1984.
14
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
über die Vergangenheit zu ermitteln, während hingegen die subjektiven Quellen der
Oral History nur ein verzerrtes Bild historischer Ereignisse offenbarten und daher nicht
wissenschaftlich verwendbar seien.28 Dabei wird übersehen, daß auch Akten die Vergangenheit stets nur ausschnitthaft und damit vorstrukturiert widerspiegeln und daß
auch eine auf ihnen basierende Geschichtsschreibung stets nur eine mögliche Annäherung an das historische Geschehen darstellt.29
Das hier Gesagte ist natürlich nicht dahingehend aufzufassen, daß die Existenz historischer Tatbestände grundsätzlich in Zweifel gezogen wird. Selbstverständlich gibt es
von der Interpretation des Historikers unabhängige überprüfbare historische Tatsachen.
Speziell die Zeitgeschichte hat die einmalige Möglichkeit, hierfür Zeitzeugen zu befragen. Diese Besonderheit sollte daher von Historikern als Chance begriffen werden, zudem dadurch auch eine Ausweitung der Betrachtung auf andere historische Subjekte ermöglicht wird, deren Perspektive in den schriftlichen Quellen nicht enthalten ist.
In der Soziologie geht es in diesem Dualismus vor allem um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Während die makrosoziologischen Ansätze die Gesellschaft
als System betrachten, das das Individuum determiniert und ihm wenig subjektive
Handlungsfreiheit einräumt, stellt die verstehende Soziologie den subjektiven Sinn des
individuellen Handelns in den Mittelpunkt und versteht die soziale Welt als kulturellen
Sinnzusammenhang, in den der Mensch einerseits hineingeboren wird, den er aber andererseits durch sein Handeln beeinflußt und verändert.30
Parallel zur verstehenden Soziologie, die von einer Wechselwirkung zwischen dem
28 Vgl. BRIESEN / GANS, S. 20f.
29 Vgl. BOTZ, S. 18.
30 Der Verstehens-Begriff geht auf Max Weber zurück, der in § 1 der „soziologischen Grundbegriffe“
Soziologie wie folgt definiert: „Soziologie [...] soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will.
,Handeln‘ soll dabei menschliches Verhalten [...] heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn [Hervorh. H.S.] verbinden.“ WEBER, MAX Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen 1980 (1921), S. 1. Alfred Schütz entwickelte
Webers Ansatz mit Hilfe der Husserlschen Phänomenologie weiter, indem er eine Methodologie entwarf, die diesen subjektiven Sinn objektiv verstehbar machen sollte. Vgl. SCHÜTZ, ALFRED Gesammelte Aufsätze 1. Das Problem der sozialen Wirklichkeit. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971 a, insbesondere darin Teil I: Zur Methodologie der Sozialwissenschaften, sowie SCHÜTZ, ALFRED Der
sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Frankfurt a. M.
1974. Den Haag. Neben der Phänomenologie ist als weiterer interpretativer Ansatz der symbolische
Interaktionismus von Mead zu nennen, der für den dieser Arbeit zugrundeliegenden Identitätsbegriff
von Bedeutung sein wird. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Akteuren als relativ autonomen
Individuen, die durch ihre subjektive Interpretation einer Situation diese erst herstellen. Grundlegend
für die symbolische Interaktion ist ein gemeinsames System signifikanter Symbole, die das
Individuum im sozialen Interaktionsprozeß erlernt; bestes Beispiel hierfür ist die Sprache.
Gleichzeitig wird dieses System durch den Interaktionsprozeß verändert und erweitert. Vgl. MEAD,
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
15
sinnhaften Handeln des Individuums und der Gesellschaft ausgeht, versucht die Oral
History, die Wechselwirkung zwischen historischer Realität und subjektivem Handeln
und Erfahren zu erforschen. Während in der traditionellen Historiographie kein Raum
für das Individuelle bleibt, vielmehr Menschen durch die ,große Geschichte‘ und ihre
führenden Repräsentanten determiniert scheinen, ermöglicht es der verstehend-individualistische Ansatz der Oral History zu zeigen, wie Geschichte nicht nur passiv, sondern aktiv von der großen, aber meist schweigenden Masse der Betroffenen erlebt wird.
Bei diesem Methodenstreit31 wird meist übersehen, daß es nicht nur auf das Quellenmaterial, sondern auch auf das Erkenntnisinteresse ankommt, das naturgemäß unterschiedliche Vorgehensweisen verlangt. Dies führt unmittelbar zu der Frage nach den Inhalten von Oral History und biographischer Forschung.
2. Was ist Oral History?
Ursprünglich diente die Interviewtechnik unter deutschen Historikern nur als Zeitzeugen-, d.h. ,Eliten‘- oder ,Experten‘-Interview zur Stützung historischer Fakten,32 etwa
mit ehemaligen Funktionsträgern des Nationalsozialismus oder deren engen Mitarbeitern. Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre rückte unter dem Einfluß der
Soziologie des Alltags33 anstelle der „hohen Politik“34 zunehmend die Lebens- und Erfahrungswelt der ,kleinen Leute‘ während des Nationalsozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Blickpunkt der Geschichtswissenschaft, und der Kreis der
Befragten wurde erweitert.
„Die mündliche Überlieferung gewinnt bei der Erforschung des Alltags eine besondere Bedeutung, da in vielen Bereichen, wie z.B. Wohnen, Familienorganisation, Freizeitverhalten
31
32
33
34
16
GEORG HERBERT Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus, Frankfurt a.
M. 1968.
U.a. zwischen Niethammer und Wehler, vgl. VON PLATO Oral History als Erfahrungswissenschaft,
S. 98, Anm. 5.
Niethammer verweist hier auf den Bestand Zeugenschrifttum im Archiv des Münchner Instituts für
Zeitgeschichte, der seiner Angabe nach ca. 12.000 mündliche oder schriftliche Erinnerungen umfaßt.
Vgl. NIETHAMMER Postscript, S. 475.
Vgl. SCHÜTZ Wissenschaftliche Interpretation und Alltagsverständnis menschlichen Handelns, in:
Gesammelte Aufsätze 1, Den Haag 1971, S. 3-54, sowie BERGER, PETER, L. / LUCKMANN, THOMAS
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 1970.
NIETHAMMER Postscript, S. 472.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
hierdurch Informationen zu erhalten sind, die sich in den archivalischen Quellen und der
Sekundärüberlieferung kaum finden.35
Im Mittelpunkt des Interesses stand die Rekonstruktion anders nicht zugänglicher faktischer Abläufe, vor allem im Bereich der Lebenswelten breiter Bevölkerungsschichten,
insbesondere während des Nationalsozialismus, „die auch aus der ,mündlichen Überlieferung‘ zwischen den Generationen weitgehend ausgeklammert waren und noch
sind.“36 Diese Erwartungen wurden bald enttäuscht, da sich herausstellte, daß die Aussagen oft dem Vergleich mit anderen Quellen nicht standhielten, sich als ungenau oder
,falsch‘ erwiesen und sich die Frage nach der Authentizität der Zeitzeugenberichte
stellte. „Die ,Zeugnisse‘ wurden mißverstanden als authentische, unverfälscht ,wahre‘
Wiedergabe oder gar Abbild von Etwas in der Vergangenheit.“37 Um diesem Problem
auszuweichen, versuchte man, über einen detaillierten Fragenkatalog möglichst nahe an
die Vergangenheit heranzukommen, wodurch man dem Interviewpartner eine Erzählstruktur aufnötigte, die der Eigendynamik seiner Lebensgeschichte zuwiderlief und
trotzdem keine besseren Resultate erzielte. Dies führte zu der Einsicht, daß der Erkenntniswert von Zeugenaussagen woanders zu suchen sei als in der Erwartung, exakte Abbilder vergangener Wirklichkeiten zu erhalten.
Daher begann man, gerade diese vermeintliche Schwäche der Oral History, d.h. die
subjektive Färbung der erhaltenen Aussagen, als ihren besonderen Vorzug zu erachten
und die subjektive Wahrnehmung und Erfahrung von Geschichte in den Mittelpunkt zu
rücken. Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen die Aussagen nicht als richtig oder
falsch, sondern „als Wiedergabe subjektiv erlebter und verarbeiteter Ereignisse und Prozesse.“38
Oral History ist also eine Forschungstechnik, die nicht auf die Rekonstruktion faktischer Abläufe reduziert werden kann, sondern eine Vielzahl an thematischen und methodischen Möglichkeiten birgt. Sie wird für verschiedenste Forschungsinteressen angewandt, wie z.B. für die schicht- oder rollenspezifische Untersuchung in bestimmten
35 Ebenda, S. 473.
36 BRECKNER, ROSWITHA Von den Zeitzeugen zu den Biographen. Methoden der Erhebung und Auswertung lebensgeschichtlicher Interviews, in: Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte, hrsg. v.
Berliner Geschichtswerkstatt, Münster 1994, S. 199-222, hier S. 199.
37 BRECKNER, S. 200. Hier zeigt sich noch einmal, wie wenig heutzutage von den Historikern die Worte
Droysens bedacht werden, wenn sie tatsächlich von ihrem Quellenmaterial eine unverfälschte Wiedergabe der Vergangenheit erwarten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um schriftliche oder
mündliche Quellen handelt.
38 NIETHAMMER Postscript, S. 474.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
17
historischen Zeiträumen oder Regionen, man denke dabei an die Lokal- und Regionalgeschichte oder die Minderheiten-, Frauen- oder Arbeiterforschung. Die Interviewführung variiert hierbei von Leitfaden-Interviews zu narrativen Interviews,39 und entsprechend werden bei der Analyse und Auswertung unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, so u.a. bei den klassischen ,Experten‘-Interviews auf die Rekonstruktion von Ereignissen und bei narrativen Interviews auf die Rekonstruktion von subjektiven bzw. sozialen Deutungsmustern des Erlebens, seinen psychologischen Folgen und seiner Bewertung heute. Dabei holen sich die Oral Historians methodologische Hilfestellungen
bei ihren Nachbardiziplinen wie der Psychologie, Ethnologie, und im Falle lebensgeschichtlicher Interviews naheliegenderweise bei der soziologischen Biographieforschung.40
Insgesamt läßt sich in Deutschland in den letzten Jahren methodisch eine Verschiebung zugunsten erzählter Lebensgeschichten feststellen, die über die spezifische
Struktur der Erinnerungen die subjektive Geschichtserfahrung der Interviewpartner zu
entschlüsseln suchen.41
39 Leitfadeninterviews strukturieren das Gespräch durch vorgegebene Fragen, während hingegen im
narrativen Interview Wert darauf gelegt wird, den Gesprächspartner zu einer Stegreiferzählung zu
motivieren, etwa im lebensgeschichtlichen Interview mit der Aufforderung, seine Lebensgeschichte
zu erzählen. Vgl. Handbuch Qualitative Sozialforschung, S. 177-180.
40 „Mehr als in anderen Ländern hat es hierzulande eine Kooperation und einen Austausch mit benachbarten Wissenschaftszweigen gegeben, insbesondere mit der Volkskunde und der Biographieund Lebenslaufforschung der Soziologie, aber auch mit den Literaturwissenschaften, der Psychologie
und vereinzelt mit der Pädagogik und der Philosophie.“ VON PLATO Oral History als Erfahrungswissenschaft, S. 104.
41 Zu Oral-History-Projekten über den Nationalsozialismus siehe neben den Untersuchungen von
Niethammer: KELLER, BARBARA Rekonstruktion von Vergangenheit. Vom Umgang der „Kriegsgeneration“ mit Lebenserinnerungen, Vergangenheit. Opladen 1996, ROSENTHAL, GABRIELE „...Wenn
alles in Scherben fällt...“ Von Leben und Sinnwelt der Kriegsgeneration, Opladen 1987, ROSENTHAL,
GABRIELE „Als der Krieg kam, hatte ich mit Hitler nichts mehr zu tun“. Zur Gegenwärtigkeit des
„Dritten Reiches“ in erzählten Lebensgeschichten, Opladen 1990. Zu einer Gegenüberstellung der
Erinnerungen der Täter- und der Opferseite siehe ROSENTHAL, GABRIELE Antisemitismus im
lebensgeschichtlichen Kontext. Soziale Prozesse der Dehumanisierung und Schuldzuweisung, in:
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 3 (1992), S. 449-479, und ROSENTHAL,
GABRIELE Der Holocaust im Leben von drei Generationen. Familien von Überlebenden der Shoah
und von Nazi-Tätern, Giessen 1997. Speziell zu Holocaust-Überlebenden sind u.a. folgende Arbeiten
zu nennen: POLLAK, MICHAL Die Grenzen des Sagbaren. Lebensgeschichten von KZ-Überlebenden
als Augenzeugenberichte und als Identitätsarbeit, Frankfurt a. M. 1988, QUINDEAU, ILKA Trauma und
Geschichte. Interpretationen autobiographischer Erzählungen von Überlebenden des Holocaust,
Frankfurt a. M. 1995, HERZBERG, WOLFGANG Überleben heißt Erinnern. Lebensgeschichten deutscher Juden, Berlin und Weimar 1991, sowie ROSENTHAL, GABRIELE Überlebende der Shoah: Zerstörte Lebenszusammenhänge – Fragmentierte Lebensgeschichten, in: Fischer-Rosenthal, Wolfram /
Alheit, Peter (Hg.): Biographien in Deutschland, Opladen 1995, S. 432-455. Einen Überblick über
Oral-History-Studien zu dieser Thematik gibt EVA LEZZI in: Oral History und Shoah. Ein
Literaturbericht, in: Mittelweg 36 (1996), S. 48-54.
18
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
3. Exkurs: Die tschechische Historiographie und Oral History
In der tschechischen Historiographie ist die Methode der Oral History sehr spärlich verbreitet. In Prag ist 1999 der Band „Sto studentských revolucí“ von den jungen Historikern Milan Otáhal und Miroslav Vaněk erschienen, die über lebensgeschichtliche
Interviews die subjektive Wahrnehmung der ,Samtenen Revolution‘ seitens tschechischer Studenten untersuchen. In ihrem Vorwort bilanzieren sie den tschechischen Forschungsstand:
„Zkušenosti českých historiků s orální historií jsou doposud velmi omezené. Mnoho z nich
využívá interview zaměřené k určitým událostem, ale projektům opřeným o životopisná
vyprávění se česká historiografie (na rozdíl od sociologie) dosud věnovala jen
výjimečně.“42
Im Gegensatz zu Deutschland, wo inzwischen hauptsächlich mit lebensgeschichtlichen
Interviews gearbeitet wird, gibt es also in diesem Bereich in der Tschechischen Republik nur sehr wenige historische Untersuchungen. Wenn überhaupt auf mündliche Quellen zurückgegriffen wird, dann nur in Form des ,Experten‘-Interviews.
Zur Beschäftigung mit der jüdischen Minderheit auf der Basis von Interviews sind folgende Projekte anzuführen:
Das Jüdische Museum in Prag43 sammelt seit 1990 die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden, die auf Tonband aufgezeichnet und archiviert werden, um den
Holocaust an den tschechischen Juden systematisch zu dokumentieren. Außerdem
sollen die Interviews die soziale Wirklichkeit der jüdischen Familien im Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit festhalten, weshalb im ersten
Interviewteil auch nach Familie, Milieu, Bildung, Beruf, religiöser und nationaler Ausrichtung sowie Begegnungen mit Antisemitismus vor 1939 und Emigrationsplänen ge-
42 „Die Erfahrungen tschechischer Historiker mit Oral History sind bisher sehr begrenzt. Viele verwenden Interviews in Bezug auf konkrete Ereignisse, aber Projekten, die erzählte Lebensgeschichten
zur Grundlage haben, hat sich die tschechische Historiographie bisher sehr selten gewidmet.“
OTÁHAL, MILAN / VANĚK, MIROSLAV Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu
– životopisná vyprávění, Praha 1999, S. 39. Die umfangreichste abgeschlossene Untersuchung in der
ČSR auf der Basis lebensgeschichtlicher Interviews war eine historisch-soziologische Koproduktion:
vgl. JECHOVÁ, KVĚTA Lidé a společenství charty 77. Souvislosti životních příběhů a občanského
hnutí Charta 77 se zřetelem na jeho přínos k rozvoji občanské společnosti. Závěrečná zpráva
historické části biografického výzkumu, Praha 1996. CHRISTL, ILONA The connection between lifecourse and the civil right movement Charta 77 and its contribution to the development of a civil
society. Soziologischer Teil des Endberichts des Forschungsprojektes 28/94 der CEU. Praha 1996.
43 Vgl. HYNDRÁKOVÁ, ANNA / LORENCOVÁ, ANNA Systematic Collection of Memories Organized by
the Jewish Museum in Prague, in: Judaica Bohemiae 28 (1992), S. 53-63.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
19
fragt wird. In den „Terezínské Studie a Dokumenty 1999“ erschien ein Artikel der Projektleiterinnen mit dem Titel „Česká společnost a židé podle vzpomínek pamětníku“,
der ihre Ergebnisse zusammenfaßt.44
In der Slowakei werden in internationaler Zusammenarbeit mit dem Fortunoff Video
Archiv for Holocaust Studies der Universität Yale ebenfalls lebensgeschichtliche Interviews mit Überlebenden der Shoah geführt. Diese Interviews bilden die Grundlage für
Peter Salners Oral-History-Studie „Prežili Holokaust“.45
Von Seiten der deutschen Bohemistik gibt es zum tschechischen Judentum keine Arbeiten, die diese Methode anwenden. Als eine der wenigen deutschen bohemistischen
Oral-History-Studien ist die Publikation von Uta Müller-Handl, „Die Gedanken laufen
zurück...“ zu nennen, die sich mit den Lebensgeschichten von über vierzig sudetendeutschen Flüchtlingsfrauen befaßt.46 Ferner gibt es von Albert Lichtblau eine Veröffentlichung österreichisch-jüdischer Lebensgeschichten, worunter sich auch Werke tschechischer Autoren befinden, allerdings handelt es sich hierbei um schriftliche
Erzählungen.47
Was die deutschsprachige osteuropäische Historiographie angeht, so ergab eine Auswertung der in Vorbereitung befindlichen Dissertations- und Habilitationsschriften von
1995 bis 199948 in Hinblick auf Oral-History-Projekte auch ein recht mageres Ergebnis.
Es gibt eine Reihe von alltagsgeschichtlichen Arbeiten über das Leben von Arbeitern
bzw. Arbeiterinnen in der Sowjetunion, über den deutschen Rußlandfeldzug im Zweiten
Weltkrieg und zum Thema Bolschewismus.49 Explizit im Forschungstitel erwähnt wurden Oral History-Methoden nur in zwei Fällen.50 Angesichts der verschwindend ge44 HYNDRÁKOVÁ, ANNA / LORENCOVÁ, ANNA Česká společnost a židé podle vzpomínek pamětníků, in:
Terezínské Studie a Dokumenty 1999, Praha 1999, S. 97-118.
45 SALNER, PETER Prežili Holokaust, Veda vydavatelstvo SAV, Bratislava 1997.
46 MÜLLER-HANDL, UTTA „Die Gedanken laufen zurück...“ Hessische Flüchtlingsfrauen erinnern sich,
Wiesbaden 1993.
47 LICHTBLAU, ALBERT Als hätten wir dazugehört. Österreichisch-jüdische Lebensgeschichten aus der
Habsburger Monarchie, Wien 1999.
48 FRUNDER-OVERKAMP, GESINE In Vorbereitung befindliche Universitäts-Schriften aus der Geschichte
Osteuropas und Südosteuropas. Verzeichnisse 1995-1999. Hrsg. vom Osteuropa-Institut München.
49 HELD, THOMAS Sozial- und Alltagsgeschichte Leningrader Landarbeiter. Zum Wandel proletarischer
Lebenswelten in der frühen Sowjetzeit 1921-1932. SIN, EUNJU Alltagsleben Moskauer Textilarbeiterinnen, 1921-1932, sowie ohne Autor: Frauen in der Sowjetunion 1917-1941, alle drei Arbeiten sind Dissertationen in Basel. Ferner: ohne Autor: Zwischen Populismus und Bolschewismus.
Untersuchungen zur Mentalität und zum politischen Bewußtsein der Bevölkerung in Sowjetrußland
1920-1930, Dissertation Bonn. KIENLE, POLLY Das Feindbild der deutschen Soldaten im Rußlandfeldzug (1941-1945), Dissertation Konstanz.
50 Eine Dissertation bei Kappeler in Wien über „Smolensk unter dem Hakenkreuz 1941-1943. Eine
Analyse von Lebensgeschichten im Spannungsfeld zwischen historischer Amnesie und Erinnerung,
und eine Dissertation von IMKE METZGER Der Alltag deutscher Soldaten an der russischen Südfront
20
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
ringen Anzahl dieser Arbeiten kann man annehmen, daß in der deutschen Osteuropaforschung die Dominanz einer traditionellen Geschichtschreibung bisher wenig
beeinträchtigt wurde. Durch den Fall des Eisernen Vorhangs wurde zudem in völlig
neuem Maße traditionelles archivarisches Quellenmaterial zugänglich, das ganz neue
Perspektiven eröffnete, so daß ähnlich wie 1945 in der deutschen Geschichte derzeit in
diesem Bereich kein methodologischer Innovationszwang besteht.51
4. Methode
Da Oral History mehr ein Sammelbegriff für Forschungsvorhaben auf der Grundlage
mündlicher Quellen denn ein konkreter methodischer Zugang ist, bedarf jedes derartige
Projekt eines theoretischen Bezugsrahmens, anhand dessen die Interviews geführt und
im nachhinein analysiert werden können. Ich orientiere mich hierbei vorwiegend an der
soziologischen Biographieforschung und ihrer Anwendung durch Gabriele Rosenthal.52
Rosenthal stützt sich auf Schützes textanalytische Methode53 der biographischen Analyse und ihre Weiterentwicklung unter der Einbeziehung der phänomenologischen Soziologie durch Fischer-Rosenthal54 und der objektiven Hermeneutik nach Oevermann.55
Im folgenden möchte ich die Methode vorstellen und im Zusammenhang damit auf
häufig vorgebrachte Kritikpunkte eingehen, die daraus resultieren, daß die Kritiker, wie
bereits in den ersten beiden Kapiteln dargestellt wurde, andere Erwartungen an ihr
Quellenmaterial herantragen und dabei übersehen, daß die Brauchbarkeit einer Quelle
immer davon abhängt, welche Fragen man mit ihrer Hilfe zu beantworten sucht.
Die von Rosenthal verwendete Interviewtechnik ist das narrativ-lebensgeschichtliche
(unter besonderer Berücksichtigung von Interviews mit Zeitzeugen).
51 Zum Stand der Oral-History-Forschung zur Zeit des Umbruchs in den osteuropäischen Ländern
selbst, insbesondere in der Sowjetunion, siehe VON PLATO, ALEXANDER Einleitung zum
Schwerpunkt: Oral History in der Sowjetunion, in: BIOS 3 (1990), Heft 1, S. 1-7, sowie sieben
weitere Artikel im selben Heft von russischen Autoren über Oral-History-Projekte in ihrem Land.
52 U.a. ROSENTHAL, GABRIELE Die erzählte Lebensgeschichte als historisch-soziale Realität.
Methodologische Implikationen für die Analyse biographischer Texte, in: Alltagskultur, S. 125-138,
sowie ROSENTHAL, GABRIELE / FISCHER-ROSENTHAL, WOLFRAM Narrationsanalyse biographischer
Selbstpräsentationen, in: Hitzler, R. / Honer, A.: Sozialwissenschaftliche Hermeneutik, München
1997, S. 133-164.
53 Vgl. u.a. SCHÜTZE, FRITZ Kognitive Figuren des autobiographischen Stehgreiferzählens, in: Kohli,
M. / Robert, G.: Biographie und soziale Wirklichkeit, Stuttgart 1984, S. 78-117.
54 Vgl. u.a. FISCHER-ROSENTHAL, WOLFRAM Biographische Methoden in der Soziologie, in: Handbuch
Qualitative Sozialforschung, S. 253-256.
55 Vgl. OEVERMANN, U. Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften, in: Soeffner, H.G. (Hg.): Interpretative
Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften, Stuttgart 1979, S. 352-434.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
21
Interview, das die gesamte Biographie des Interviewpartners zum Thema hat. Das zentrale Anliegen ist hierbei, den Interviewpartner zu einer längeren Erzählung zu motivieren und ihn in einen Erinnnerungs- und Erzählstrom zu bringen: Mit einer offenen
Eingangsfrage wie „Wir möchten Sie bitten, uns Ihre Lebensgeschichte zu erzählen, angefangen in Ihrer Kindheit, so, wie Sie sich daran erinnern und was Ihnen wichtig erscheint.“ wird der Interviewpartner aufgefordert, sein Leben zu schildern, wobei es ihm
überlassen bleibt, seine Lebensgeschichte zu strukturieren. Der Quellentypus, mit dem
wir es hier zu tun haben, ist also eine biographische Selbstbeschreibung in Form einer
mündlichen Erzählung, die nach der Transkription in Textform vorliegt. Wie jede andere Quellenart erfordert auch diese Quelle eine sorgfältige Kritik, bevor mit der Analyse
begonnen werden kann, sowie eine hermeneutische Herangehensweise an den Text, da
er lediglich auf eine erlebte Vergangenheit verweist, keineswegs aber als ein 1:1-Abbild
derselben mißverstanden werden darf. Dies ist das grundsätzliche Problem, dem sich
ein jeder Historiker bei seiner Arbeit gegenübergestellt sieht.
Dennoch werden mündliche Quellen oft als weniger wissenschaftlich abqualifiziert.
Kritisiert wird unter anderem, daß die Quellenproduktion vom Forscher bei ihrer Entstehung unmmittelbar beeinflußt werde und diese Quellenform daher prinzipiell unter
Verdacht stehe, manipuliert zu sein.
Ferner sei sie zu subjektiv, da sie nur eine persönliche Sichtweise wiedergebe, die
nicht repräsentativ sei. Die subjektive Färbung der Quelle stellt allerdings für die vorliegende Untersuchung kein Hindernis dar, sondern ist im Gegenteil gerade Gegenstand
des wissenschaftlichen Interesses. Inwiefern die subjektive Wahrnehmung mit der historischen bzw. sozialen Wirklichkeit zusammenhängt, wird noch genauer zu erläutern
sein.
Ein weiterer gängiger Vorwurf lautet, daß die Erinnerung nach so langer zeitlicher
Distanz oft unpräzise sei, weshalb sich die Frage nach der Authentizität der Quellen
stelle.
Im folgenden möchte ich auf diese drei Vorwürfe näher eingehen.
4.1. Einflußnahme des Forschers auf die Quellenproduktion
Zum ersten Kritikpunkt sei vermerkt, daß diese Einflußnahme durch den Forscher in der
angewandten Interviewform bewußt auf ein Minimum reduziert wird, da ja gerade die
vom Interviewpartner im Erzähl- und Erinnerungsprozeß vorgenommene Eigenkonstruktion seines Lebens von wissenschaftlichem Interesse ist. Sicherlich darf die Beziehung zwischen Forscher und Autobiographen nicht außer acht gelassen werden. Man
22
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
wird beispielsweise folgende Fragen klären müssen: In welcher Beziehung stehen die
beiden zueinander, wie kam der Kontakt zustande, wo, in welcher Atmosphäre, und zu
welcher Forschungsthematik wurde das Interview geführt usw. Auch wird bei der Analyse darauf zu achten sein, wann der Interviewpartner frei erzählt, und wann er, bei
stockendem Gespräch, auf Fragen des Forschers reagiert. Denkt man aber an die generelle Standortgebundenheit des Wissenschaftlers, die auch im Umgang mit anderen
Quellen beachtet werden muß, so ist diese Art der Einflußnahme kein Hinderungsgrund
für eine wissenschaftliche Analyse.
4.2. Das Problem der Subjektivität und Repräsentativität
Was das Problem der Repräsentativität angeht, sei daran erinnert, daß dies weniger ein
Problem für den traditionell verstehend arbeitenden Historiker darstellt, der sich seit jeher vor der Schwierigkeit sah, aus dem Einzelfall allgemeine Aussagen ableiten zu müssen, denn für sozialwissenschaftlich-analytische Vorgehensweisen. Ihn beschäftigt
daher weniger die Nichtrepräsentierbarkeit einer qualitativen Studie als vielmehr die
subjektiv ,verzerrte‘ Darstellung historischer ,Fakten‘. Allerdings sollte daraus nicht der
Schluß gezogen werden, daß die erzählte Lebensgeschichte eine Wirklichkeit ihrer
selbst ohne Bezüge zur äußeren Welt darstellt. Vielmehr vollzieht sich subjektives
Erleben stets im Kontext der sozialen Wirklichkeit, in der die historischen Subjekte sich
bewegen und die daher Einfluß auf ihr Erleben und ihre heutige Bewertung der
Vergangenheit nimmt. Sowohl diejenigen, die die erzählte Lebensgeschichte auf die in
ihr referierten Ereignisse reduzieren wollen, als auch diejenigen, die in ihr lediglich die
Deutungsmuster der heutigen Perspektive der Biographen suchen, ignorieren,56 „daß
sich einerseits das Vergangene aus der Gegenwart und der antizipierten Zukunft
konstituiert, andererseits aber auch die Gegenwart aus dem Vergangenen und Zukünftigen.“57 Sowohl vom Standpunkt der Positivisten als auch der Subjektivisten wird
daher übersehen, daß eine Wechselwirkung zwischen historischen Prozessen, ihrem
Erleben und der heutigen Sicht der Dinge besteht.
56 Im letzteren Fall besteht vor allem die Gefahr, daß die Lebensgeschichte als reine Erfindung, d.h. als
,retrospektive Illusion‘ aufgefaßt wird, wie es von Max Frisch mit folgenden Worten auf den Punkt
gebracht wird: „Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann unter gewaltigen Opfern für
sein Leben hält.“ FRISCH, MAX Das Lesen und der Bücherfreund, in: Ausgewählte Prosa, Frankfurt a.
M., S. 9. Diese Position wird von Martin Osterland vertreten, vgl. hierzu OSTERLAND, M. Die
Mythologisierung des Lebenslaufs. Zur Problematik des Erinnerns, in: Baethge, M. / Essbach, W.
(Hg.): Soziologie: Entdeckung im Alltäglichen, Frankfurt a. M. 1983.
57 ROSENTHAL / FISCHER-ROSENTHAL Narrationsanalyse, S. 138.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
23
Grundlegend für diese Wechselwirkung sind die beiden folgenden Annahmen: Gemäß den Arbeiten von Schütze wird erstens davon ausgegangen, daß die Erzählstrukturen der erzählten Lebensgeschichte mit den Erlebensstrukturen der erlebten Lebensgeschichte korrespondieren. Mit anderen Worten beeinflußt das damalige Erleben
einerseits die heutige Sichtweise, die in der Erzählstruktur zum Ausdruck kommt,
andererseits beeinflußt die heutige Sichtweise die Bewertung der damaligen Erlebnisse.
Zweitens wird in Anlehnung an die verstehenden soziologischen Ansätze die
Biographie als soziales Gebilde aufgefaßt:
„Wenn Menschen ihre biographischen Erlebnisse erzählen, verweisen diese in die historisch-soziale Wirklichkeit eingebundenen Erlebnisse auf die über die persönliche Geschichte des Biographen hinausgehende kollektive Geschichte. Das Leben von Menschen
spielt sich in einer historisch-sozialen Wirklichkeit ab, es ist einerseits in geschichtliche
Strukturen und Prozesse eingebunden, und andererseits konstituiert das Leben von Menschen die soziale Wirklichkeit.“58
Und weiter:
„Wenn sich historische Ereignisse und Prozesse auf das Leben der Menschen ausgewirkt
haben, so werden sich Spuren davon in den erzählten Lebensgeschichten finden, ganz unabhängig davon, ob dies dem Biographen bewußtseinsmäßig zugänglich ist oder nicht.“59
Zusammengefaßt bedeutet das, daß erzählte Lebensgeschichten immer sowohl auf das
damalige Erleben als auch auf das heutige Leben mit diesen vergangenen Erlebnissen
hindeuten, eingebettet in historische und soziale Deutungsmuster. Die erzählte Lebensgeschichte ist also, und dies sei noch einmal hervorgehoben, keine rein subjektive
Angelegenheit, sondern spiegelt eine in der Vergangenheit erlebte historische
Wirklichkeit wider, die außerhalb ihrer selbst liegt. Selbst wenn man sich nur wenigen
erzählten Lebensgeschichten zuwendet, kann man bereits jeweils am konkreten
Einzelfall das Allgemeine, sprich, die Spuren der ‚großen Geschichte‘ rekonstruieren.60
58 ROSENTHAL Alltagskultur, S. 128.
59 ROSENTHAL, GABRIELE Geschichte in der Lebensgeschichte, in: BIOS 2 (1988), S. 3-15, hier S. 6.
60 „Vor dem Hintergrund einer dialektischen Konzeption von Individuellem und Allgemeinem kann von
der prinzipiellen Auffindbarkeit des Allgemeinen im Besonderen ausgegangen werden. Versteht man
das Allgemeine nicht im numerischen Sinne, hängt die Folgerung vom Einzelnen auf das Allgemeine
auch nicht von der Häufigkeit des Auftretens eines Phänomens ab, sondern von der Rekonstruktion
der konstituierenden Momente des einzelnen Phänomens in Absonderung der situationsspezifischen,
d.h. fallspezifischen Besonderheiten. Die Typik eines Falls bedeutet also nicht, daß dieser Fall häufig
in einer Population auftritt; sie repräsentiert vielmehr einen möglichen Umgang mit sozialer
24
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Methodologisch müssen daher zunächst unabhängig voneinander zwei Ebenen in der
Lebensgeschichte rekonstruiert werden: zum einen die Ebene der erlebten Lebensgeschichte, d.h. das subjektive Erfahren vergangener Ereignisse, das sich stets im Rahmen
bestimmter gesellschaftlicher Deutungsmuster vollzieht, und zum anderen die Ebene
der erzählten Lebensgeschichte, die von der heutigen Perspektive geprägt wird, d.h. die
Rekonstruktion der Mechanismen, die steuern, welche Erlebnisse erzählt werden und in
welcher Form die Erinnerungen dargeboten werden. Anschließend werden beide
Ebenen miteinander verglichen und kontrastiert, um zu ermitteln, welcher
Zusammenhang zwischen dem Erleben von ‚Geschichte‘ und der heutigen Sichtweise
besteht.
Auf die einzelnen Analyseschritte, die zur Rekonstruktion der erlebten und erzählten
Lebensgeschichte notwendig sind, wird unter D.1.1. ausführlich eingegangen.
4.3. Erinnerung
Abschließend ist noch der letzte Kritikpunkt, die Ungenauigkeit der Erinnerung, zu erörtern:
Erinnerung und biographische Selbstdarstellung sind naturgemäß eng miteinander
verknüpft. Es stellt sich daher grundlegend die Frage, welche Erinnerungen in welchem
Zusammenhang in der erzählten Lebensgeschichte vorstellig werden, inwieweit dieser
Zusammenhang Aussagen über das damalige Erleben und heutige Bewerten der persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen ermöglicht, und inwiefern dieser Zusammenhang
Aufschluß über die Identität61 des Biographen gibt.
Zu diesem Problem schreibt Dilthey im ersten Band seiner Einleitung in die Geisteswissenschaften:
„Schon im Gedächtnis vollzieht sich eine Auswahl, und das Prinzip dieser Auswahl liegt in
der Bedeutung, welche die einzelnen Erlebnisse für das Verständnis des Zusammenhanges
Wirklichkeit und damit einen Bestandteil derselben, selbst wenn er bisher nur ein einziges Mal gegeben ist.“ ROSENTHAL Alltagskultur, S. 134.
61 Identität wird hier soziologisch aufgefaßt: einerseits ist sie gesellschaftlich geprägt: das Individuum
wird sich seiner selbst durch die Abgrenzung gegenüber anderen bewußt. Durch die Sozialisation
lernt es, die Rolle des „Verallgemeinerten Anderen“ zu spielen, d.h. es lernt, welche Rolle in der organisierten Gesellschaft von ihm erwartet wird. Gleichzeitig gibt es aber auch eine individuelle Identitätskomponente („I“), die auf die gesellschafttliche Komponente („me“) reagiert. (vgl. hierzu MEAD
Geist, Identität und Gesellschaft) Identität ist demnach ein permanentes Wechselspiel zwischen „I“
und „me“, und ebenso, wie der Mensch in einen kulturellen Sinnzusammenhang hineingeboren wird
und ihn gleichzeitig durch sein Handeln gestaltet, kann auch die subjektive Identitätskomponente Einfluß auf die Gruppe nehmen, die die soziale Identitätskomponente prägt.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
25
meines Lebensverlaufs damals, als sie vergangen waren, hatten, in der Schätzung späterer
Zeiten bewahrten, oder auch, als die Erinnerung noch frisch war, von einer neuen Auffassung meines Lebenszusammenhangs aus erhielten; und jetzt, da ich zurückdenke, erhält
auch von dem, was mir noch reproduzierbar ist, nur dasjenige eine Stellung im Zusammenhange meines Lebens, was eine Bedeutung für dieses hat, wie ich es heute ansehe. Eben
durch diese meine jetzige Auffassung des Lebens erhält jeder Teil desselben, der
bedeutsam ist, im Lichte dieser Auffassung die Gestalt, in der er heute von mir aufgefaßt
wird. Diese Bedeutungsbezüge konstituieren das gegenwärtige Erlebnis und durchdringen
dasselbe.“62
Mit anderen Worten kann man sich nur dann an etwas erinnern, wenn man dem
Erlebten eine Bedeutung zumißt, und die Erinnerung versucht dabei, diese dadurch unvergeßlichen Erlebnisse in einen biographischen Sinnzusammenhang zu integrieren. Im
Prozeß des Erzählens schlägt sich dieser Sinnzusammenhang in der Erzählstruktur nieder, d.h. sowohl die thematischen wie temporalen Verknüpfungen der Textabschnitte
als auch die Verwendung von Erzählsorten sind nicht zufällig, sondern geben Aufschluß
über Erfahrungen, die für die Strukturierung der Lebensgeschichte wichtig waren und
bis heute sind.
Die Erinnerung bringt also die biographischen Daten und Erlebnisse gemäß ihrer Bedeutsamkeit in eine sinnvolle Ordnung, wobei gemäß der Konzeption der Biographie als
soziales Gebilde davon ausgegangen werden kann, daß sich diese Sinngebung im Rahmen sozialer Deutungsmuster vollzieht. Diese biographische Ordnung strukturiert unbewußt die erzählte Lebensgeschichte, weshalb postuliert wird, daß eine Analyse der Themenwahl und Form ihrer Darstellung Rückschlüsse auf diesen biographischen Sinnzusammenhang möglich macht. Diese subjektive Sinnstruktur, in der ein Individuum
sein Leben präsentiert, kann als Indikator für seine Identität betrachtet werden.
„Als eine per definitionem nachträgliche Konstruktion bringt die Erzählung die Ereignisse,
die im Laufe des Lebens wichtig waren, in eine Ordnung; wer sein Leben erzählt, versucht
im allgemeinen, mit Hilfe logischer Verknüpfungen von Schlüsselereignissen [...] Konsistenz zu schaffen. Das geschieht so selbstverständlich, als wären Konsistenz und Kontinuität in der Anordnung wichtiger Elemente einer Biographie allgemeingültige Kennzeichen für Selbstbewußtsein und Glaubwürdigkeit. Ein Leben lang „mit sich identisch“
62 DILTHEY, WILHELM Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (Wilhelm
Dilthey, Gesammelte Schriften, VII. Bd., hrsg. v. Bernhard Groethuysen), Göttingen 1979, S. 72.
26
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
sein, „man selbst“, „sich treu“ geblieben sein, gilt als Merkmal von Ich-Stärke.“63
Da sich der biographische Sinnzusammenhang je nach Gegenwartsperspektive verändert, ändert sich auch die Erinnerung, und der Biograph selektiert entsprechend andere
Erlebnisse aus dem Gedächtnis oder deutet dieselben auf andere Weise, um die Veränderungen in seinem Leben in sein persönliches Selbstbild integrieren zu können. Auf
diese Art und Weise wird die Kontinuität seiner persönlichen Identität gewährleistet.64
Die Erinnerung ist, wie wir gesehen haben, ein Vorgang, der einerseits stets von der
Gegenwart abhängt, andererseits sich daraus konstituiert, was in der Vergangenheit von
persönlicher Bedeutung war.65 Außerdem ist sie nicht nur individuell, sondern sozial
verfaßt, ebenso wie die Deutung von Ereignissen nicht nur subjektiv sondern kollektiv
geprägt ist. So werden Raster für die Realitätswahrnehmung vor allem über die frühkindliche und berufliche Sozialisation vermittelt, zudem gehört jede Person ihr Leben
lang verschiedenen Gruppen an, die sie in unterschiedlicher Weise beeinflussen, weshalb je nach Situation unterschiedliche Realitätswahrnehmungen dominieren und die
Interpretation der Vergangenheit verändern. Die subjektive Sinnstruktur, die die Erinnerung durch die jeweilige Verkettung und Deutung der Erlebnisse erzeugt, und die sich
in der erzählten Biographie in bestimmten Darstellungsformen niederschlägt, gibt Aufschluß darüber, wie der Biograph sich selbst bzw. sein Leben sieht. Sie gibt mit anderen
Worten Aufschluß über seine Identität.66
C. Juden in der Tschechoslowakei – ein historischer Überblick
In diesem Überblick sollen die für die Analyse der Interviews notwendigen historischen
Hintergründe dargestellt werden. Aufgrund des umfangreichen zeitlichen Rahmens, von
der tschechoslowakischen Staatsgründung am 28. Oktober 1918 bis in die Gegenwart,
63 POLLAK, S. 147.
64 Vgl. ROSENTHAL Geschichte in der Lebensgeschichte, S. 10.
65 „Man erinnert sich ja nicht an alle Situationen des Lebens, die mit den Gefühlen der Gegenwart
korrespondieren, sondern eben nur an diejenigen, die in ihrer Bedeutung eine thematische Verknüpfung mit der gegenwärtigen Situation aufweisen [...] Die Gegenwartsperspektive und gegenwärtige
Lebenspraxis des Erinnernden lassen also entsprechend ihrer Gestalt ein Erlebnis vorstellig werden,
wie umgekehrt das vorstellig werdende Erlebnis die Gegenwart konstituiert.“ ROSENTHAL, GABRIELE
Erlebte und erzählte Lebensgeschichte, Frankfurt a. M. / New York 1995, S. 75.
66 Die wesentlichen erinnerungs- bzw. identitätsbildenden Faktoren sind Nationalität, Geschlecht, Beruf,
politisches Engagement, Religion, vgl. POLLAK, S. 154. Obwohl Identität stets sozial geprägt ist, wird
bei der Analyse begrifflich zwischen persönlicher Identität und sozialer Identität unterschieden,
wobei erstere die subjektive Sinnstruktur, d.h. das biographische Selbstbild im allgemeinen bezeichnen soll, und zweitere die soziale Verfaßtheit dieses Selbstbildes in Hinblick auf das Judentum bzw.
die Nationalität meint.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
27
kann nur eine grobe Skizze vermittelt werden. Die Geschichte des slowakischen Judentums wird nicht behandelt, da sie sich grundsätzlich von der des böhmischen und
mährischen Judentums unterscheidet und angesichts der Tatsache, daß unter den
interviewten Personen keine Slowaken waren, für diese Arbeit nicht relevant ist.
1. Die Erste Tschechoslowakische Republik 1918-1938
Die Juden Böhmens, Mährens und Schlesiens befanden sich im Vergleich zum österreichischen oder deutschen Judentum 1918 in einer besonderen Lage, da sie zwischen
zwei Nationalitäten standen, der deutschen und der tschechischen, wobei erstere ihre
politische Vormachtstellung nun zugunsten letzterer hatte abgeben müssen. Angesichts
der sich in Ostmitteleuropa neu konstituierenden Nationalstaaten, des ,Vierzehn PunktePlans‘ von Wilson und insbesondere nach der Balfour-Erklärung 1917 erhielt auch die
jüdische Nationalbewegung starken Aufwind. Am 22. Oktober 1918 wurde der Jüdische
Nationalrat für Böhmen gegründet, der schon am 28. Oktober 1918 dem Tschechoslowakischen Nationalrat ein Memorandum vorlegte. Darin wurden vor allem die
Anerkennung der Juden als Nation und die Freiheit, sich zu dieser zu bekennen, volle
bürgerliche Gleichberechtigung sowie nationale Minderheitenrechte verlangt. Diese
Forderungen wurden vom Tschechoslowakischen Nationalrat akzeptiert, was dazu
führte, daß die Anerkennung der jüdischen Nationalität in der tschechoslowakischen
Verfassungsurkunde verankert wurde. Ferner wurde der im September 1919 von der
Tschechoslowakei in St. Germain unterzeichnete Minderheitenschutzvertrag67 in die
67 Angesichts der Tatsache, daß die nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie entstandenen
Nationalstaaten keineswegs homogene Gebilde waren, sondern vielmehr mit z.T. sehr großen
nationalen Minderheiten konfrontiert waren, die ihrerseits auf ihre nationale Selbstverwirklichung
gemäß der ,Vierzehn Punkte‘ pochten, sowie antisemitischer Ausschreitungen insbesondere in Polen,
aber auch in der Slowakei, sahen sich die Alliierten auf den Friedenskonferenzen veranlaßt, die
Vertreter der neuen Staaten zur Unterzeichnung von Minderheitenschutzverträgen zu verpflichten.
Polen wurde zudem zu der Unterzeichnung von zwei Zusatzklauseln, die jüdische Minderheit betreffend, verpflichtet – der Gewährung eines jüdischen Schulwesens sowie der Sabbathruhe –, die auch
die Vertreter des böhmischen Judentums von der tschechoslowakischen Regierung forderten. Diese
lehnte die Zusatzklauseln mit dem Argument ab, derartige ;Strafklauseln‘ aufgrund ihrer weltweit
bekannten liberalen Haltung gegenüber den Juden nicht nötig zu haben, was zur Folge hatte, daß die
jüdische Minderheit im Minderheitenschutzvertrag nicht besonders aufgeführt wurde. „Bei den Verhandlungen auf der Friedenskonferenz in bezug auf den Minderheitenschutz der Juden, hat die
tschechoslowakische Delegation nur eine Sache gefordert: daß der Schutz der jüdischen Minderheit in
dem Minderheitenschutzvertrag nicht besonders angeführt würde; die tschechoslowakische Delegation erachtete dies damals als gegenstandslos.” Edvard Beneš: Die Tschechoslowakei auf der
Friedenskonferenz und ihre Minderheiten. Prager Presse Nr. 278 v. 9.10.1937, zitiert nach LIPSCHER,
LADISLAV Die soziale und politische Stellung der Juden in der Ersten Republik, in: Die Juden in den
böhmischen Ländern, Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 27.-29.11.
1981, München / Wien 1983, S. 269-280, hier S. 271. Vgl. ebenfalls hierzu RABINOWICZ, AHARON
MOSHE The Jewish Minority, in: The Jews of Czechoslovakia, Historical Studies and Surveys, Vol.I,
28
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Verfassung aufgenommen, womit sich der tschechoslowakische Staat zur strikten
Gleichbehandlung aller Bürger, unabhängig von Rasse, Sprache oder Religion
verpflichtete.68 Obwohl im allgemeinen die Sprache als Kriterium für die nationale
Zugehörigkeit galt, wurde den Juden zugestanden, ihre Nationalität unabhängig von der
Muttersprache als jüdisch anzugeben:
„Strittig ist [...] die Frage, ob die Juden ein Volk sind. Indem die Verfassung die Wendung,
ohne Rücksicht auf Rasse, Sprache oder Religion verwendet [...], überläßt sie es einem jeden, sich selbst zu entscheiden, worin er das charakteristische Merkmal der Nationen erblickt und sich danach frei zu entscheiden. Hält also jemand die Juden für ein selbständiges
Volk, so ist er berechtigt, sich national als Jude zu bekennen, selbst wenn er der Religion
nach z.B. konfessionslos wäre, ob er nun tschechischer, deutscher oder anderer Muttersprache ist. Die Juden sind also nicht verpflichtet, bei Volkszählungen, Wahlen usw. sich
zu einer anderen ethnischen Minderheit zu bekennen als zur jüdischen.“69
Mit anderen Worten wurde es den Juden selbst überlassen, sich über ihren Glauben oder
über nationale Kriterien zu definieren.
Hier zeigt sich bereits, daß man bei den Juden Böhmens und Mährens keineswegs
von einer homogenen Gruppe sprechen kann. Während die Zionisten und Anhänger des
Jüdischen Nationalrats bzw. der aus ihm hervorgegangen nationalen Jüdischen Partei
ihr Judentum als Nationalität sahen, war es für andere lediglich eine Frage der
Konfession, während sie sich in nationaler Hinsicht tschechisch bzw. deutsch
orientierten (einige waren nicht einmal mehr Mitglieder der Jüdischen Gemeinde, sei es
aus fehlendem Glauben oder da sie konvertiert waren). Dies zeigt sich deutlich in den
Ergebnissen
der
1921
und
1930
in
der
Tschechoslowakei
durchgeführten
Volkszählungen. So wurden 1921 125.083, 1930 117.551 Juden gemäß Religion, aber
nur 30.267 bzw. 30.002 der Nationalität nach gezählt.70
Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, wie kompliziert die Frage nach der Identität der
böhmischen Juden in der Zwischenkriegszeit war. Um zu verstehen, wie es zu dieser
Dreiteilung kommen konnte, muß man ins 19. bzw. sogar ins 18. Jahrhundert zurückgehen.
Philadelphia / New York, 1968, S. 155-265, hier S. 172-177.
68 Vgl. MENDELSOHN, EZRA The Jews of East Central Europe Between The World Wars, Bloomington
1983, S. 150, LIPSCHER, S. 272 sowie RABINOWICZ, A., S. 186.
69 Bericht des Verfassungsausschusses, zitiert nach WELTSCH, FELIX Masaryk und der Zionismus, in:
Rychnovsky, E. (Hg.): Masaryk und das Judentum, Prag 1931, S. 67-116, hier S. 89.
70 Vgl. LIPSCHER, S. 274.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
29
Das Toleranzedikt von Joseph II. brachte den Juden 1782 einige Freiheiten, z.B. die
Erlaubnis, außerhalb des Ghettos zu siedeln oder Medizin und Recht zu studieren, so
daß für sie der deutsche Liberalismus geradezu als Äquivalent für Toleranz und Modernisierung erschien.71 Andererseits bedeuteten die josephinischen Reformen durch die
Einführung des Deutschen als Amtssprache in gewissem Maße eine erzwungene
Germanisierung der Juden, was sie in Mißkredit bei der tschechischen Bevölkerung
brachte.72
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts lebten die meisten Juden Böhmens, abgesehen
von der großen Prager Gemeinde, auf dem Land in kleineren Gemeinden des tschechischen Mittelböhmens – bzw. in Mähren in selbstverwalteten Ortschaften neben
christlichen Städten desselben Namens – in sehr bescheidenen Verhältnissen (der typische Beruf des ‚Dorfjuden‘ war der des Hausierers).73 Vor allem die böhmischen Juden standen in enger Beziehung zu ihrem tschechischen Umfeld, so daß sie zweisprachig waren.74 Das Tschechische war die Sprache des Alltags, während das Deutsche
einen offiziellen, ja manchmal beinahe feierlichen Charakter hatte (Unterrichts- und
Gottesdienstsprache).
Die Prager Jüdische Gemeinde hatte sich schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts an
der deutschen Sprache und Kultur als Trägern der Aufklärung und Modernisierung
orientiert, und seit dem Vormärz nahm auch auf dem Land die deutsch ausgerichtete
Assimilation zu. Neben der bereits erwähnten Gleichsetzung von deutscher Kultur und
Fortschritt mag hierzu auch der Antisemitismus tschechischer Arbeiter und kleinerer
Gewerbetreibender beigetragen haben.75
Mit den Reformen 1848/49 (Freizügigkeit, Abschaffung der Judensteuer und des Familiantengesetzes, 1852 Auflösung des Prager Ghettos) kam es unmittelbar darauf zu
einer Migration im nächsten Umfeld. Nach der vollkommenen rechtlichen Gleichstellung 1867 wanderte die nächste Generation im Zuge der allgemeinen Urbanisierung
in die Städte ab, wo sie sich zum Großteil an die deutsche Kultur assimilierte. In den
71 Vgl. HAHN, FRED The Dilemma of The Jews in The Historic Lands of Czechoslovakia.1918-1938, in:
East Central Europe 10 (1983), S. 24-39, hier S. 27.
72 Jüdische Händler mußten von nun an ihre Geschäftsbücher auf deutsch führen, und 1787 verfügte der
Kaiser per Dekret, daß auch die Rabbiner sich im nicht liturgischen Teil der Gottesdienste, bei
Trauungen usw. der deutschen Sprache bedienen mußten. Ferner wurden die jüdischen Schulen in
deutsch-jüdische Schulen umgewandelt. Vgl. HAHN, ebenda.
73 Vgl. HAHN, S. 28.
74 Vgl. IGGERS, WILMA Die Juden in Böhmen und Mähren, München 1986, S. 15.
75 Vgl. ebenda, S. 19.
30
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
siebziger Jahren entstand aber auch eine tschechische Assimilationsbewegung,76 die mit
dem Aufkommen des deutschen bzw. österreichischen politischen Antisemitismus in
den achtziger und neunziger Jahren stärkeren Zulauf erhielt, so daß um 1900, trotz der
Svůj k Svému-Bewegung und der Hilsner-Affaire in Polná, bereits über 50 Prozent der
böhmischen Juden tschechisch als ihre Umgangssprache angaben (im Vergleich zu
einem Drittel 1880).77 Das mag u.a. mit dem zunehmenden Einfluß Masaryks auf die
tschechische Nationalbewegung zusammenhängen, der im Polná-Prozeß als einer der
wenigen öffentlich Stellung gegen die antisemitische Hetzjagd genommen hatte.78
Außerdem wollten wohl viele Juden dem tschechischen Antisemitismus, der sie wegen
ihres Deutschtums anfeindete, durch Identifikation mit den Tschechen begegnen. Nichts
desto trotz besuchten jüdische Kinder bis zur tschechoslowakischen Staatsgründung
überwiegend deutsche Schulen, und Deutsch blieb die Bildungssprache.79
Außerdem entstand auch in Böhmen um die Jahrhundertwende eine zionistische Bewegung. So wurde 1892 eine nationale studentische Vereinigung gegründet, die unter
dem späteren Namen Bar Kochba ein wichtiges ideologisches Zentrum des böhmischen
Zionismus darstellte. Seit 1907 erschien die zionistische Wochenzeitung Selbstwehr,
die bald das wichtigste zionistische Presseorgan Böhmens wurde.80
Auch waren es Zionisten, die 1918 den Jüdischen Nationalrat gründeten, der ebenso
wie die im Januar 1919 aus ihm hervorgehende Jüdische Partei mit dem Anspruch auftrat, die Juden Böhmens als nationale Minderheit zu vertreten.81 Doch wie sich im Zensus von 1921 herausstellte, repräsentierte die nationale Bewegung lediglich ein Viertel
des böhmischen und mährischen Judentums. Die überwiegende Mehrheit der Juden definierte sich religiös, wobei die tschechisch assimilierten Juden die größte Gruppe darstellten, dicht gefolgt von den deutschen Juden.82
76 Vgl. KESTENBERG-GLADTSTEIN, RUTH The Jews between Czechs an Germans in the Historic Lands,
1848-1918, in: The Jews of Czechoslovakia, Vol.I., S. 21-71, hier S. 33.
77 Vgl. STÖLZL, CHRISTOPH Die ,Burg‘ und die Juden, in: Die ,Burg‘. Einflußreiche politische Kräfte
um Masaryk und Beneš, Bd.II, hrsg. v. Bosl, K. / Bachstein, M. K., München 1974, S. 79-110, hier S.
83.
78 Vgl. HAHN, S. 35.
79 Vgl. MENDELSOHN, S. 133.
80 Vgl. RABINOWICZ, OSKAR K. Czechoslovak Zionism: Annalecta to a History, in: The Jews of
Czechoslovakia, Vol.II, Philadelphia / New York 1971, S. 19-136, hier S. 20ff.
81 Die Jüdische Partei errang in den Parlamentswahlen 1925, nach dem Zusammengehen mit der polnischen Minderheitenpartei, zwei Mandate. Dieser Wahlerfolg wiederholte sich noch einmal 1935,
dieses Mal allerdings dank eines Zusammengehens mit der tschechischen Sozialdemokratie. Vgl.
RABINOWICZ, A., S. 160.
82 Die Zahlen für Böhmen und Mähren zeigen deutliche Unterschiede: In Böhmen bekannten sich fast
50 Prozent zur tschechischen, etwa ein Drittel zur deutschen und nur der verbleibende Rest zur
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
31
Insgesamt läßt sich in der Zwischenkriegszeit eine zunehmende ,Tschechisierung‘ der
jüdischen Bevölkerung feststellen. Die jüngere Generation, die in der Republik aufwuchs und tschechische Schulen besuchte, identifizierte sich zunehmend mit dem tschechoslowakischen Staat und tschechischen Idealen, während vor allem ältere Juden, die
noch im Kaiserreich sozialisiert worden waren, an der deutschen Kultur festhielten.83
Im Zensus von 1930 ist sowohl in Böhmen als auch in Mähren ein leichter Anstieg
der national orientierten Juden festzustellen, so daß für beide Gebiete zusammen nun
der Anteil der Juden deutscher Nationalität hinter diejenigen jüdischer Nationalität
zurückfiel.84
Trotz der gestiegenen jüdischen Bekenntnisse schritt die tschechische Assimilation
weiter voran, was sich einerseits daran zeigt, daß in demselben Zeitraum die Zahl der
jüdischen Gemeinden von 205 auf 170 sank85 und gleichzeitig eine stetige Zunahme
von Mischehen festzustellen war.86
Mit dem wachsenden Antisemitismus in den deutschen Gebieten in den dreißiger Jahren nahmen zunehmend mehr Juden von der deutschen Kultur Abstand, was sich beispielsweise im Rückgang der jüdischen Schülerzahlen an deutschen Schulen widerspiegelt.87 Ein Jude aus Prostějov faßte es 1937 in folgenden Worten zusammen:
„Es ist unmöglich, der heutigen jüdischen Jugend eine deutsche Ausbildung zu erteilen.
Wir müssen das Deutschtum ablehnen, obwohl wir dessen größter Verbreiter waren. Wir
sprechen diese Sprache nur, weil sie für uns [...] zu einem universellen Verständigungsmittel wurde, weil sie uns unseren großen Schriftstellern, Wissenschaftlern und
schließlich uns selbst näherbrachte, für unsere Jugend hat jedoch das Erlernen dieser Sprache keinen Sinn mehr.“88
83
84
85
86
87
88
32
jüdischen Nationalität, während hingegen in Mähren fast 50 Prozent die jüdische, nur etwa 15 Prozent
die tschechische und ebenfalls etwa ein Drittel die deutsche Nationalität wählten. Vgl. Statistik in:
FRIEDMANN, FRANZ Einige Zahlen über die tschechoslowakischen Juden, Prag 1933, S. 23. Diese
hohe Zahl an jüdischen Bekenntnissen in Mähren mag darauf zurückzuführen sein, daß die Juden dort
mehr in geschlossenen Gemeinden lebten und daher traditionsgebundener waren als in Böhmen. Vgl.
IGGERS, W., S. 313.
Vgl. MENDELSOHN, S. 159.
In Böhmen geschah dies vor allem auf Kosten des deutschen Anteils, doch auch der tschechische ging
leicht zurück. In Mähren dagegen verlor nur der deutsche Anteil Prozentpunkte, während sich der
tschechische etwas verbesserte. Vgl. Statistik in FRIEDMANN, S. 25.
Vgl. WLASCHEK, RUDOLF M. Juden in Böhmen, Wien / München 1990, S. 82.
Vgl. MENDELSOHN, S. 160.
Laut Hahn besuchten im Schuljahr 1932/33 nur noch 16 Prozent der jüdischen Schüler in der
Tschechoslowakei deutsche bzw. ungarische Schulen, im Gegensatz zu 84 Prozent, die auf
tschechische oder slowakische Schulen gingen (HAHN, S. 32).
MAIMANN, SAMUEL Das Mährische Jerusalem, Prostějov 1937, S. 4.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
In religiöser Hinsicht waren die Juden im westlichen Teil der Republik weitgehend säkularisiert, die meisten feierten keinen Sabbath mehr, hielten sich nicht an die Speisevorschriften und besuchten, wenn überhaupt, die Synagoge nur an den Hohen
Feiertagen (,Drei-Tages-Juden‘).89 Doch im Zusammenhang mit der jüdisch-nationalen
bzw. zionistischen Bewegung und durch den Einfluß der orthodoxen Gemeinden im
Osten des Landes erlebten jüdische Bräuche und Kultur in der Zwischenkriegszeit eine
gewisse Renaissance. Vor allem in den dreißiger Jahren entstand in der jüngeren
Generation eine Bewegung, die sich als Reaktion auf die fortschreitende Assimilation
intensiv mit der Orthodoxie und dem Chassidismus zu beschäftigen begann.90
Was die Wirtschafts- und Sozialstruktur anbelangt, gehörten die Juden in den böhmischen Ländern seit etwa 1900 bereits zur gutsituierten Mittelschicht. Neben dem allgemeinen Urbanisierungstrend im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung sahen
viele Juden in den Städten bessere Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftschancen für
ihre Kinder. Zudem bot die Anonymität in der Stadt größeren Schutz vor antisemitischen Attacken. 1918 lebten in Böhmen und Mähren 80 Prozent aller Juden in Städten
mit über 5.000 und 60 Prozent in Städten mit über 60.000 Einwohnern.91 Gemäß einer
tschechoslowakischen Statistik von 1921 waren 61,8 Prozent der böhmischen und 62,4
Prozent der mährischen Juden selbständig, 22,7 bzw. 20,2 Prozent Angestellte und lediglich 15,4 bzw. 17,3 Prozent Arbeiter. Dabei betrug ihr Anteil im Handels- und
Finanzwesen in Böhmen 1930 60,8 bzw. in Mähren 55,9 Prozent, in den freien Berufen,
der Armee und dem öffentlichen Dienst 22,6 bzw. 14,6 Prozent, in Industrie und Gewerbe 22,6 bzw. 28,5 Prozent, in der Landwirtschaft dagegen nur 1,8 bzw. 1,0
Prozent.92 Was die Schulbildung betrifft, so war der Anteil an jüdischen Gymnasiasten
und Studenten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überproportional hoch. Im
Schuljahr 1935/36 beispielsweise waren 11,9 Prozent aller Studenten jüdischer
Herkunft, während hingegen der jüdische Bevölkerungsanteil lediglich etwa 2,42
Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte.93
89 Vgl. IGGERS, W., S. 211, sowie STRÁNSKÝ, HUGO The Religious Life in the Historic Lands, in: The
Jews of Czechoslovakia, Vol.I., S. 330-357, hier S. 347f.
90 Vgl. HOSTOVSKÝ, EGON The Czech-Jewish Movement, in: The Jews of Czechoslovakia, Vol.II.,
S. 148-154, hier S. 153.
91 Vgl. POJAR, MILOŠ 1000 let společného života Židů a Čechů v českém státě, in: Akce Nisko v historii
„konečného řešení židovské otázky“. K 55. Výročí první hromadné deportace evropských Židů.
Mezinárodní vědecká konference, Ostrava 1995, S. 21-31, hier S. 27.
92 Vgl. HERMAN, JAN The Development of Bohemian and Moravian Jewry, 1918-1938, in: Papers in
Jewish Demography 1969, Jerusalem 1973, S. 191-206, hier S. 193 sowie S. 201.
93 Vgl. MENDELSOHN, S. 142 u. S. 162.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
33
Insgesamt läßt sich für den Zeitraum der Ersten Republik sagen, daß die Juden, zumindest was den westlichen Teil des Landes angeht, von staatlicher Seite keinerlei Diskriminierungen erfuhren. In der Bevölkerung kam es zwar in den ersten Jahren nach der
Staatsgründung vereinzelt zu antijüdischen Auschreitungen,94 doch sie fanden keinen
öffentlichen Widerhall.95
In den dreißiger Jahren wurde die Tschechoslowakei zum Zufluchtsort für jüdische
wie politische Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Unter den böhmischen Juden verstärkte diese Entwicklung die Loyalität gegenüber dem tschechoslowakischen Staat, in dem sie ein Bollwerk der bürgerlichen Freiheit und Demokratie
sahen.96
In den deutschen Grenzgebieten spitzte sich die antisemitische Stimmung derart zu,
daß es bereits in den Monaten vor dem Münchner Abkommen zu einer Fluchtbewegung
ins Landesinnere kam.97
2. Die Tschecho-Slowakei 1938/39
Nachdem das tschechoslowakische Grenzgebiet in München dem Dritten Reich zugesprochen worden war, setzte eine massenhafte Flucht von Juden ein, die in der verkleinerten Tschecho-Slowakei Schutz suchten bzw. sich bemühten, von dort weiterzugelangen.98
Aber auch in der sogenannten Zweiten Republik wurden zunehmend antisemitische
Töne laut, was zum einen auf die allgemeine wirtschaftliche wie moralische Krise nach
dem Münchner Abkommen zurückzuführen ist, und zum anderen auf den großen
Flüchtlingsstrom. Von vielen Seiten wurde eine Beschränkung der Einwanderung ge-
94 Vor allem in der Slowakei, vgl hierzu FLEISCHMANN, GUSTAV The Religious Congregation, 19181938, in: The Jews of Czechoslovakia, Vol.I., S. 267-329, hier S. 273. Aber auch in Prag kam es 1918
zu antisemitischen Attacken: so wurden Räumlichkeiten des Jüdischen Rathauses demoliert und
Thorarollen geschändet, vgl. RABINOWICZ, S. 247.
95 Vgl. HAHN, S. 35.
96 So etwa Eduard Lederer, einer der führenden Theoretiker der tschechisch-jüdischen Bewegung: „Náš
stát je skutečným ostrovem svobody pro židy jako pro ostatní své občany.“ „Unser Staat ist eine
wahre Insel der Freiheit für Juden wie für alle anderen seiner Staatsbürger.“ LEDERER, EDUARD Krize
v židovstvu a v židovstí, Praha 1934, S. 39.
97 Ihren Höhepunkt fanden die antisemitischen Ausschreitungen nach der Reichsparteitagsrede Hitlers
im September 1938, als es in Eger, Asch und Karlsbad zur Demolierung jüdischer Geschäfte kam.
Vgl. WLASCHEK, S. 61.
98 So wurden im Mai 1939 im ,Reichsgau Sudetenland‘ nur mehr 2.363 von ursprünglich 27.073 Juden
gezählt. Vgl. SCHMIDT-HARTMANN, EVA Protektorat Böhmen und Mähren, in: Benz, Wolfgang (Hg.):
Dimension des Völkermords: Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1996,
S. 353-379, hier S. 356.
34
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
fordert, und tatsächlich wurde die Einreise ins Land erheblich erschwert.99 Deutsch assimilierte Juden wurden vielfach als Verräter und Mitschuldige an der nationalen Katastrophe in München angefeindet, und einige tschechische Institutionen begannen, eine
Reinigung von nicht-tschechischen Elementen zu fordern.100 Während sich die Stimmung in der Gesellschaft derart radikalisierte, bemühten sich die Juden dennoch,
äußerste Loyalität zu zeigen, was sich in der hohen Summe (80 Millionen von
insgesamt 460 Millionen Kronen), die sie im Zuge der Sammlung für die Verteidigung
der Republik aufbrachten, deutlich zeigt.101 Dennoch blieb der Stimmungsumschwung
nicht ohne Folgen. Zum einen stieg in der Zweiten Republik die Anzahl der
Konversionen und Selbstmorde, und zum anderen setzte eine Emigrationsbewegung ein,
die von der Regierung sehr begrüßt und gefördert wurde. Im Zusammenhang damit
erhielt auch die zionistische Bewegung, insbesondere unter jungen Leuten, starken
Zulauf. 102
Die antisemitische Stimmung erreichte ihren Höhepunkt wenige Wochen vor der
deutschen Okkupation, als etwa 1.000 Juden im öffentlichen Bereich, etwa in öffentlichen Krankenhäusern oder an der deutschen Universität, ihre Stellung verloren.103
3. Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945
Am 15. März 1939 besetzte die deutsche Wehrmacht die ,Rest-Tschechei‘, womit
sich die Lage der jüdischen Bevölkerung rapide verschlechterte. Die Gestapo begann
sofort mit der Verhaftung von ,Staatsfeinden‘, darunter neben politischen Gegnern und
deutschen Emigranten auch zahlreichen Juden.104 Am 17. März, einen Tag nach Hitlers
Erlaß zur Errichtung des autonomen Protektorats Böhmen und Mähren, beschloß die
tschechische Regierung unter dem Einfluß einheimischer Faschisten eine ganze Serie
von antijüdischen Maßnahmen bezüglich Erwerb und Veräußerung jüdischer Eigentumswerte.105 Seit Ende April widmete man sich mit größter Intensität einer Neu-
99 Laut Krejčová wurden nur diejenigen Juden ins Land gelassen, die sich im Zensus von 1930 zur
tschechischen Nationalität bekannt hatten, vgl. KREJČOVÁ, HELENA Židé a česká společnost. Léta
1938-1939, in: Akce Nisko, S. 53-61, hier S. 56f.
100 Vgl. ebenda, S. 55 und S. 58.
101 Vgl. ebenda, S. 56.
102 Vgl. ROTHKIRCHEN, LIVIE Osud Židů v Čechách a na Moravě v letech 1938-1945, in: Osud Židů v
Protektorátu 1939-149, Praha 1991, S. 17-79, hier S 24f.
103 Vgl. ebenda, S. 27, sowie KREJČOVÁ Židé, S. 58ff.
104 In der ersten Woche wurden bereits 1.000 Personen festgenommen, vgl. ROTHKIRCHEN Osud, S. 32.
105 Vgl. ROTHKIRCHEN, LIVIE Motivy a záměry protektorátní vlády v řešení židovské otázky, in: Akce
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
35
regelung der Stellung der Juden im öffentlichen Leben, tat sich aber schwer mit der
Frage, wie die Zugehörigkeit zum Judentum zu definieren sei. Die Nationalsozialisten
sahen zunächst davon ab, die Einführung der Nürnberger Gesetze zu fordern, da sie diesen Schritt der tschechischen Regierung überlassen wollten, um eventuellen antideutschen Protesten vorzubeugen, und beließen es vorerst dabei, antisemitische Propaganda zu betreiben.106 Die Protektoratsregierung kam jedoch zu keinem Entschluß, weshalb schließlich doch Reichsprotektor Neurath die Initiative ergriff und mit der Verordnung über jüdischen Besitz vom 21. Juni 1939 rückwirkend ab dem 15. März die
Nürnberger Rassengesetze auf das Protektorat ausdehnte. Außerdem wurde die Durchführung der Verordnung, sprich die Enteignung jüdischer Firmen und jüdischen Besitzes, ausschließlich deutschen Reichsorganen unterstellt, wodurch der jüdische Besitz
direkt in deutsche Hände überging.107
Von diesem Zeitpunkt an gingen alle antijüdischen Gesetze und Maßnahmen vom
Dritten Reich aus, und die vermeintlich autonome Protektoratsregierung führte mehr
oder weniger ein Schattendasein:
„Ve skutečnosti záhy po vydání nařízení o židovském majetku převzal říšský protektor de
iure pravomoc nad židovskými obcemi. I když celá řada osnov a nařízení vydaných na
rozhraní let 1939-1940 nese imprimaturu protektorátní vlády, česká vláda přestala být
odpovědným faktorem, rozhodujícím o osudu Židů.“108
Bevor ich näher auf die einzelne Etappen der nun einsetzenden Verfolgung eingehe,
möchte ich mich vorweg der Frage widmen, wieviele Menschen dieser Politik im Protektorat zum Opfer fielen.
Die Zahlen sind widersprüchlich. Am häufigsten wird in der Literatur eine Zahl von
118.310 Juden gemäß den Nürnberger Gesetzen angegeben. Allerdings wurde diese
Zahl erst nachträglich von den Nationalsozialisten konstruiert, denn zum Zeitpunkt des
Einmarschs konnten die Deutschen lediglich auf die Listen der jüdischen Gemeinden
zurückgreifen, die naturgemäß nur auf religiösen Kriterien beruhten, nicht aber diejenigen erfaßten, die aus der Gemeinde ausgetreten waren und dennoch gemäß der nationalNisko, S. 160-173, hier S. 163.
106 Vgl. ROTHKIRCHEN Osud, S. 32f.
107 Vgl. ebenda, S. 34.
108 „Nach dem Erlaß der Verordnung über jüdischen Besitz übernahm in Wirklichkeit der Reichsprotektor de iure die Rechtskraft über die jüdischen Gemeinden. Auch wenn eine Reihe von Neuerungen und Verordnungen, die in den Jahren 1939-1940 erlassen wurden, die Imprimatur der Protektoratsregierung trägt, war die tschechische Regierung nicht mehr verantwortlich für Entschei-
36
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
sozialistischen Rassengesetze als Juden galten. Zu den in den Gemeindelisten erfaßten
103.960109 Personen mosaischen Glaubens wurden rund 15.000 Personen jüdischer
Abstammung nachträglich hinzugezählt, wobei diese Zahl eine Schätzung ist und illegale Flüchtlinge oder Untergetauchte nicht erfaßt.110 Ab März 1940 wurden auch die
Personen nichtjüdischer Konfession verpflichtet, sich bei den jüdischen Kultusgemeinden registrieren zu lassen, wo für sie die Abteilung der sogenannten B-Juden eingerichtet wurde, die bereits ein Jahr später 12.680 Menschen umfaßte.111
3.1. Ausgrenzung aus der Gesellschaft, 1939 bis Herbst 1941
3.1.1. Die Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen und wirtschaftlichen
Leben
Den Grundstein hierfür legte die bereits erwähnte Verordnung vom 21. Juni 1939 über
jüdischen Besitz, die Juden verpflichtete, einen erheblichen Teil ihres Eigentums (Wertgegenstände, Schmuck sowie land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) anzumelden,
ihnen den Erwerb sowie Besitz von Betrieben und Wertpapieren verbot, sofern nicht
eine schriftliche Sondergenehmigung des Reichsprotektors vorlag, und die dementsprechend zu arisierenden, sprich zu enteignenden Betriebe definierte.112 Die Verordnung über die Ausgrenzung der Juden aus dem Wirtschaftsleben vom 12. Februar 1940
konkretisierte die Vorgehensweise des Enteignungsprozesses, soweit dies noch nötig
war, denn zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Vielzahl jüdischer Unternehmen nicht
mehr vorhanden.113
Im April 1940 folgte die Verordnung über die rechtliche Stellung der Juden im
öffentlichen Leben, die Juden von öffentlichen Ämtern grundsätzlich ausschloß, d.h.
jüdische Lehrer, Apotheker, Notare, Redakteure, Künstler usw. erhielten Berufsverbot.
Ferner durften Juden nicht mehr am politischen Leben teilnehmen oder Mitglieder in
dungen, die das Schicksal der Juden betrafen.“ ROTHKIRCHEN Motivy, S. 164.
109 HÁJKOVÁ, ALENA Erfassung der jüdischen Bevölkerung des Protektorats, in: Theresienstädter
Studien und Dokumente 1997, Praha 1997, S. 50- 62, hier S. 53.
110 Kárný geht daher von über 120.000 Personen aus, die nach den Nürnberger Gesetzen im März 1939
als Juden galten. Vgl. KÁRNÝ, MIROSLAV „Konečné řešení“. Genocida českých Židů v německé
protektorátní politice, Praha 1991, S. 172.
111 Vgl. HÁJKOVÁ, S. 54.
112 Vgl. KÁRNÝ, MIROSLAV Die Protektoratsregierung und die Verordnungen des Reichsprotektors über
das Jüdische Vermögen, in: Judaica Bohemiae 29 (1993), S. 54-66, hier S. 54.
113 Vgl. POLÁK, ERICH Perzekuce Židů v protektorátu v letech 1939-1941, in: Akce Nisko, S. 174-182,
hier S. 175f.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
37
Vereinen oder kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Organisationen u.ä. sein.114
Wie auch im Falle der Februar-Verordnung hinkte die offizielle Verabschiedung des
Gesetzes der Realität hinterher, denn bereits in den ersten Wochen und Monaten nach
der Okkupation hatte man mit den Entlassungen im öffentlichen Dienst begonnen,
insbesondere in der Verwaltung sowie bei Gerichten und in Schulen.115
3.1.2. Einschränkungen und Diskriminierungen im privaten Bereich116
Bereits im August 1939 begann die Kampagne zum ,Schutze‘ der nichtjüdischen Bevölkerung vor Kontakten mit Juden, die mit dem Ausschluß von Juden aus bestimmten Restaurants begann und in den folgenden Jahren zunehmend ausgeweitet wurde. Juden
durften nicht mehr ins Kino oder Theater gehen, auf den Bänken an der Moldau sitzen,
keine Badeanstalten besuchen oder Parkanlagen betreten, in der Straßenbahn nur im
letzten Wagen fahren usw. Ferner erhielten sie geringere Lebensmittelzuteilungen, hatten keinen Anspruch auf den Erwerb neuer Kleidung und durften nur zu bestimmten
Zeiten in bestimmten Geschäften einkaufen. ,Luxusgegenstände‘ wie Pelze, Fahrräder,
Nähmaschinen, Musikinstrumente, Skiausrüstungen usw. mußten abgegeben werden.
Arbeitsverhältnisse jüdischer Angestellter durften zum Ersten jedes beliebigen Monats
ohne Rentenanspruch oder Abfindung gekündigt werden. Stattdessen wurden ab 1941
viele Juden zum Arbeitseinsatz verpflichtet, ohne irgendwelche Rechte geltend machen
zu können.
Prager Juden durften ohne Erlaubnis die Stadtgrenze nicht überschreiten, in anderen
Städten galt dies für den Landkreis und später für die Gemeinde.
Bereits im Juli 1939 wurden Juden von deutschen Schulen und Hochschulen ausgeschlossen, im November wurde die tschechische Universität infolge antideutscher Studenten-Demonstrationen geschlossen, und im August 1940 folgte die Verordnung, die
auch den Schulbesuch an tschechischen Schulen für jüdische Kinder verbot. Im Juli
1942 schließlich wurden auch alle jüdischen Schulen geschlossen und jüdischer Privatunterricht verboten.
114 Lediglich Anwälte und Ärzte durften weiter praktizieren, solange sie eine rein jüdische Klientel hatten, allerdings durfte ihre Anzahl nicht mehr als 2 Prozent aller im Protektorat zugelassenen Anwälte und Ärzte betragen. Vgl. LEXA, JOHN G. Anti-Jewish Laws and Regulations in the Protectorate of Bohemia and Moravia, in: The Jews of Czechoslovakia, Vol.III. Philadelphia / New York,
1984, S. 75-103, hier S. 84.
115 Vgl. ebenda, S. 84.
116 Zu den folgenden Ausführungen vgl. POLÁK, S. 178-180, sowie LEXA, S. 76-87.
38
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Im März 1940 wurden alle Protektoratsjuden vepflichtet, ein J in ihre Personalausweise eintragen zu lassen. Seit dem 19. September 1941 mußten sie in der
Öffentlichkeit einen gelben Stern mit der Aufschrift Jude tragen.
3.1.3. Auswanderung
Am 15. Juli 1939 wurde in Prag die Zentralstelle für jüdische Auswanderung eingerichtet, die ab September 1939 dem Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Berlin
unterstand und zum Zentrum der nationalsozialistischen Judenpolitik im Protektorat
wurde. Die Zentralstelle organisierte sowohl Auswanderung im eigentlichen Sinn des
Wortes,117 aber auch im Sinne von Deportationen in ein unwirtliches Siedlungsgebiet.
Ferner unterstützte sie von der Jüdischen Gemeinde oder vom Palästina-Amt in Prag
organisierte
Umschulungskurse,
in
denen
junge
Leute
handwerkliche
und
landwirtschaftliche Berufe erlernen sollten, die ihnen in der Emigration nützlich sein
würden.118
Tatsächlich konnten nach dem 15. März 1939 noch 26.111 Menschen, die nach den
Nürnberger Gesetzen als Juden galten, aus dem Protektorat emigrieren.119 Allerdings
wurde die Ausreise zunehmend erschwert, da immer weniger Länder bereit waren,
Flüchtlinge aufzunehmen, und nach Ausbruch des Krieges die Verkehrswege zu Lande
und zu Wasser immer unsicherer wurden. Zu diesen äußeren Hindernissen kamen auch
häufig persönliche Gründe, die die Emigration vereitelten, da viele ihre Eltern, Ehepartner, Kinder nicht zurücklassen wollten.
Im Oktober 1939 kam es allerdings auch zu ersten Deportationen. Aus Ostrava und
Frýdek gingen Transporte mit insgesamt 1.291 Männern nach Nisko im sogenannten
Generalgouvernement. Das Lager wurde jedoch im April 1940 wieder aufgelöst, und
117 Dabei wurde den Ausreisewilligen eine sehr hohe Fluchtsteuer auferlegt, die nach ihrem Gesamtvermögen bemessen wurde: „Die aus der Juni-Verordnung hervorgehende Pflicht, den wesentlichen
Teil des Vermögens zu melden, brachte der Zentralstelle genügend Unterlagen einer Bemessung
einer derartig hohen Taxe für die Ausreise, daß dadurch die freiwilligen sowie die zwangsmäßigen
Emigranten maximal expropriiert wurden.“ MILOTOVÁ, JAROSLAVA Die Zentralstelle für jüdische
Auswanderung in Prag, in: Theresienstädter Studien und Dokumente 1997, Prag 1997, S. 7-30, hier
S. 21. Ab November 1939 wurde diese Steuer auf 25 Prozent des Gesamtvermögens festgesetzt.
Vgl. ebenda.
118 Im Herbst 1940 wurde in Česká Lípa ein sogenanntes ,Umschulungslager‘ eingerichtet. Anfangs
waren die Lebensbedingungen dort relativ erträglich, doch verschlechterten sie sich zunehmend, so
daß sich das ,Umschulungslager‘ letztlich kaum mehr von einem KZ unterschied. Vgl. ROTHKIRCHEN, LIVIA The Jews of Bohemia and Moravia: 1938-1945, in: The Jews of Czechoslovakia
Vol.III., S. 3-74, hier S. 41.
119 Vgl. SCHMIDT-HARTMANN, S. 358.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
39
die überlebenden Insassen (aus Mähren nur noch 460 Menschen) durften nach Hause
zurückkehren.120 Unter anderem wird das Scheitern dieses ersten Versuches, mitteleuropäische Juden nach Polen zu deportieren, darauf zurückgeführt, daß der
Gouverneur Polens, Hans Frank, das Generalgouvernement so schnell wie möglich
,judenrein‘ haben wollte und daher gegen die Transporte aus dem Westen
protestierte.121
Seit Oktober 1941 wurde die Auswanderung in ihrer eigentlichen Bedeutung eingestellt, stattdessen widmete sich die Zentralstelle von nun an der Durchführung der ,Endlösung‘, und entsprechend wurde sie am 12. August 1942 in Zentralamt für die Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren umbenannt.
3.2. Deportation und Vernichtung
Bereits seit Sommer 1941 war die physische Ausrottung der Juden im vollen Gange.
Seit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 verübten die Einsatzgruppen
der Sicherheitsspolizei und des SD hinter der ost- und nordwärts vorrückenden Wehrmacht Massaker an der jüdischen Bevölkerung.122 Am 31. Juli beauftragte Göring
RSHA-Chef Heydrich, einen Entwurf zur „Endlösung der Judenfrage“ auszuarbeiten.123
Im Oktober 1941 setzten bereits die ersten Transporte aus Deutschland, Österreich und
dem Protektorat ins Generalgouvernement und ins eroberte sowjetische Territorium ein,
wo die Juden vor ihrer endgültigen Vernichtung ,konzentriert‘ wurden.124 Auf der
Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, wo „mit der Endlösung der Judenfrage zusammenhängende Fragen“125 besprochen werden sollten, wurden alle versammelten Ministerialbeamten und Funktionäre der NSDAP von Heydrich darüber in Kenntnis gesetzt,
daß nun an die Stelle der Auswanderung eine neue ,Lösungsmöglichkeit‘ getreten sei,
120 Vgl. ebenda, S. 360. Vgl. außerdem hierzu den Konferenzband Akce Nisko.
121 Vgl. ZÁMEČNÍK, STANISLAV Der Fall Nisko im Rahmen der Entstehungsgeschichte „der Endlösung
der Judenfrage“, in: Akce Nisko, S. 92-99, hier S. 96, sowie KULKA, ERICH The Annihilation of
Czechoslovak Jewry, in: The Jews of Czechoslovakia, Vol.III, S. 262-328, hier S. 267. Im Anschluß
an die gescheiterte Nisko-Aktion konzentrierte man sich im Reich erneut auf das Madagaskar-Projekt, was besonders nach der Niederlage Frankreichs Aufwind bekam. Vgl. ZÁMEČNÍK, S. 96.
122 Vgl. BENZ, WOLFGANG Endlösung – zur Geschichte des Begriffs, in: Akce Nisko, S. 62-77, hier
S. 64.
123 Vgl. WITTE, PETER Deportationen ins Ghetto Litzmannstadt und Vernichtung in Chelmno – Zwei
Etappen des Entscheidungsprozesses in der „Endlösung der Judenfrage“, in: Akce Nisko, S. 148159, hier S. 150.
124 Vgl. PÄTZOLD, KURT „Die vorbereitenden Arbeiten sind eingeleitet.“ Zum 50. Jahrestag der Wannseekonferenz, in: Theresienstadt in der „Endlösung der Judenfrage“, hrsg. von Kárný, M. / Kárná,
M. / Blodig, V., Prag 1992, S. 51-62, S. 54.
40
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
nämlich die „Evakuierung der Juden nach dem Osten“,126 wobei er nun keinen Hehl
mehr daraus machte, daß die „Evakuierung“ die physische Vernichtung des gesamten
europäischen Judentums zum Ziel hatte:
„Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter
Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung
der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt,
wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig
endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesen zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufstandes
anzusprechen ist.“127
Somit waren die Absichten des NS-Regimes, die sich hinter dem Begriff „Endlösung“
verbargen, endgültig offengelegt.
Heydrich hatte bereits am 27.9.1941 das Amt des Reichsprotektors übernommen und
unmittelbar darauf erste Schritte zur Vernichtung der Protektorats-Juden eingeleitet. Am
1. Oktober 1941 ordnete die Zentralstelle eine erneute Registrierung aller Juden durch
die jüdischen Gemeinden an, der zufolge 88.105 Personen jüdischer Herkunft ermittelt
wurden.128 Ein paar Tage später fand in Prag eine Besprechung über die zur „Lösung
der jüdischen Frage“ zu ergreifenden Maßnahmen in Beisein von Eichmann und
Günther, dem Leiter der Prager Zentralstelle, statt. Man beschloß zum einen die
Deportation von 5.000 Juden nach Polen, zum anderen, da „noch viel Rücksicht auf die
Litzmannstädter [Lodscher] Behörden genommen werden“129 mußte, die Ghettoisierung
im Protektorat, wobei hierfür die alte Hussitenburg Alt-Ratibor oder Theresienstadt im
Gespräch war. Am 17. Oktober fand eine weitere Konferenz statt, auf der die
Entscheidung für die Errichtung eines Sammellagers in Theresienstadt fiel. An dem
ursprünglichen Beschluß, 5.000 Juden direkt nach Lodz zu ,evakuieren‘, wurde
festgehalten. Ein Transport mit 1.000 Prager Juden hatte bereits am Vortag die Stadt
125 Ebenda.
126 Ebenda.
127 Besprechungsprotokoll der Wannseekonferenz, in: PÄTZOLD, K. / SCHWARZ, E. Tagesordnung: Judenmord. Die Wannseekonferenz am 20. Januar 1942. Eine Dokumentation zur Organisation der
„Endlösung“, Berlin 1992, S. 102-112, S. 105ff.
128 Vgl. HÁJKOVÁ, S. 54.
129 Notizen aus der Besprechung am 10.10.41 über die Lösung der Judenfragen, veröffentlicht in:
ADLER, H.G. Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft, Tübingen 1955,
720ff.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
41
verlassen, ihm folgten bis zum 3. November vier weitere mit je 1.000 Menschen sowie
am 16. November 1.000 Personen aus Brünn mit dem Bestimmungsziel Minsk. Die
Deportation aus Brünn überlebten nur 13 Menschen. Von den Prager Transporten
kehrten 276 Menschen zurück.130
Mit Ausnahme eines ,Straftransports‘ anläßlich des Heydrich-Attentats, der noch einmal 1.000 Menschen direkt nach Osten, in diesem Fall nach Majdanek bzw. Ujazdow
verschleppte, gingen seit Ende November 1941 alle weiteren Transporte im Protektorat
zunächst nach Theresienstadt. Die Funktion Theresienstadts als Durchgangslager wurde
auf der Wannsee-Konferenz um eine weitere Komponente erweitert: Es sollte offiziell
als Ghetto für die alten und ,privilegierten‘ deutschen Juden gelten, um öffentlichem
Aufsehen angesichts der Massendeportationen entgegenzuwirken.131 Erst im weiteren
Kriegsverlauf wurde die Möglichkeit der Nutzung Theresienstadts zu Propagandazwekken hinsichtlich des beunruhigten Auslands entdeckt, worauf weiter unten noch näher
eingegangen wird.
Aus dem Protektorat wurden im Zeitraum von November 1941 bis Frühjahr 1945 insgesamt 73.468 Menschen ,jüdischer Abstammung‘ nach Theresienstadt deportiert.
6.152 Juden kamen dort ums Leben, und nur 6.875 erlebten die Befreiung des Lagers,
wobei über die Hälfte dieser Überlebenden Juden aus ,Mischehen‘ waren, die erst 1945
nach Theresienstadt gekommen waren. 60.382 Personen wurden weiter in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten geschickt, von denen lediglich 3.097
zurückkehrten.132
Die Zusammensetzung der Transporte bestimmte die SS selbst, indem sie eine bestimmte Anzahl an Karteikarten133 – die die Jüdischen Gemeinden seit Oktober 1941
zur Registrierung ihrer Mitglieder anzulegen gezwungen waren – auswählte und sie der
jüdischen Gemeinde übergab. Diese überstellte dann eine Vorladung an die jeweils betroffenen Personen, die sich daraufhin zu einem bestimmten Datum an einem vorgegebenen Sammelplatz einfinden mußten (in Prag diente hierzu das Messegelände, in anderen Ortschaften meist Turnhallen oder Schulen). Dort verblieben sie drei Tage, während
130 Vgl. Terezínská pamětní kniha. Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945,
Díl.I.,hrsg. von Miroslav Kárný, Praha 1995, S. 54.
131 Vgl. SCHMIDT-HARTMANN, S. 363.
132 Vgl. ebenda. Insgesamt wurden etwa 141.000 Menschen aus Europa nach Theresienstadt verschleppt, von denen lediglich 23.000 Menschen den Krieg überlebten. 33.500 Menschen starben in
Theresienstadt selbst, von den ca. 88.000 Weiterverschickten kehrten nur 3.500 zurück. Vgl. ADLER, S. 59.
133 Sie suchte immer 200 bis 300 Karteikarten mehr als Reserve wegen ev. kranker oder geschützter
Personen aus, vgl. HÁJKOVÁ, S. 54.
42
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
derer sie eine ,Vermögenserklärung‘, d.h. Rechenschaft über ihren zurückgelassenen
Besitz ablegen mußten und gezwungen wurden, alle Wertsachen, Bargeld, Wohnungsschlüssel, Lebensmittelkarten usw. abzugeben. Dann wurden sie unter SS- und Polizeiaufgebot zum Bahnhof eskortiert und mit dem Zug nach Bohušovice gebracht, von wo
sie den letzten Rest nach Theresienstadt zu Fuß zurücklegen mußten.134
Der erste Transport nach Theresienstadt verließ Prag am 24. November 1941 mit 350
jungen Männern, die als sogenanntes Aufbaukommando AK I, (wenige Tage später folgte AK II) das Ghetto einrichten sollten. Allerdings kamen binnen kürzester Zeit
weitere Transporte an, so daß nichts vorbereitet war.135
Männer und Frauen wurden getrennt untergebracht. Da anfangs noch Zivilbevölkerung in der Stadt anwesend war, durften die Kasernen außer zur Arbeit nicht
verlassen werden. Erst am 21. Juni 1942 wurde das Ghetto ,geöffnet‘, so daß sich die
Insassen nach der Arbeit bis zur Ausgangssperre frei bewegen konnten.136
Das zentrale Problem im Lageralltag war die unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln. Wer von den offiziellen Rationen abhängig war, die im Lager ausgegeben wurden, wie die alten deutschen und österreichischen Juden, die nicht mehr arbeiten
konnten und auch keine Verwandten im Ghetto hatten, die ihnen geholfen hätten, litt
großen Hunger, was langfristig den Tod bedeutete. Zusätzliche Lebensmittel wurden
über Tauschhandel erworben, beispielsweise gegen mitgebrachte Wertsachen. Manche
erhielten Päckchen von Verwandten oder Bekannten, andere, die außerhalb des Ghettos
arbeiteten, ,schleusten‘ verschiedene Güter, beispielsweise die in der Landwirtschaft
Beschäftigten Obst und Gemüse, ins Ghetto.137 Selbstverständlich waren all diese
Aktionen mit einem hohen Risiko verbunden. Flog der Schmuggel auf, drohte einem
Haft in der ,Kleinen Festung‘, dem Gestapogefängnis, oder die Verschickung nach
,Osten‘.
Nichts wurde in Theresienstadt mehr gefürchtet als die Ausrufung von Osttransporten, die das Lager vom 9. Januar 1942 bis zum 28. Oktober 1944 verließen, auch
wenn im Ghetto niemand so genau wußte, was den Menschen im ,Osten‘ bevorstand.
Die SS legte für jeden Transport die Personenzahl und bestimmte Alters- oder Nationengruppen fest. Der jüdische Ältestenrat – die ,jüdische Selbstverwaltung‘ des
134 Vgl. ROTHKIRCHEN Osud, S. 42.
135 Vgl. LEDERER, ZDENěK Terezín, in: The Jews of Czechoslovakia, Vol.III., S. 104-164, hier S. 110,
sowie ADLER, S. 75ff.
136 Vgl. ADLER, S. 104f.
137 Vgl. ebenda, S. 364ff. sowie LEDERER, S. 120f.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
43
Ghettos – stellte dann aus Karteikarten die Transportlisten zusammen. Es gab
bestimmte Personengruppen, die vor den Transporten geschützt waren, wie die
Angehörigen des Ältestenrats, Invaliden und Würdenträger aus dem 1. Weltkrieg und
die für die Kriegsindustrie wichtigen Berufszweige. Meist brachte dieses Privileg nur
einen Aufschub, nicht aber die endgültige Rettung vor der Deportation.
Der ersten Transportwelle zwischen dem 9. Januar und dem 13. Juni 1942 fielen
16.001 Protektoratsangehörige zum Opfer, von denen nur 175 Menschen die Befreiung
erlebten.138
Die nächste Transportreihe verließ das Lager zwischen dem 14. Juli und dem 26. Oktober 1942 mit 27.890 Ghettoinsassen, zurück kamen von ihnen nur 85.139
Ab diesem Zeitpunkt gingen alle Transporte aus Theresienstadt nur noch nach
Auschwitz.140 In einer ersten Serie wurden bis Februar 1943 8.867 Menschen deportiert
und die Mehrheit direkt vergast. Nur 124 erlebten die Befreiung.141
Darauf folgte eine siebenmonatige Transportpause. Unter verstärktem ausländischen
Druck sowie der veränderten militärischen Situation nach der Niederlage bei Stalingrad
nahm die Idee, Theresienstadt zu Propagandazwecken (,Der Führer schenkt den Juden
eine Stadt‘) zu nutzen, allmählich Gestalt an. Daher begann man in diesen sieben Monaten mit der Vorbereitung der ,Stadtverschönerung‘. Ende Juni wurde die Besichtigung
des Lagers durch Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes zugelassen, und bei der Gelegenheit stellte Eichmann erstmals die Erlaubnis zu einem Besuch des Internationalen
Roten Kreuzes in Aussicht.142
Mit der fortschreitenden Verschönerungsinitiative fand allerdings die Transportpause
im September 1943 ein rasches Ende. Angesichts der drastischen Überfüllung des
138 Die ersten beiden Transporte gingen nach Riga, die anderen bis auf einen, der im Warschauer
Ghetto endete, in den Bezirk Lublin, wo die Deportierten auf die dortigen Ghettos und
Konzentrationslager verteilt wurden. Nur etwa 6.000 Männer wurden zur Zwangsarbeit herausgesucht, ihre nicht ,arbeitsfähigen‘ Familienangehörigen wurden entweder in Vernichtungslager
weiterdeportiert oder starben an Unterernährung und Erschöpfung, ein Schicksal, das auch die
meisten ,Arbeitsfähigen‘ dank des Systems ,Vernichtung durch Arbeit‘ in Kürze ereilte. Vgl.
Terezínská pamětní kniha, S. 35.
139 Diesmal wurden die Deportierten nämlich bis auf ein paar wenige Ausnahmen sofort an ihren
Bestimmungsorten ermordet, sei es in der Umgebung von Minsk durch Massenerschießungen oder
Gaswagen oder in den Gaskammern Treblinkas. Vgl. ebenda sowie ADLER, S. 52.
140 Mit Ausnahme von vier kleinen Transporten nach Bergen-Belsen 1944.
141 Vgl. ADLER, S. 53f.
142 Vgl. KÁRNÝ, MIROSLAV Terezínský rodinný tábor v „konečném řešení“, in: Terezínský rodinný
tábor v Osvětimi-Birkenau, Sborník z mezinárodní konference, Praha 7.-8.3. 1994, hrsg. v. Kárný,
M. / Kárná, M. / Brod, T., Praha 1994, S. 35-49, hier S. 37.
44
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Ghettos143 wurde die Deportation von 5.000 Personen beschlossen, um das Stadtbild zu
,verbessern‘. Außerdem wollte man nach der Erfahrung des Aufstands im Warschauer
Ghetto eventuelles Widerstandspotential im Ghetto schwächen.
Der geplante Transport sollte noch einen weiteren Zweck erfüllen: Mit der Errichtung
eines tschechischen Familienlagers in einem Auschwitzer Nebenlager, in Birkenau
BIIb, sollte ein weiteres Propagandainstrument geschaffen werden, das bei Bedarf dem
Ausland vorgeführt werden könnte.144
Der erste Transport mit 5.000 Menschen erreichte das Familienlager am 8. September
1943, weitere 5.000 folgten im Dezember 1943. Die Besonderheit dieses Lagers bestand
vor allem darin, daß man die Häftlinge dort keiner Selektion unterzog und sie tatsächlich noch ein halbes Jahr zusammen ließ. Außerdem durften sie ihre persönliche Habe
und Kleidung behalten, wurden nicht kahlgeschoren und erhielten die Erlaubnis, Päckchen zu empfangen. Die SS verteilte in regelmäßigen Abständen Postkarten, die sie mit
dem Absender „Arbeitslager Birkenau bei Neu-Berun“ an ihre Angehörigen in Theresienstadt schicken durften, um dort die Ängste über das Schicksal der Osttransporte zu
zerstreuen.145
Im März 1944 wurde in BIIb ein angeblicher Arbeitstransport zum Aufbau eines neuen Familienlagers in „Heydebreck“ angekündigt, in den alle noch lebenden Personen
aus dem Septembertransport, insgesamt 3.792 Menschen, eingereiht wurden. Am 8.
März, auf den Tag genau sechs Monate nach ihrer Ankunft, brachte man sie stattdessen
auf geschlossenen Lastwagen zu den Krematorien II und III, wo sie in der folgenden
Nacht vergast wurden.146
In Theresienstadt liefen inzwischen die Vorbereitungen der Verschönerungsaktion
auf Hochtouren. Seit der Ankunft von dänischen Juden im Herbst 1943 drängte auch
das Dänische Rote Kreuz verstärkt auf eine Besichtigung. Um eine ,erträgliche‘ Anzahl
von Ghettoinsassen zu erzielen, wurden im Mai noch einmal drei Transporte mit
insgesamt 7.500 Menschen i ns Familienlager geschickt, 27.000 Gefangene blieben im
Ghetto zurück. Etwa zu diesem Zeitpunkt gab Himmler seine Einwilligung zur
143 Im Juli überschritt die Anzahl der Insassen 46.000, während gleichzeitig die Unterbringungskapazitäten reduziert wurden, da das RSHA-Archiv wegen der zunehmenden Bombenangriffe auf
Berlin nach Theresienstadt verlegt worden war. Vgl. ebenda, S. 37.
144 Vgl. ebenda, S. 37f.
145 Näheres zum Familienlager siehe Konferenzband Terezínský rodinný tábor.
146 Vorher hatte man sie noch einmal Postkarten schreiben lassen, die auf den 25. März datiert wurden,
so daß ihre Angehörigen noch ein Lebenszeichen von ihnen erhielten, als sie schon längst tot waren.
Außerdem verteilte man Reiseproviant, um die Todeskandidaten in Sicherheit zu wiegen und
eventuelle Widerstandsversuche zu vermeiden. Vgl. KÁRNÝ Terezínský rodinný tábor, S. 39.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
45
Besichtigung Theresienstadts durch das Internationale Rote Kreuz und stellte auch den
Besuch eines Arbeitslagers im Osten in Aussicht. Am 23. Juni 1944 wurden ein
Delegierter des Internationalen sowie zwei Vertreter des Dänischen Roten Kreuzes im
Ghetto empfangen. Das Täuschungsmanöver der SS zeitigte vollen Erfolg. Sie bekam
vom Roten Kreuz ein „ausgezeichnetes Zeugnis“147, und die Besichtigung eines
Arbeitslagers wurde gar nicht weiter thematisiert.148
Im Juli wurde daher das Familienlager in Birkenau aufgelöst. Aufgrund der veränderten militärischen Situation wurden nicht alle 10.000 Insassen ins Gas geschickt, sondern
3.500 Männer und Frauen im ,arbeitsfähigen‘ Alter zur Zwangsarbeit nach Deutschland
verschleppt. Bereits im April hatte Hitler nämlich die Devise, deutsche Konzentrationslager ,judenrein‘ zu halten, verworfen, um zum Aufbau von Flugzeugfabriken im
Rahmen des „Jäger-Programms“ auf jüdische Arbeitskraft zurückzugreifen.149 Die in
Birkenau Zurückgebliebenen wurden am 11. und 12. Juli 1944 nachts in den Gaskammern ermordet. Die Zwangsarbeit überlebten nur 1.167 Menschen.150
In Theresienstadt hatte man im Anschluß an den Besuch des Roten Kreuzes inzwischen mit den Dreharbeiten zu einem Propagandafilm begonnen. Während dieser Zeit
verließen keine weiteren Transporte das Ghetto. Aber kaum war der Film beendet, wurde die Einberufung von 5.000 Männern zum „Arbeitseinsatz ins Reichsgebiet“
angekündigt; am 28. und 29. September 1944 wurden sie in drei Transporten
abtransportiert.151 Statt ins Reich fuhren sie direkt nach Auschwitz. Damit begann eine
letzte große Deportationswelle, der bis zum 28. Oktober 1944 zwei Drittel aller
Ghettoinsassen, insgesamt 18.402 Menschen zu Opfer fielen. Die meisten von ihnen
endeten in den Gaskammern, die wenigen ,Arbeitsfähigen‘, etwa 5.500 Personen152,
wurden binnen zwei Wochen nach Deutschland zur Zwangsarbeit geschickt. Die
Befreiung erlebten lediglich 1574 Menschen.153
147 „vynikající vysvědčení“, ebenda, S. 43.
148 Vgl. ebenda, S. 43.
149 Vgl. ebenda, S. 45 sowie KÁRNY, MIROSLAV Die Theresienstädter Herbsttransporte 1944, in: Theresienstädter Studien und Dokumente 1995, Prag 1995, S. 7-31, hier S. 27. Die Männertransporte aus
dem Familenlager gingen nach Schwarzheide und Blechhammer, die Frauen wurden u.a. nach
Christianstadt, Stutthof und Neuengamme deportiert.
150 Vgl. KÁRNÝ, MIROSLAV Kalendárium terezínského rodinného tábora v Birkenau (1943-1944), in:
Terezínský rodinný tábor, S-190-198, hier S. 197.
151 Im dritten Transport waren auch 500 Frauen, denen versprochen worden war, ihren Männern ins
neue Arbeitslager folgen zu dürfen und die sich daher freiwillig gemeldet hatten. Vgl. KÁRNÝ
Herbsttransporte, S. 16.
152 Vgl. KULKA, S. 302.
153 Vgl. KÁRNÝ Herbsttransporte, S. 21.
46
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Während die ersten drei Transporte einerseits das Widerstandspotential im Lager angesichts der Befürchtung eines allgemeinen tschechischen Aufstands schwächen und
andererseits Arbeitskräfte für die deutsche Kriegswirtschaft requiriren sollten,154 waren
die weiteren Transporte vorrangig dazu bestimmt, noch möglichst viele Juden zu vernichten, bevor die Todesmaschinerie zum Stillstand käme.155
Tatsächlich blieben im Ghetto nur mehr 11.077 Menschen zurück.156 Unter der SS
herrschte Uneinigkeit, ob die restlichen Insassen nun vor Ort liquidiert oder Theresienstadt weiterhin zu Propagandazwecken genutzt werden solle. Vorerst wurde das Lagerleben reorganisiert, und beide Optionen blieben offen.
Diese letzte Phase des Ghettos ist daher charakterisiert durch das sich abzeichnende
Kriegsende, dessen Vorboten die Freilassungen von Häftlingen 1945157 und die weitere
Besichtigung durch das Rote Kreuz im April 1945158 waren, andererseits aber durch die
unter den Insassen vorherrschende Angst vor einem bevorstehenden Massenmord, die
gesteigert wurde durch die Berichte neu angekommener slowakischer Juden über die
Massenvernichtungen im Osten und den Bau von zwei potentiellen Vernichtungsstätten
im Februar 1945.159
Den größten Schock lösten die seit dem 20. April eintreffenden Evakuierungstransporte aus, die über 13.000 Menschen in erbärmlichstem Zustand ins Ghetto brachten. Unter ihnen waren auch ehemalige Theresienstädter, von denen die Häftlinge nun
erstmals im vollen Umfang die schreckliche Wahrheit über die ,Osttransporte‘ erfuhren.
Die Neuankömmlinge schleppten eine Typhusepidemie ein, der in den letzten Kriegswochen und auch noch nach der Befreiung sehr viele Menschen zu Opfer fielen.
Am 5. Mai verließ die SS das Lager, das daraufhin dem Schutz des Roten Kreuzes
unterstellt wurde. Am 8. Mai wurde es endgültig von sowjetischen Truppen befreit,
154 Vgl. ebenda, S. 19.
155 „Der letzte Transport aus Theresienstadt war der letzte aller Transporte, die sofort nach der Ankunft
in Auschwitz in Arbeitsfähige und ,unnütze Esser‘ geteilt wurden [...]. Der vier Tage später
angekommene jüdische Transport aus Sered wurde bereits ohne Selektion in das Lager übernommen.“ KÁRNÝ Herbsttransporte, S. 21.
156 Vgl. ebenda.
157 Am 5. Februar wurden 1.200 Ghettoinsassen nach Verhandlungen zwischen Himmler und dem ehemaligen Schweizer Präsidenten Jean Marie Musy im Februar in die Schweiz entlassen, im April
folgte die Freilassung der dänischen Juden, die nach Schweden gebracht wurden. Vgl. hierzu BLODIG, VOJTěCH Die letzte Phase der Entwicklung des Ghettos in Theresienstadt, in: Theresienstadt in
der „Endlösung der Judenfrage“, S. 267-278, hier S. 272/275.
158 Vgl. ebenda, S. 273f.
159 Eines der beiden Objekte nämlich, das sogenannte „Gemüselager“ sollte mit einer luftdichten Tür
versehen werden, was den Verdacht nahelegte, daß es als Gaskammer dienen sollte. Der „Ententeich“ war ein von einer hohen Mauer umgebener Bereich, der als Erschießungsstätte geeignet
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
47
stand aber wegen des Typhus noch einige Wochen unter Quarantäne.160
4. Neubeginn nach 1945
14.045 Menschen hatten den Genozid an der jüdischen Protektoratsbevölkerung überlebt.161 2.803 Juden162 hatten den Krieg ohne Deportation überdauert, die übrigen kehrten aus den Gefängnissen, Konzentrationslagern, ihren Verstecken oder in den Reihen
der tschechoslowakischen Befreiungsarmee zurück. Nun begann das Warten auf die
vermißten Angehörigen, die Suche nach Lebenszeichen von Ehepartnern und Freunden.
Und erst jetzt, als sich endgültig abzeichnete, daß die meisten von ihnen nicht wiederkommen würden, wurde den Überlebenden schonungslos das ganze Ausmaß dessen bewußt, was sich in den vergangenen Jahren ereignet hatte. 77.297 Namen erinnern heute
in der Pinkas-Synagoge in Prag an ihre ermordeten Familien.163
Nicht nur, daß ihr gesamtes soziales Umfeld nicht mehr existierte, auch in materieller
Hinsicht standen die Überlebenden vor dem Nichts. Sie setzten daher große Hoffnungen
auf eine Restitution ihres enteigneten Besitzes, die sich aber in den wenigsten Fällen erfüllten. Von tschechischer Seite schlug ihnen oft wenig Mitgefühl, wenn nicht sogar
Feindseligkeit entgegen, wenn sie ihre Wohnung, ihren versteckten Schmuck oder anderes Eigentum zurückforderten.164
Es gab zwar ein Restitutionsgesetz (Mai 1946), aber es wurde nur sehr zögerlich um-
schien. Vgl. BLODIG, S. 272f. sowie KÁRNÝ Herbsttransporte, S. 30.
160 Vgl. SCHMIDT-HARTMANN, S. 367.
161 Vgl. KREJČOVÁ, HELENA Český a slovenský antisemitismus 1945-1948, in: Stránkami soudobých
dějin. Sborník statí k pětašedesátinám Karla Kaplana, Praha 1993, S. 158-172, hier S. 159. Im
westlichen Teil der Tschechoslowakei befanden sich laut Meyer nach Kriegsende 24.001
Überlebende, darunter 8.500 Flüchtlinge aus der Karpathoukraine und rund 1.000 Rückkehrer aus
dem Exil. Vgl. MEYER, PETER Jews in the Soviet Satellites, Syracuse 1953, S. 66f.
162 Vgl. SCHMIDT-HARTMANN, S. 367.
163 Vgl. ebenda, S. 368. Die Zahlen für die Überlebenden bzw. die Opfer bewegen sich für erstere
zwischen 14-15.000, für letztere zwischen 77-78.000, die Zahl der Emigranten wird relativ konstant
mit 26.000 angegeben. Vgl. hierzu KÁRNÝ, MIROSLAV Die tschechoslowakischen Opfer der
deutschen Okkupation, in: Brandes, Detlef / Kural, Václav (Hg.): Der Weg in die Katastrophe, Essen 1994, S. 151-160, sowie SKORPIL, PAVEL Probleme bei der Berechnung der Zahl der tschechoslowakischen Todesopfer des nationalsozialistischen Deutschland, ebenda, S. 161-164.
164 „,Proč já mám tu smůlu, že zrovna můj žid to přežil, že musím vracet koberec, na který jsem si za tu
dobu zvykl, a tomu se jeho žid nevrátil a všechno mu zůstalo. Vždyt je to vlastně vina právě toho
žida, že se vrátil.‘“ „Warum habe ich das Pech, daß ausgerechnet mein Jude überlebt hat, daß ich
den Teppich zurückgeben muß, an den ich mich inzwischen so gewöhnt habe, und der Jude von dem
da ist nicht zurückgekommen, und er konnte alles behalten. Das ist doch eigentlich die Schuld des
Juden, daß er zurückgekommen ist.“ So charakterisiert Krejčová die Situation in: KREJČOVÁ, Český
a slovenský antisemitismus, S. 159f.
48
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
gesetzt und schloß zudem alle Juden aus, die als „national unzuverlässig“ galten.165
Nach internationalen Protesten wurde die Restitutionsfrage im Herbst 1946 neu geregelt, dennoch kam es im Zusammenhang mit der Rückgabe von jüdischem Eigentum
immer wieder zu antisemitischen Zwischenfällen.166
Außerdem wurde in den ersten Nachkriegsjahren eine Reihe von jüdischen Friedhöfen und Synagogen geschändet, die Beteiligung von Juden in Armee und Widerstand
wurde in Zweifel gezogen und marginalisiert.167
Unter den jüdischen Überlebenden waren nach 1945 drei Tendenzen vorherrschend.
Die einen waren durch ihre Erfahrungen zu der Überzeugung gelangt, daß eine Assimilation unmöglich war, und sahen daher in Zionismus und Emigration die einzige zukunftsträchtige Perspektive. Andere wiederum suchten die Lösung gerade in völliger
Assimilation, die sich beispielsweise in den zahlreichen Namensänderungen widerspiegelt. Und einige wurden begeisterte Anhänger des Kommunismus, da sie in der
Ideologie der Gleichheit aller Menschen die Garantie sahen, ein Phänomen wie den
Nationalsozialismus nie wieder Wirklichkeit werden zu lassen.
5. Nach der kommunistischen Machtübernahme 1948
Eine große Emigrationswelle setzte nach der kommunistischen Machtübernahme bzw.
der israelischen Staatsgründung ein und gipfelte in einem wahren ,Exodus‘ 1949.168 Die
jüdischen Gemeinden wurden gleichgeschaltet. Die Religionsausübung war zwar nach
wie vor möglich, aber nur in dem Bewußtsein, daß man sich dadurch exponierte und
165 Juden, die sich im Zensus von 1930 zur deutschen Nationalität bekannt hatten, erfuhren dieselbe
Behandlung wie die übrigen Deutschen, es sei denn, sie konnten den Beweis erbringen, niemals
gegen die Nation gehandelt zu haben und zudem Opfer des Nationalsozialismus oder aktiver
Teilnehmer am Befreiungskampf gewesen zu sein. Häufigster Vorwurf für „nationale
Unzuverlässigkeit“ war die sogenannte „Germanisierung“, deren man sich, je nach Auslegung,
bereits durch die Verwendung der deutschen Umgangssprache, des Besuchs deutscher Schulen,
Theater u.ä. verdächtig machte. Aufgrund dieses Vorwurfs wurde auch Juden, die sich zur
tschechischen oder jüdischen Nationalität bekannt hatten, wiederholt ihr Eigentum vorenthalten.
Vgl. hierzu MEYER, S. 83f.
166 Das größte Aufsehen erregte der Fall Beer in Varnsdorf, der dort seine Fabrik zurückbekam,
woraufhin er am folgenden Tag angegriffen und in ,Schutzhaft‘ genommen wurde. Kommunisten
und Gewerkschaften riefen öffentlich zum Steik auf und stellten Beer, der sich 1930 zur jüdischen
Nationalität bekannt und in der Emigration für den tschechischen Widerstand gearbeitet hatte, als
„Germanisierer“ an den Pranger. Vgl. MEYER, S. 84f. sowie KREJČOVÁ Český a slovenský antisemitismus, S. 160f.
167 Vgl. KREJČOVÁ Český a slovenský antisemitismus, S. 164ff.
168 Laut Brod emigrierten bis 1950 fast 50 Prozent aller tschechoslowakischen Juden nach Israel. Vgl.
BROD, PETER Židé v poválečném Československu, in: Židé v novodobých dějinách, Praha 1997,
S. 147-162, hier S. 151.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
49
Diskriminierungen im Berufsleben ausgesetzt wurde.169 Hierbei handelte es sich weniger um Antisemitismus denn um eine generelle Religionsfeindlichkeit, die auch gläubige Christen im kommunistischen Regime zu spüren bekamen. Die antizionistische
Kampagne jedoch, die Anfang der fünfziger Jahre im Zusammenhang mit dem SlánskýProzeß170 zu großen Säuberungen in der kommunistischen Partei und der Arbeitswelt
führte, war vorrangig gegen jüdische Bürger gerichtet. Etwa 1000 Menschen ,jüdischer
Herkunft‘ fielen dieser Säuberungswelle zu Opfer.171
Die antisemitische Atmosphäre im Land verstärkte die Tendenz zur völligen Assimilation. Nur noch alte Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten, besuchten Gottesdienste, und in vielen Familien wurde die jüdische Herkunft sogar vor den Kindern verheimlicht.172
Ende der fünfziger Jahre bis 1967 bzw. 1968 ließ die antizionistische Kampagne
nach,173 es kam zu einer gewissen Liberalisierung im kulturellen und intellektuellen Bereich, und das Interesse an jüdischen Themen nahm in der tschechischen Öffentlichkeit
zu.174 Einen Wendepunkt dieser Phase markierte der Sechs-Tage-Krieg 1967, der die
Tschechoslowakei veranlaßte, alle diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen.
Bereits 1968 kehrte die antizionistische Rhetorik in die Politik zurück: Nach der Invasion der Truppen des Warschauer Paktes wurden die die Reformer als zionistische Revisionisten und – ein neuer Vorwurf – ,jüdische Intellektuelle‘ verleumdet.175
Die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings löste eine weitere Emigra169 Vgl. ebenda, S. 159.
170 11 der 14 wegen einer staatsfeindlichen Verschwörung Angeklagten waren Juden, was sicherlich im
Zusammenhang mit der antisemitischen Kampagne gesehen werden muß, die in der Sowjetunion
seit ihrer Kehrtwende in der Israel-Politik 1949 einsetzte. Vgl. SVOBODOVÁ, JANA Zdroje a projevy
antisemitismu v českých zemích 1948-1992, Praha 1994, S. 31ff. Tatsächlich wurde hinter dem Namen der jüdischen Angeklagten der Zusatz „jüdischer Herkunft“ angefügt, obwohl sie sich in keiner
Weise mit ihrem Judentum identifizierten. Ihnen wurde in den Schauprozessen vor allem Zionismus
und Kosmopolitismus vorgeworfen, wobei Zionismus als Synonym für eine besonders „reaktionäre,
nationalistisch gefärbte Form des Imperalismus“ verwendet wurde – vgl. ebenda, S. 31 – und Kosmopolitismus für volksfremde Mentalitäten, insbesondere bei Menschen jüdischer Herkunft, die in
religiösem und bourgeouisen Geist erzogen wurden – vgl. ebenda, S. 34f.
171 Vgl. BROD Židé, S. 156.
172 Vgl. HAHN, FRED Treatment of the Holocaust in Postcommunist Czechoslovakia (The Czech Republic), in: Braham, R. (Hg.): Antisemitism and the Treatment of the Holocaust in Postcommunist
Eastern Europe, New York 1994, S. 57-78, hier S. 61.
173 Allerdings verfügte das Innenministerium zu dieser Zeit über detaillierte Listen von Bürgern
jüdischer Herkunft, einschließlich Angaben über Beruf, Mitgliedschaft in jüdischen Vereinen, gesellschaftlichen Kontakten, Besitzverhältnissen, Vorlieben, Charakter und Arbeitsmoral. Vgl. SVOBODOVÁ, S. 42ff.
174 Beispielsweise an Franz Kafka und A. Ginsberg, der Entwicklung des Staates Israel oder dem
Holocaust. Es erschienen auch viele Bücher jüdischer Autoren. Vgl. SVOBODOVÁ, S. 48ff.
175 Wie E. Goldstücker, O. Šik oder F. Kriegel. Vgl. ebenda, S. 51f., sowie The Use of Antisemitism
50
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
tionswelle aus, von 18.000 jüdischen Gemeindemitgliedern verließ ein Drittel nach
1968 das Land.176
In der nun folgenden Phase der sogenannten ,Normalisierung‘ blieb der Antisemitismus unter dem Deckmantel des Antizionismus ein wesentlicher Bestandteil der
öffentlichen Propaganda, was sich vor allem im Umgang mit dem Holocaust-Gedenken
zeigte. So wurde u.a. 1968 die Pinkas-Synagoge ,wegen Renovierung‘ auf unbestimmte
Zeit geschlossen,177 die Gründung eines Ghetto-Museums in Theresienstadt verhindert,178 die Holocaust-Historiographie, die in der Reformperiode entstanden war, wieder
eingeschränkt, die Anbringung einer Gedenktafel am ehemaligen Deportationssammelplatz in Prag verboten. Die antizionistische Rhetorik blieb allerdings ohne große
Resonanz in der Bevölkerung, die dem ,Geschwätz von oben‘ keinen Glauben mehr
schenkte und des Regimes überdrüssig war.179
6. Nach der Wende 1989
Erst mit der ,Samtenen Revolution‘ 1989 fand der öffentliche Antisemitismus ein Ende.
Die diplomatischen Beziehungen zu Israel wurden sehr bald nach der Wende wieder
aufgenommen,180 Václav Havel gemahnte die Wichtigkeit der Erinnerung an die Leiden
der Juden im Protektorat. Die Beschäftigung mit dem Holocaust und mit jüdischer Geschichte und Kultur im allgemeinen konnte nun endlich ohne Einschränkungen
vorangetrieben und in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Das jüdische Leben
blühte wieder auf, es entstand eine Vielzahl jüdischer Organisationen und Zirkel.181
Wie in jeder pluralistischen Gesellschaft gibt es auch in Tschechien antisemitische
Strömungen und Gruppierungen, wie etwa Sládeks Republikaner, oder die Wochen-
against Czechoslovakia. Facts, Documents, Press Peports, London 1968.
176 Vgl. BROD Židé, S. 159.
177 Tatsächlich wurde sie erst 1992 wiedereröffnet, vgl. HAHN Treatment, S. 62.
178 Stattdessen wurde ein Polizeimuseum in Theresienstadt eingerichtet, vgl. KÁRNÝ, MIROSLAV Ergebnisse und Aufgaben der Theresienstädter Historiographie, in: Theresienstadt in der „Endlösung“,
S. 26-40, hier S. 28. Erst 1991 gelang die Realisierung des lange geplanten Theresienstädter Museums. Vgl. HAHN Treatment, S. 62.
179 Vgl. SVOBODOVÁ, S. 62.
180 Bereits im Januar 1990 kam der damalige isreaelische Ministerpräsident Shimon Peres zum
Staatsbesuch nach Prag, und Václav Havels Gegenbesuch folgte im April. Vgl. BROD, PETER The
Jews of Czechoslovakia after the Political Changes of 1989, in: Review of the Society for the
History of Czecholsovak Jews 4 (1991/92), S. 151-165, hier S. 161f.
181 Allerdings gab es 1993 in der gesamten Tschechischen Republik nur mehr 3.000 Gemeindemitglieder, wobei die Anzahl von Personen ,jüdischer Herkunft‘ sicherlich höher ist. Vgl. SVOBODOVÁ, S. 70.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
51
zeitung Týdeník Politika, die 1991 gegründet wurde. Aber sie repräsentieren in keiner
Weise die tschechische Öffentlichkeit, wie sich beispielsweise darin zeigt, daß besagte
Zeitung nach einer Gegenkampagne der tschechischen Medien ihre Tätigkeit Ende 1992
wieder einstellte.182
Antisemitismus ist heute zwar nach wie vor in der Gesellschaft existent (5 Prozent
der tschechischen Bevölkerung beurteilten laut einer Umfrage 1993 ihre Beziehung zu
Juden als „schlecht“183) und sollte nicht verdrängt und verharmlost werden, ist aber dennoch eher ein Randphänomen bzw. unterscheidet sich in seinem Ausmaß nicht von
anderen mitteleuropäischen Ländern.184
D. Juden in der Tschechoslowakei –
eine Analyse lebensgeschichtlicher Interviews
1. Analytischer Rahmen
Eines der Anliegen von Oral History ist es, die Perspektive derjenigen einzuholen, die
von
der
,großen
Geschichte‘
unmittelbar
betroffen
waren
und
deren
Geschichtserfahrung aus den herkömmlichen Quellen, und infolgedessen auch den auf
ihnen basierenden historischen Darstellungen, nicht hervorgeht. Im Falle der Geschichtsschreibung über den Holocaust ist dies um so wichtiger, da sein ganzes Ausmaß
erst an der Verdeutlichung einzelner Schicksale annähernd deutlich wird. Liest man
historische Darstellungen über den technischen Ablauf des Massenmords und die
Zahlen der Ermordeten, fällt es oft schwer, sich zu vergegenwärtigen, daß hinter jeder
Zahl ein individuelles Schicksal stand:
„In vielen Arbeiten sind die Opfer dadurch, daß man implizit von ihrer generellen Hoffnungslosigkeit und Passivität ausging oder von ihrer Unfähigkeit, den Lauf der zu ihrer
Vernichtung führenden Ereignisse zu ändern, in ein statisches und abstraktes Element des
182 Vgl. SVOBODOVÁ, S. 78ff.
183 Vgl. ebenda.
184 In einer vergleichenden Umfrage in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei aus dem Jahr 1991
stellte sich heraus, daß die Ungarn die schwächsten und die Polen die stärksten antisemitischen Gefühle äußerten, die Tschechoslowaken dagegen bewegten sich in der Mitte, wobei die Tschechen
näher an den ungarischen, die Slowaken näher an den polnischen Ergebnissen lagen. Andererseits
waren die Haltungen gegenüber Juden in allen drei Ländern überraschend positiv, und die überwiegende Mehrheit sprach sich dafür aus, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten. Vgl.
Hierzu COHEN, RENAE / GOLUB, JENNIFER Attitudes towards Jews in Poland, Hungary and Czechoslovakia. A comparitive Survey, New York 1991, S. 1ff.
52
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
185
historischen Hintergrunds verwandelt worden.“
Deshalb sollte die subjektive Perspektive der Verfolgten in jede historische Darstellung
integriert werden:
„Die einzige konkrete Geschichte, die sich bewahren läßt, bleibt diejenige, die auf persönlichen Erzählungen beruht. Vom Stadium des kollektiven Zerfalls bis zu dem des Abtransports und des Todes muß diese Geschichte, damit sie überhaupt geschrieben werden kann,
als die zusammenhängenden Erzählung individueller Schicksale dargestellt werden.“186
D.h. die Geschichte des Holocaust kann „ohne die Präsenz der Opfer in einer integrierten Erzählung und ohne den Versuch des Historikers, ihr Bild von den Ereignissen zu
erfassen, nicht geschrieben werden.“187
Nachdem nun ein ereignisgeschichtlicher Überblick über die Juden in der Tschechoslowakei gegeben wurde, wird im folgenden der Untersuchung der Geschichtserfahrung
von unmittelbar Betroffenen Raum gegeben, um die subjektiven Erlebensstrukturen und
ihren Niederschlag in den erzählten Lebensgeschichten herauszuarbeiten.
1.1. Analyseschritte
Welche Fragen werden nun konkret an das vorliegende Material gestellt? Die unter B.4.
so ausführlich dargestellte Wechselwirkung zwischen Vergangenheit und Gegenwart,
zwischen Ereignis, Erlebnis, Erinnerung und Erzählung, findet in den lebensgeschichtlichen Interviews ihre Entsprechung in Form der bereits erörterten zwei Ebenen des Erlebens und Erzählens. Gelingt es, beide Ebenen zu rekonstruieren und miteinander zu
kontrastieren, erhält man Aufschluß über das subjektive Erleben von Geschichte sowohl
damals als auch in seiner Bedeutung für das weitere Leben. So kann die ganz spezifi185 FRIEDLÄNDER, SAUL Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 1933-1939, München 1998, S. 12.
186 Ebenda, S.16.
187 FRIEDLÄNDER Auseinandersetzung mit der Shoah, S. 25. Es gibt bereits viele Oral-History-Projekte,
die die Erinnerungen der Überlebenden aufzeichnen, um die Vernichtung des europäischen Judentums im Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive der Betroffenen für die Nachwelt zu dokumentieren, wie beispielsweise das Fortunoff Video Archiv for Holocaust Testimonies der University
of Yale (vgl. HARTMAN, GEOFFREY Von Überlebenden lernen. Das Videozeugen-Projekt in Yale,
in: Ders.: Der längste Schatten, Berlin 1999, S. 194-215), die Survivors of the Shoah Visual History
Foundation von Spielberg (vgl. HARTMAN, GEOFFREY Zeitalter der Zeugenschaft: Steven Spielberg
und die Überlebenden der Judenvernichtung, in: FAZ, 10.9.1998, S. 41) oder das Jüdische Museum
in Prag. Dies geschieht in dem Bewußtsein, daß mit dem Tod des letzten Augenzeugen die Historisierung der Shoah einsetzen wird, d.h. sie wird zu einem historischen Ereignis, das nur noch über
Dokumente zugänglich ist, und die archivierten Zeugnisse sind ein Garant dafür, daß die Stimmen
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
53
sche subjektive Sinnstruktur der jeweiligen erzählten Lebensgeschichte ermittelt werden. Dies wird die erste Fragestellung sein, mit der sich die Analyse auseinandersetzt.
Die zweite Fragestellung ergibt sich aus den Ergebnissen der ersten: Nachdem gesagt
wurde, daß der dabei ermittelte Sinnzusammenhang die Identität des Subjekts widerspiegelt und diese sozial verfaßt ist, ist zu prüfen, wie sie beschaffen ist, konkret, welche Rolle für die Interviewpartner ihr ,Jüdischsein‘ spielt(e).
Bevor mit der Textanalyse begonnen werden kann, müssen vorab einige Angaben
über die Bedingungen gemacht werden, unter denen die Interviews stattfanden.
Um die erste Fragestellung zu bearbeiten, sind folgende Analyseschritte durchzuführen:188
a) die Analyse der biographischen Daten
b) die Text- und thematische Feldanalyse
c) die Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte
d) die Typenbildung
zu a) In diesem Analyseschritt werden zunächst diejenigen biographischen Daten der
erlebten Lebensgeschichte gesammelt, die sich auf Realitäten außerhalb des Textes beziehen und auch unabhängig vom Interviewtext überprüfbar sind. Sie werden in der Abfolge der Ereignisse in der historischen Zeit zusammengestellt, wobei der vorangestellte
historische
Überblick
eine
Einordnung
der
Daten
in
den
spezifischen
zeitgeschichtlichen Kontext ermöglicht.
„Es wird versucht, so nahe wie möglich die zum Zeitpunkt des Ereignisses wirksamen Bedingungen zu entwerfen, ohne spätere Kontexte hineinzuziehen. [...] Dadurch stößt man
auf Zusammenhänge, die die Biographen selbst nicht hergestellt haben bzw. erhält auch ein
Korrektiv gegenüber ihrer jeweiligen Perspektive im Text.“189
Erst auf der Grundlage der hierdurch ermittelten Daten kann das subjektive Erleben von
Geschichte rekonstruiert werden, indem die objektiven biographischen Daten mit den
Erzählungen und Deutungen derselben durch den Biographen kontrastiert werden.
der Verfolgten nach ihrem Ableben nicht untergehen.
188 Hierbei orientiere ich mich an ROSENTHAL / FISCHER-ROSENTHAL Narrationsanalyse, S. 152-156
und BRECKNER Zeitzeugen, S. 211-216.
189 Ebenda, S.212f.
54
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Außerdem liefert dieser erste Analyseschritt eine Kontrastfolie für die anschließende
Text- und Feldanalyse, bei der erkennbar wird, welche biographischen Daten erzählerisch ausgebaut und in welcher Reihenfolge sie präsentiert werden.
zu b) In diesem Schritt geht es um die Rekonstruktion der erzählten Lebensgeschichte, d.h. um die Bedeutung der Erlebnisse in der Gegenwart und den biographischen
Gesamtzusammenhang, in dem sie in der Erzählung dargestellt werden. Über diesen Zusammenhang gibt die Erzählstruktur des Interviewtextes Aufschluß, weshalb die Auswahl und Form sowie die zeitliche wie thematische Verknüpfung einzelner
Textsegmente zu untersuchen ist. Kriterien für die Einteilung in Textsegmente sind u.a.
Sprecherwechsel, Textsorte und Themenwechsel. Bei der Hypothesenbildung stehen
folgende Fragen im Vordergrund:
– Weshalb wird dieses Thema an dieser Stelle eingeführt?
– Weshalb wird es in dieser Textsorte präsentiert?
– Weshalb wird es so ausführlich bzw. so knapp dargestellt?
– In welche thematischen Felder läßt es sich einfügen?
– Welche Themen (Lebensbereiche oder Lebensphasen) werden angesprochen und
welche nicht?190
zu c) Durch die Kontrastierung von erlebter und erzählter Lebensgeschichte erhält
man Aufschluß über die Struktur der Erinnerung, die die Auswahl und Deutung der Erlebnisse bestimmt, und die sich in der Darstellung niederschlägt. Hierbei tritt also besagte biographische Sinnstruktur zu Tage, die die persönliche Identität einer Person ausmacht.
zu d) Gemäß dieser subjektiven Sinnstruktur können letztlich Typen für das Erleben
von Geschichte gebildet werden. Daß diese Typen keinen Anspruch auf Repräsentativität stellen, sondern jeder für sich einen möglichen Umgang mit historischer bzw. sozialer Wirklichkeit und somit das Allgemeine im Konkreten darstellen, wurde bereits
ausführlich dargestellt.
Für die zweite Fragestellung, die Beschaffenheit der sozialen Identität der Befragten,
kann auf die vorliegenden Ergebnisse zurückgegriffen werden. Außerdem werden die
von den Befragten verwendeten Personalpronomen als Indikatoren für Gruppenzuge-
190 Vgl. ROSENTHAL / FISCHER-ROSENTHAL, S. 153.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
55
hörigkeit untersucht, sowie die Selbstbeschreibung und Beschreibung anderer (als
Tschechen, Juden, Deutsche usw.).
1.2. Interviewbedingungen
Die Interviews wurden von mir im Herbst 1998 im Rahmen eines Projektes in Zusammenarbeit mit Prof. Wiehn von der Universität Konstanz geführt, mit dem Ziel, sie in
seiner Judaica-Reihe zu veröffentlichen.191 Parallel entstand die Idee, das so gewonnene
Material zum Gegenstand einer Magisterarbeit zu machen. Der Kontakt zu den Interviewpartnern kam über Prager Bekannte zustande, so daß die Gespräche in einem
relativ vertraulichen Rahmen zu Hause in ihren Wohnungen stattfanden. Eingangs
erläuterte ich beide Vorhaben und machte deutlich, daß nicht nur die KZ-Erfahrung,
sondern das ganze Leben von Interesse sei, weshalb ich sie bat, mir ihre gesamte
Lebensgeschichte zu erzählen, so wie sie sich daran erinnerten und was ihnen wichtig
erschien. Soweit es möglich war, hielt ich mich mit Fragen zurück, um erst in einem
zweiten Durchgang bestimmte Themenkomplexe anzusprechen, so daß es meinen
Interviewpartnern selbst überlassen war, das Gespräch zu strukturieren.
Die nun zu untersuchenden Interviews wurden unter folgenden Kriterien ausgesucht:
Es sollten sowohl Biographien von deutsch wie von tschechisch assimilierten Juden
Beachtung finden, außerdem Personen beiderlei Geschlechts und nicht nur Prager Juden, zudem wurde darauf geachtet, unterschiedliche Lager- und Nachkriegsschicksale,
die für die tschechoslowakischen Juden charakteristisch waren, auszuwählen:
Marta N. wurde 1919 in einer tschechisch-jüdischen Kaufmannsfamilie in der tschechischen Kleinstadt Tábor geboren, wo sie bis zu ihrer Deportation nach Theresienstadt
lebte. Mit den Theresienstädter Herbsttransporten wurde sie nach Auschwitz-Birkenau
weiterdeportiert, von wo sie zunächst nach Bergen-Belsen, dann zur Zwangsarbeit in
ein Außenkommando von Buchenwald und letztlich wieder zurück nach Theresienstadt
transportiert wurde. Sie erlebte als einzige ihrer Familie die Befreiung und heiratete
wenig später einen jüdischen Überlebenden.
L.R.192 wuchs in einer tschechisch-jüdischen Kaufmannsfamilie in Prag auf. Von
Theresienstadt wurde sie im Mai 1944 in das Theresienstädter Familienlager in
Birkenau BIIb deportiert, nach dessen Auflösung zunächst zur Zwangsarbeit nach
191 SRUBAR, HELENA Eine schreckliche Zeit. Tschechisch-jüdische Überlebensgeschichten 1939-1945.
Hrsg. v. Erhard Roy Wiehn, Konstanz 2001.
56
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Hamburg und dann bis zur Befreiung nach Bergen-Belsen. Auch sie heiratete nach dem
Krieg einen jüdischen Überlebenden.
Eva R. wurde in einer deutsch-jüdischen Lehrerfamilie in Saatz im Sudetengebiet geboren, von wo die Familie bereits vor dem Münchner Abkommen nach Prag floh. Eva
verbrachte ihre gesamte Lagerhaft in Theresienstadt, während hingegen ihre Eltern mit
den Herbsttransporten nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, von wo sie nicht
zurückkehrten, so daß Eva als einzige ihrer Familie überlebte. Unmittelbar nach dem
Krieg heiratete Eva ihren ehemaligen tschechisch-jüdischen Verlobten, der den Krieg in
der Emigration verbracht hatte.
Jirka K. wuchs zweisprachig in einer Prager jüdischen Familie auf, wurde als AK
nach Theresienstadt und ebenfalls mit den Herbsttransporten nach Birkenau deportiert.
Auf dem Todesmarsch gelang ihm die Flucht. Nach dem Krieg war er ein begeisterter
Anhänger der Kommunistischen Partei. Doch seine Familie wurde Opfer der SlánskýAffaire, die Eltern wurden verhaftet und Jirka erhielt Berufsverbot. In den sechziger
Jahren war er in der Reform-Bewegung aktiv, die zum Prager Frühling führte, doch
nach dessen gewaltsamer Niederschlagung verließ er mit seiner Familie das Land und
lebt heute in Deutschland.
2. Marta N.
2.1. Subjektive Sinnstruktur
2.1.1. Zeit vor der Verfolgung
Aus der Zeit vor der Verfolgung werden keine Ereignisse bzw. Erlebnisse erzählt.
Marta macht lediglich ein paar biographische Angaben über die Familie, aus denen
hervorgeht, daß sie wohl gut situiert war.193 Mehrmals hebt sie hervor, daß ihre
Heimatstadt (Tábor) eine rein tschechische Stadt war. „Byli jsme patrioti náramný“,
sagt sie, und macht damit die Identifikation mit der tschechischen Nation deutlich.194
Erst später, im Zusammenhang mit der einsetzenden Ausgrenzung, geht sie noch einmal
auf diese Periode ein, um zu betonen, daß früher keinerlei Unterschiede gemacht
192 L. möchte ausdrücklich nur mit Initialen genannt werden.
193 „Na hlavní třídě jsme bydleli proti divadlu, měli jsme obchod a výrobu konfekce.“ „Wir wohnten
auf der Hauptstraße gegenüber dem Theater und hatten ein Geschäft und eine Produktionstätte für
Konfektion.“ Dok. 1-1. Vgl. historischen Überblick zur Wirtschafts- und Sozialstruktur, Kap. 1.
194 „Wir waren große Patrioten.“ Ebenda.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
57
wurden und sie als tschechische Juden sehr assimiliert waren. Beide Male gibt hierzu
der Kontakt mit der tschechischen Bevölkerung Anlaß, einmal, als sie beim
Schneeschippen von tschechischen Faschisten verspottet wird,195 und zum anderen, als
sie und die anderen Táborer Juden durch die Stadt zum Bahnhof eskortiert werden und
Marta beobachtet, wie Leute hinter den Gardinen hervorschauen.196 Hier geht sie auch
auf das Thema Religion ein, die zu Hause wenig praktiziert wurde.197
Da Marta später erzählen wird, daß sie eine ausführliche Autobiographie verfaßt hat,
die auch Kindheitserinnerungen mit einschließt,198 diese aber hier nicht zu schildern gewillt ist, ist zu vermuten, daß sie sie in diesem konkreten Zusammenhang nicht für
wichtig hält. Es genügt ihr, die Zeit vor der Okkupation als völlig ,heile Welt‘ darzustellen, in der sie eine ganz normale tschechische Jugendliche war, ohne sich von ihrer
Umwelt in irgendeiner Form abzuheben. Trotzdem kann sie diese Phase nicht erinnern,
ohne die weitere Entwicklung mit einzubeziehen. Das wird vor allem darin deutlich,
daß sie bei der ersten Erwähnung ihres Bruders sofort sehr ausführlich seinen Tod schildert.199 Bei der weiteren Analyse wird sich herausstellen, daß die Vermischung der erlebten und der heutigen Perspektive ein Indikator für besonders gravierende biographische Erfahrungen ist. Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden: einmal, daß ein Erlebnis sehr einschneidend war und eine Beurteilung oder Relativierung aus heutiger
Sicht hinzugefügt wird, zum anderen, daß das heutige Wissen die Darstellung der erlebten Ebene überschattet, wie im vorliegenden Fall.
2.1.2. Okkupation
Bereits nach wenigen Sätzen beginnt Marta mit der Schilderung der Protektoratszeit,
die in zwei Phasen zerfällt. Den Wendepunkt markieren die Theresienstädter Herbsttransporte im Herbst 1944, die für Marta den Verlust der Familie mit sich bringen. Die
Deportation nach Theresienstadt ist zwar auch ein biographischer Einschnitt, der als
Endpunkt den Zeitraum 1939-1942 überschattet, aber dennoch ist Theresienstadt vor
allem eine ,Station‘ vor der endgültigen Katastrophe, wo die Transportangst die Erzählung dominiert.
195
196
197
198
199
58
Dok. 1-2.
Dok. 1-3. Vgl. auch weiter unten, Kap. 2.1.2.1.
Die Mutter besucht die Synagoge an den hohen Feiertagen, der Vater nicht mehr. Dok. 1-3.
Dok. 1-10.
Dok. 1-1.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
2.1.2.1. 1939 bis Herbst 1944
In der ersten Phase steht daher das Themenfeld Familie und ihre Ermordung im Mittelpunkt der Darstellung. Daneben wird vor allem die zunehmende gesellschaftliche
Ausgrenzung und Entrechtung vor der Deportation thematisiert.
Themenfeld Ausgrenzung
Marta leitet die Protektoratszeit mit einer Aufzählung der Verbote ein, die „uns als Juden“200 betrafen, womit sie erstmals das Wort ,Jude‘ erwähnt, was einmal mehr deutlich
macht, daß Marta sich bis zum Einmarsch der Deutschen nie als ,anders‘ empfand.
Nachdrücklich wird der Umzug in eine Einzimmerwohnung, d.h. der Verlust des gutbürgerlichen Sozialstatus, hervorgehoben, aber abschließend kommentiert sie aus der
Gegenwartsperspektive: „bylo to hrozný, ale pořád jsme ještě byli doma.“201 Auch hier
kann sie sich nicht vom Wissen um die weiteren Ereignisse lösen, so daß die erlebte
Ebene hier verstärkt durch die gegenwärtige Sicht durchbrochen wird.
Recht ausführlich erzählt sie von der Zwangsarbeit auf einem Gutshof, zu der sie und
andere Jüdinnen ab Winter 1941/42 verpflichtet wurden: Sie ergaben sich nicht einfach
in ihr Schicksal, sondern waren einerseits bemüht, durch harte Arbeit das antisemitische
Vorurteil, Jüdinnen seien faul, zu widerlegen. Andererseits rächten sie sich durch kleine
Sabotageakte auf dem Feld, was zeigt, wie die jungen Mädchen damals auf die noch relativ neue Erfahrung der rassistischen Diskriminierung reagierten.202 In diesem Kontext
taucht bereits ein kollektives ,wir‘ der Zwangsarbeiterinnen auf, das erst nach dem Verlust der Familie in Auschwitz wieder erscheint.
Besonders erniedrigend ist das Schneekehren in der Stadt, wo die Jüdinnen von tschechischen Faschisten, Vlajka-Anhängern in ihrem Alter, verspottet werden.
„V zimě jsme, než jsme šli na ten statek, tak jsme musely chodit mést v zimě sníh na
ulicích, bylo to tak tristní, protože kluci, kteří s námi ješte tři roky předtím, než přišli
200 „tak jsme jako Židi [...].“ Dok. 1-1.
201 „Es war schrecklich, aber immerhin waren wir noch zu Hause.“ Dok. 1-1.
202 Dok. 1-1. Hier schließt ein Beispiel für den ersteren Fall der Vermischung der Perspektiven an, denn
beide Reaktionen werden von Marta kommentiert, erstere, weil ihr aus heutiger Sicht dieser Ehrgeiz
völlig unsinnig erscheint, zweitere, um sich zu rechtfertigen, wie bedeutungslos ihre Rache war im
Vergleich zu dem, was ihnen durch die Zwangsarbeit zugefügt wurde.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
59
Němci, tancovali a stýkali jsme se [...].“203
Dem Umfang dieser Passage nach ist zu vermuten, daß Marta extrem enttäuscht war
vom Verhalten der tschechischen Bevölkerung und darunter sehr gelitten hat. Nicht nur,
daß sie an dieser Stelle, wie bereits erwähnt wurde, betont, vor Einmarsch der Deutschen habe es keinerlei Unterschiede gegeben, sondern zudem schildert sie die opportunistische Karriere vieler Vlajka-Anhänger, die später zu kommunistischen Funktionären
wurden, und erwähnt einen von ihnen sogar namentlich.
Im allgemeinen ist die Situation so bedrückend, daß Gerüchte über bevorstehende
Transporte fast begrüßt werden, „Snad už, aby to přišlo, protože tohle není život.“204
Doch auch hier kann sie nicht in der erlebten Perspektive bleiben, sondern schließt den
Kommentar an, daß die Situation nur relativ betrachtet schlimm war angesichts dessen,
was ihnen noch bevorstand.205 Dennoch war die Lage wohl so unerträglich, daß Marta
später sagt: „Pak prišel den konečně [Hervorh. H.S.], kdy bylo řečeno, že musíme do
transportu.“206
Wie sehr sie damals unter dem Zusammenbruch der Normalität und der Ausgrenzung
gelitten hat, zeigt sich noch einmal deutlich in der Schilderung des Sammelplatzes in
ihrer alten Schule, indem sie, statt zu beschreiben, wie es ihr und ihrer Familie dort erging, an die Kinder denkt, die sich jetzt bestimmt freuen, schulfrei zu haben. Und auch
die ausführliche Beschreibung des Fußmarschs zum Bahnhof durch die gesamte Innenstadt vor den Augen der Einwohner („zřejmě nekteří byli rádi, že se konečně zbaví
židů“207) stützt diese Vermutung, zumal, wie erwähnt, hier Marta noch einmal auf die
,heile‘ Vorkriegszeit zu sprechen kommt.
Themenfeld Familie
Sofort nach der Aufzählung der antijüdischen Verbote erzählt Marta von ihrem Entschluß, ihre langjährige nichtjüdische Bekanntschaft trotz Drängens ihrer Eltern nicht
zu heiraten, um bei der Familie bleiben zu können.208 Sie wechselt in die erzählte Per-
203 „Im Winter, bevor wir zum Gut gingen, mußten wir Schnee auf den Straßen kehren, das war so trist,
weil Jungen, die mit uns noch vor drei Jahren, bevor die Deutschen kamen, tanzen gegangen, mit
uns ausgegangen waren [...].“ Dok.1-2.
204 „Möge es doch bald kommen, denn das hier ist kein Leben.“ Dok. 1-2.
205 Ebenda.
206 „Dann kam endlich [Hervorh. H.S.] der Tag, an dem es hieß, daß wir in den Transport müssen.“
Dok. 1-2f.
207 „Offensichtlich waren einige froh, die Juden endlich loszuwerden.“ Dok. 1-3.
208 Dok. 1-1.
60
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
spektive und beteuert, diesen Entschluß nie bereut zu haben. Besonders am Herzen liegt
ihr anscheinend aus heutiger Sicht das Schicksal ihres Bruders, da sie sehr viel von ihm
und seinen Tätigkeiten in dieser Phase, von den Eltern hingegen fast gar nichts erzählt.
Ausführlich beschreibt sie seine Teilnahme an Hachscharah-Kursen noch vor der Okkupation, was im Zusammenhang damit steht, daß er später die Möglichkeit erhielt auszuwandern und sie ihn zum Bleiben überredete. Hier nimmt sie wieder ihr heutiges Wissen um seinen Tod vorweg und macht sich deshalb bittere Selbstvorwürfe („až do smrti
si to budu vyčítat“209). Gleichzeitig rechtfertigt sie sich, daß sie Angst um ihn hatte und
außerdem damals geglaubt hätte, die Kinder müßten den Eltern helfen. An dieser Stelle
klaffen erlebte und erzählte Perspektive bisher am radikalsten auseinander. Marta
konnte damals nicht ahnen, daß die nationalsozialistische Vernichtungspolitik ihre gesamte ,Rasse‘ zum Tode verurteilen würde und daß ihre Hoffnung, alles würde einfacher zu ertragen sein, wenn die Familie zusammen bliebe und sich gegenseitig unterstützen könnte, im Grunde ein alltäglicher Erfahrungswert, sich als vollkommene Fehleinschätzung erweisen würde angesichts der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie, die jegliche Alltagsnorm ad absurdum führte.210
Die Fürsorge der Kinder für die Eltern (im übrigen auch eine Umkehrung der normalen Verhältnisse, zumindest verfrüht, da die Eltern im Grunde genommen noch nicht
,alt‘ im herkömmlichen Sinne waren) kommt beim Marsch zum Bahnhof zum Ausdruck, wo die Geschwister das gesamte Gepäck tragen.211
Die Deportation nach Theresienstadt ist ein weiterer biographischer Einschnitt in dem
Sinne, daß sich dadurch die endgültige Katastrophe, die Transporte nach Auschwitz, ankündigt. Von vornherein wird diese Etappe als vorübergehende ,Station‘ gekennzeichnet, nicht zuletzt dadurch, daß die Familie zunächst sofort weiterdeportiert werden soll,
so daß diese Bedrohung vom ersten Tag an präsent ist. Entsprechend dominiert die
Angst vor den ,Osttransporten‘ bzw. der Schutz der Familie vor selbigen durch bestimmte Privilegien und Berufe212 die Erzählung: Alle Familienmitglieder bis auf Marta
209 „Bis zu meinem Tod werde ich mir das vorwerfen.“ Dok. 1-2.
210 In diesem Zusammenhang nimmt sie auch die Ermordung der Mutter vorweg, die zu dem Zeitpunkt
jünger war als heute Martas Sohn, ein typisches Trauma von Genozid-Überlebenden, die darunter
leiden, daß die natürliche Generationenfolge unterbrochen wird und sie ein Alter erreichen, das die
ermorderten Angehörigen nie erleben konnten. Vgl. LEZZI, EVA Leben und älter werden in
Deutschland: Alltagserfahrung und Erinnerungsformen, in: Archiv der Erinnerung. Interviews mit
Überlebenden der Shoah. Bd. I: Videographierte Lebenserzählungen und ihre Interpretationen, hrsg.
von Gelbin, Cathy / Lezzi, Eva / Hartman, Geoffrey / Schoeps, Julius, Potsdam 1998, S. 357-395.
211 Dok. 1-3.
212 Vgl. historischer Überblick, Kap. 3.2.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
61
sind geschützt, aber ihrem Bruder gelingt es dank seiner Beziehungen, auch sie immer
wieder aus den Transporten herauszureklamieren.
Ein weiteres Themenfeld kündigt sich hier an, und zwar die schrittweise Entmenschlichung, die in Theresienstadt ihren Anfang nimmt, wenn auch noch in bescheidenerem
Ausmaß. Nicht umsonst hebt Marta hervor, daß sie ins Ghetto noch in Personenzügen,
„jako lidi“,213 transportiert wurden, und nicht in Viehwaggons wie später nach
Auschwitz, womit die völlige Entmenschlichung eingeleitet wird.214
Daß aber auch in Theresienstadt bereits das Individuum sein Existenzrecht einbüßte,
deutet Marta mit der Bemerkung an, wie beliebig die Transportzusammenstellung war,
so daß ihre Rettung stets die Deportation eines anderen Menschen mit sich brachte:
„Byla jsem vyreklamovaná, bohužel za mne musel jít někdo jiný. Takovej je život,
takovej je osud.“215 Hier klingt ein moralischer Konflikt an, der auf der Diskrepanz zwischen verinnerlichten Alltagsnormen und dem diese Normen verletztenden Verhalten
im Lager beruht, um zu überleben.216
Der erwähnte Individualitätsverlust zeigt sich auch in der Beschreibung der Unterbringung in Massenunterkünften, die keine Privatssphäre mehr ermöglichten.
2.1.2.2. Herbst 1944 bis 1945
Der Transportwelle im Herbst 1944217 fällt als erster am 28. September der Bruder zum
Opfer, die Eltern müssen mit dem letzten Transport antreten. Auch hier durchmischen
sich erlebte und erzählte Perspektive stark, Marta argumentiert von ihrem heutigen Wissen aus, daß sie die Deportation der Eltern verhindert hätte, hätte sie damals geahnt, daß
keine weiteren Transporte das Ghetto verlassen würden. Sie selbst war zu diesem entscheidenden Zeitpunkt inzwischen in einem geschützten Beruf tätig und schildert, wie
sie ihren Arbeitgeber anflehte, sie gehen zu lassen, um mit ihren Eltern zusammen zu
sein. Wie vorher andersherum kommentiert sie jetzt, daß sich jemand freuen konnte, an
ihrer Statt bleiben zu können. Und sofort wechselt sie wieder in die heutige Perspektive
213 „wie Menschen“, ebenda.
214 Siehe weiter unten, Kap. 2.1.2.2.
215 „Ich wurde herausreklamiert, leider mußte an meiner Stelle ein anderer gehen. So ist das Leben, so
ist das Schicksal.“ Dok. 1-4. Trotz der allgegenwärtigen Angst vor den Transporten wußte Marta
nichts Genaues über deren Bestimmungsort und -ziel. Zur Demonstration der allgemeinen Ahnungslosigkeit erzählt sie von einer Postkarte von einem deportierten Bekannten aus dem Familienlager,
deren Andeutungen sie nicht begriff. Ebenda.
216 Vgl. Pollak, Anm. 375.
217 Vgl. historischer Überblick, Kap. 3.2.
62
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
und beteuert, diesen Entschluß niemals bereut zu haben, auch wenn sie nur noch auf der
Fahrt mit den Eltern zusammen war.218
Auch nach der Ankunft in Auschwitz bleibt zunächst das Thema Familie im Vordergrund, bis Marta erfährt, was sich dort tatsächlich abspielt und dadurch klar wird, daß
sie ihre Eltern niemals wiedersehen wird.
Themenfeld Familie
Bei Ankunft, im allgemeinen Gebrüll, fühlt sich Marta sehr heldenhaft, weil sie entgegen dem Verbot (alles Gepäck mußte im Zug zurückgelassen werden) Medikamente für
ihre Mutter herausschmuggelt. Angesichts der bevorstehenden Ereignisse wird diese Tat
von ihr ironisch kommentiert.219
Bei der Selektion wird sie von den Eltern getrennt, noch nicht ahnend, was das bedeutet, denn beim anschließenden Appell fragt sie einen SS-Mann, wann sie diejenigen,
die auf die andere Seite geschickt wurden, wiedersehen werde. Er antwortet ihr, am
nächsten Tag, woraufhin sie außer sich vor Freude ist und ihm ihre Uhr schenkt.
Angesichts dieser Lüge, die sich der SS-Mann auch noch belohnen läßt, kann sie nicht
umhin, wieder in die erzählte Perspektive zu fallen. Wie um sich zu trösten, sagt sie, es
sei ohnehin nicht von Bedeutung gewesen, daß sie die Uhr hergab, da wenig später alle
Wertsachen abgegeben werden mußten, aber immerhin habe sie sich eine Weile freuen
können.220 Hier tritt wieder eine Vermischung der Perspektiven des ersteren Falls auf,
wo ein Erlebnis zum Zeitpunkt des Erlebens eine Bedeutung hatte, die durch die spätere
Erfahrung in einem anderen Licht erscheint, im Gegensatz zu der folgenden Szene, wo
ein Erlebnis seine Bedeutung erst durch die spätere Entwicklung erlangt.
Als letztes herausragendes Ereignis in Auschwitz erzählt Marta von einem Appell in
der ersten Nacht, der für sie deshalb von großer persönlicher Bedeutung war, weil sie
hinterher erfuhr, daß sie direkt neben dem Krematorium gestanden hatte, als ihre Eltern
ins Gas gingen. Zum Zeitpunkt des Erlebens jedoch war sie völlig ahnungslos. Unklar
bleibt, wann Marta die Wahrheit über den Verbleib der ,Arbeitsunfähigen‘ erfuhr, aber
218 Dok. 1-4.
219 „[...] já jsem si připadala jako obrovská hrdinka, protože jsem propašovala takovou malou kabelku s
maminčinejma lékama, myslela jsem si, jak nejsem šikovná a chytrá, že se mi to podařilo.“ „[...] ich
kam mir wie eine große Heldin vor, weil ich so eine kleine Tasche mit Mamas Medikamenten unter
dem Mantel hinausschmuggelte, ich dachte, was bin ich geschickt und schlau, daß mir das gelungen
ist.“ Dok.1-5.
220 Ebenda.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
63
im nachhinein scheint es für sie tröstlich zu sein, daß sie in jener Nacht gewissermaßen
,Totenwache‘ stand.221
Themenfeld Entmenschlichung
Mit dem Abtransport aus Theresienstadt in Viehwaggons beginnt nun das Themenfeld
Entmenschlichung: Marta schildert in erlebter Perspektive ihr Entsetzen über die Zustände im Waggon, die Enge, den Eimer für die Notdurft, den Tod, und schließt aus der
Sicht der Gegenwart, daß dieses Erlebnis eigentlich gar nicht wiedergegeben werden
kann („bylo to prostě něco [...] něco, co se nedá vylíčit“).222
Weitere Stationen der Entmenschlichung nach der Ankunft sind: das Auseinanderreißen der Familie, der Verlust jeglicher Habe, einschließlich der Kleider, die Ganzkörperrasur und der Erhalt von völlig unzureichender Kleidung ohne Strümpfe und
Unterwäsche.223 Hinzu kommt bald die Erkenntnis, daß das Überleben an diesem Ort
die Ausnahme darstellt und daß die Eltern der Regel zum Opfer fielen.
Ab hier gerät die KZ-Erfahrung in eine neue Phase: Von nun an dominiert die erlebte
Perspektive, was sicherlich damit zusammenhängt, daß die Erfahrung, die bisher die Erzählung durch ein Vorweggreifen des Geschehens überschattet hat, nämlich die Ermordung der Eltern und des Bruders, bereits ihren Lauf genommen hat.224 Von nun an ist
Marta völlig allein, an die Stelle der familiären Bindungen tritt nun die meiste Zeit ein
kollektives ,wir‘. Mehrfach artikuliert Marta den Verlust des Zeitgefühls, erinnert werden vor allem Transporte, Ankünfte, Aufbrüche, d.h. neue Situationen, sowie aus der
Monotonie des Lagerlebens herausragende Erlebnisse, sei es in Bezug auf die eigene
Person wie etwa Krankheiten, oder für das gesamte (tschechische) Häftlingskollektiv.
Vom Rest der Zeit in Auschwitz ist Marta nur noch das ständige Appellstehen und
das ,Essen fassen‘ in Erinnerung, was der völligen Passivität entspricht, in die die Häftlinge hineingezwungen waren. Entsprechend kann Marta auch nicht mehr sagen, wie
lange sie dort war: „já jsem ztratila absolutně pojem času.“225
Ein weiterer Transport, im Viehwaggon und zu Fuß, durchbricht die Monotonie. Als
221 Sie selbst spricht von einem „Begräbnis für mehrere Generationen im voraus“ („pohřeb, nevím pro
kolik generací, do předu“), was wieder auf den schmerzlichen Bruch der natürlichen Generationenfolge verweist. Ebenda.
222 „das war schlicht etwas [...], das man nicht beschreiben kann.“ Dok. 1-4.
223 Dok. 1-5.
224 Zwar ist der Bruder zu gegebenem Zeitpunkt noch am Leben, aber für Marta, die ihn in Theresienstadt das letzte Mal gesehen hat, liegt die endgültige Trennung in der erzählten Perspektive ebenfalls
schon hinter ihr.
64
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
bedeutsames Ereignis wird der Erhalt einer Pferdedecke hervorgehoben, was einerseits
noch einmal die große Kälte verdeutlicht, der die Häftlinge ausgesetzt waren, und
andererseits den Grad der Entmenschlichung unterstreicht. Wie ,Vieh‘ werden sie transportiert, wie ,Vieh‘ gefüttert, wie ,Vieh‘ mit Pferdedecken versehen, und in der neuen
Unterkunft, einem riesigen Zelt,226 schlafen sie wie ,Vieh‘ auf Stroh, zusammengepfercht auf dem Boden wie „Heringe“.227 Auch wenn Marta nicht explizit sagt, daß sie
wie Tiere behandelt wurden, so ist die Häufung von Andeutungen dafür in dieser
Passage doch aussagekräftig genug.228 Wenn sie im Anschluß daran schildert, wie sie
am Morgen trotz Verbot besagte Pferdedecke mitnahm zum Appell, so vielleicht, um
einen letzten Rest verbliebenen menschlichen Willens zu demonstrieren. Interessant ist
hier besonders, daß sie das bisher verwendete ,wir‘ erklärt: es steht für die
tschechischen Mädchen, im Gegensatz zu anderen Nationalitäten wie Polinnen oder
Griechinnen.
Auch für diese Etappe kann sie die Dauer des Aufenthalts nicht mehr angeben und erinnert vor allem die vollkommen unzureichende Ernährung (sog. Kaffee in Eßschale),
Waschgelegenheiten229 auf dem Feld und im Zusammenhang damit die entsetzliche
Kälte, die durch den kahlgeschorenen Kopf und die unzureichende Kleidung noch verstärkt wurde. Die erzählte Perspektive spielt hier nur hinein, als sie eine Ortsangabe
macht und ihre Verwunderung darüber äußert, daß sich unter diesen Bedingungen keine
der Frauen erkältet hat. Die Unmenschlichkeit erreicht einen weiteren Höhepunkt in der
folgenden Passage, als die Frauen unter Schlägen von Gewehrkolben im Laufschritt zu
ihren neuen Unterkünften getrieben werden.
Erst dort taucht das ,Ich‘ wieder auf, und zwar, als Marta die Eßschale gestohlen
wird, was, wie sie erklärt, eine Frage von Leben und Tod war. Sie schildert, wie ihre
225 „Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren.“ Dok. 1-5.
226 Das Zelt war Bestandteil eines ganzen Zeltlagers, das zum KZ Bergen-Belsen gehörte, was Marta zu
dem Zeitpunkt aber noch nicht wußte. Daher spricht sie erst nach der Verlegung in einen Lagerteil
mit Baracken davon, in Bergen-Belsen zu sein. Das Zeltlager wurde am 7. November durch einen
Herbststurm zerstört, und angesichts der Tatsache, daß Marta erst am 28. Oktober aus Theresienstadt deportiert wurde, kann sie sowohl in Auschwitz wie auch in diesem Lager nur jeweils ein paar
Tage verbracht haben. Interessant ist im übrigen auch, daß Marta nicht von einem Herbst-, sondern
von einem Schneesturm spricht, was unterstreicht, wie sehr sie gefroren haben muß, wenn sie in
ihrer Erinnerung an Eis und Schnee denkt.
227 Dok. 1-5.
228 Im Gegensatz zum Transport nach Theresienstadt, wo sie noch „wie Menschen“ in Personenwagen
fuhren. Siehe weiter oben, Kap. 2.1.2.1
229 Auch bei der Beschreibung von Bergen-Belsen wird das Vorhandensein von Waschgelegenheiten
hervorgehoben, was wieder einmal die Wechselwirkung zwischen historischer Realität, Erleben und
Erzählen verdeutlicht, denn in Auschwitz hatte es keine Möglichkeit zum Waschen gegeben.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
65
Freundin sie überredet, einer anderen Gefangenen die Eßschale zu stehlen, und wie
schlecht sie sich dabei fühlt. Marta versucht sich zu rechtfertigen: „Byla to nutnost.“230
Noch mehr als in Theresienstadt offenbart sich hier die Unmenschlichkeit des
Lagersystems, das seine Insassen zwingt, zur Selbsterhaltung den Tod von anderen in
Kauf zu nehmen.
Als nächste Episode schließt sich direkt die Schilderung ihrer Gelbsucht an. Marta erinnert sich, daß sie im hohen Fieber in eine Grube voller Unrat stürzte und dann bei
Wintertemperaturen ihre Sachen mehr schlecht als recht zu waschen suchte, was annäherungsweise eine Vorstellung ihres elenden Zustands und den unerträglichen Haftbedingungen ermöglicht. Dem werden die zwischenmenschlichen Bindungen der tschechischen Häftlinge untereinander gegenübergestellt: die bereits oben erwähnte Freundin
organisiert Essen für die Kranke, die Mädchen verstecken sie bei den Appellen, um zu
verhindern, daß Marta auf die Krankenstation muß.231
Dann wird der nächste Transport angemeldet, den Marta mit dem Satz einleitet:
„Potom nás přišli nakupovat“.232 Auch hier ist wieder in Gedanken wie ,Vieh‘ zu ergänzen, was besonders deutlich wird, als Marta die Männer beschreibt, die die Selektion
durchführen:
„No načež přijeli tři chlapi, mužský v civilu, měli takové krátké kožišky, takové jako
mívají [...] mívali dřív ti chlapi, co chodili vykupovat dobytek po vesnicích.“233
Anscheinend war bekannt, daß die Ausgereihten keine Überlebensschance hatten, und
durch einen Wechsel in die erzählte Perspektive kommentiert Marta, daß angesichts der
dort herrschenden Lebensbedingungen tatsächlich niemand von den Zurückgeblieben
überlebt hat.
Als sie die Abfahrt einleiten will, fällt ihr noch ein Erlebnis ein: Wie sie den ganzen
Neujahrstag ohne Essen und Trinken Appell stehen mußten und das Singen von Liedern
von Voskovec und Werich ihnen Kraft gab. Daß sie gerade nach der Schilderung der erniedrigenden Selektion darauf zu sprechen kommt, wie sie im tschechischen Häftlingskollektiv eine Brücke zur Zeit vor der Okkupation und zur tschechischen antifaschistischen Kultur schlagen, ist vielleicht als Indiz zu sehen, daß sie Wert darauf legt
230
231
232
233
66
„Es war eine Notwendigkeit.“ Dok. 1-6.
Ebenda.
„Dann kamen sie uns einkaufen.“ Ebenda.
„Na, und darauf kamen drei Männer in Zivil, sie hatten solche kurzen Pelzmäntel, wie sie [...] früher
die Männer trugen, die auf dem Land Vieh einzukaufen pflegten.“ Ebenda.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
zu demonstrieren, daß sie sich trotz der äußeren Umstände ihre Menschenwürde bewahrt haben. Die Diskrepanz zwischen Lagerwirklichkeit und ,normalem‘ Leben bringt
Marta bereits in der Einleitung dieser Passage zum Ausdruck, als sie das herrliche Wetter und die schöne verschneite Landschaft beschreibt:
„Na Nový rok ráno nás vyhnali, byl nádherný den, na takovou plaň velikou, kde bylo
spoustu borovic a jiných stromů, ale hlavně borovice zasněžené. Plně sněhu a nádherné
slunce. Kdyby to nebylo v lágru, tak to byl nejkrásnější den na horách.“234
Um so stärker ist der Kontrast:
„A my jsme tedy stály na ten Nový rok, už níkdy žádná z nás nezapomene, uplně bez
níčeho, bez žrádla, bez pití až do večera.“235
In der nächsten Etappe, in Raguhn bei Dresden, werden neben Details über Verpflegung
und Arbeit vor allem Kontakte zu Zwangsarbeitern thematisiert. Die größte Hilfsbereitschaft zeigen Franzosen und Ukrainerinnen,236 das Verhalten der Tschechen ist wieder
eine große Enttäuschung:
„Ty Češi se k nám chovali nejhůř v té fabrice, Já si nepamatuju, že by nám nějákej Čech
něco dal, dokonce jsme prosily, jestli by nám nemohli zprostředkovat nějáký [...] zprávu
malou, když jedou domu na dovolenou nebo tak, ani [...] I to odmítli.“237
Der letzte Transport, wieder im Viehwaggon, spiegelt die erbärmliche Verfassung der
Gefangenen gegen Kriegsende wider. Unzählige Frauen sterben unterwegs, und Marta
234 „Am Neujahrsmorgen trieben sie uns hinaus, es war ein wunderschöner Tag, auf so eine große
Ebene, wo es viele Kiefern und andere Bäume gab, aber vor allem verschneite Kiefern. Alles voll
mit Schnee und strahlende Sonne. Wären wir nicht im Lager gewesen, wäre es ein wunderschöner
Tag in den Bergen gewesen.“ Dok. 1-7.
235 „Und da standen wir also an Neujahr, keine von uns wird das jemals vergessen, vollkommen ohne
alles, ohne Essen, ohne Trinken bis zum Abend.“ Ebenda.
236 Dok. 1-7. Beispielsweise geben sie den Jüdinnen Kartoffelschalen, was angesichts des Hungers eine
große Bereicherung war. Interessanterweise taucht das Themenfeld Essen in Martas Erzählung erst
ab Auschwitz auf, während es in den anderen Interviews bereits in Theresienstadt eines der
Hauptthemen ist. Das hat m.E. seine Ursache darin, daß Marta sehr wahrscheinlich in Theresienstadt
von ihrem Bruder, der in der Landwirtschaft arbeitete, mitversorgt wurde, weshalb sie nicht so
großen Hunger litt. Andererseits war sie aber im Gegensatz zu den anderen nicht selbst aktiv an der
Lebensmittelbeschaffung beteiligt, so daß es für ihre Biographie keine erwähnenswerte Erfahrung
ist, im Gegensatz zu später, wo jede verpaßte oder zusätzliche Essensration eine Frage von Leben
und Tod ist. Auch hier wird die Wechselwirkung zwischen historischer Realität, Erleben und
Erzählen wieder besonders augenscheinlich. Vgl. hierzu auch L.s Schilderungen über den letzten
Kriegswinter, Kap. 3.1.2.6.
237 „Die Tschechen in der Fabrik verhielten sich uns gegenüber am schlimmsten. Ich kann mich nicht
erinnern, daß uns irgendein Tscheche etwas gegeben hätte, wir haben sie sogar gebeten, ob sie uns
nicht irgendeinen [...] eine kleine Nachricht vermitteln könnten, wenn sie auf Urlaub nach Hause
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
67
erzählt, wie sie die Leichen in Decken wickeln und beim Umsteigen in einen anderen
Zug hinübertragen mußten, damit die Gesamtanzahl stimmte. Explizit erwähnt wird der
elende Zustand der Frauen jedoch erst im Zusammenhang mit der Ankunft in
Theresienstadt: „My jsme byly ten první transport nejubožejší, kterej se vrátil v
nejhorším stavu do Terezína.“238 Über ihre persönliche Verfassung verliert Marta kein
Wort, von ihrer Typhus-Erkrankung erfahren wir erst später in einem ganz anderen
Kontext. An die letzten Kriegswochen hat sie keine Erinnerung und weiß nicht mehr,
wie sie nach Prag zurückgekommen ist.
Als erstes Ereignis nach der Befreiung berichtet sie, daß sie vom Tod des Bruders erfuhr, was für sie, wie bereits zu vermuten, ein furchtbarer Schock war. Das Themenfeld
Familie, das den gesamten ersten Teil der Erzählung dominierte, wird wieder aufgenommen und zum Ende gebracht, womit sie auch die Erzählung beenden will. Alles wesentliche ist für sie gesagt. Sie schließt mit dem Satz: „ani půl slova jsem si
nevymyslela, bohužel je to tak, spíš jsem na hodně zapomněla.“239
Offensichtlich ist für sie das ,Zeugnis ablegen‘ von großer Bedeutung, weshalb sie
sich auch vor allem auf die Verfolgungszeit konzentriert hat, obwohl ich sie gebeten
habe, ihre gesamte Lebensgeschichte zu erzählen.
Bis zu diesem Punkt des Gesprächs läßt sich sagen, daß die größten Einschnitte in
ihrer Biographie zum einen der Einmarsch der Deutschen und die daraufhin einsetzende
Ausgrenzung aus der tschechischen Gesellschaft war, mit der sie sich bis dahin völlig
identifiziert hatte, und zum anderen die Deportation nach Auschwitz, die bereits durch
den Transport in Viehwaggons die bevorstehende Entmenschlichung ankündigte und
den endgültigen Verlust der Familie bedeutete, die vorher in der Erzählung eine sehr
große Rolle spielte. Auch zwei Erlebnisse in Auschwitz stehen noch in diesem Kontext.
Bis hier ist Martas Erzählung durchdrungen von der Perspektive der Gegenwart, die es
ihr nicht ermöglicht, das damalige Erleben ohne permanente Antizipation der Ermordung der Familie darzustellen. Erst nachdem ihre Eltern tot sind, konzentriert sie sich
auf ihr eigenes Schicksal, das bei der nun folgenden Schilderung der verschiedenen
Lageraufenthalte
allerdings
fast
die
ganze
Zeit
mit
dem
tschechischen
Häftlingskollektiv verschmilzt. Das ,Ich‘ taucht nur auf bei Erlebnissen, die sie allein
betrafen, wie ihre Gelbsucht oder der moralische Konflikt mit der Eßschale. Dominant
fahren oder so [...]. Auch das haben sie abgelehnt.“ Ebenda.
238 „Wir waren der erste, der elendste Transport, der im schlimmsten Zustand nach Theresienstadt zurückkehrte.“ Dok. 1-8. Vgl. historischer Überblick, Kap. 3.2.
68
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
ist in der zweiten Phase der KZ-Haft das Themenfeld Entmenschlichung. Die
Gegenwartsperspektive ist hierbei weniger deutlich präsent als vorher, zumindest was
die Vorwegnahme von Ereignissen angeht. Statt dessen wird aber häufig die
Perspektive der ,normalen‘ Welt eingenommen, mit der die unmenschlichen
Erfahrungen der KZ-Haft schwer zu vereinbaren sind, sei es bei moralischen
Konflikten, sei es angesichts der unvorstellbaren und daher schwer vermittelbaren
Haftbedingungen, deren Unerträglichkeit gerade durch den Perspektivwechsel
unterstrichen wird.240
Der Entmenschlichung steht immer wieder das Kollektiv der tschechischen Häftlingsfrauen entgegen. Werden sie auch von den Deutschen wie Vieh behandelt, so gelingt es
nach Martas Darstellung nicht, die zwischenmenschlichen Bindungen unter ihnen zu
zerbrechen.241
2.1.3. Nach 1945
Auf meine Frage, wie es weiterging, schließt Marta einen weiteren Erzählblock an. In
zweifacher Weise rückt das Themenfeld Familie wieder in den Mittelpunkt der Darstellung, und zwar einmal in Bezug auf ihre neu gegründete Familie, und zum anderen
hinsichtlich des Gedenkens an die ermordeten Angehörigen.
Zunächst beschreibt Marta ihre schlechte körperliche Verfassung (abgemagert und
ohne Haare), Einsamkeit und ihre Mittellosigkeit, und dann ihren Beschluß, den ersten
Juden, der ihr begegnet, zu heiraten, unbedingt einen Juden, da der als einziger verstehen könne, was sie durchgemacht hat. Außerdem ist sie ohne Wohnung und sucht jemanden, bei dem sie unterkommen kann. Tatsächlich lernt sie einen entsprechenden
Mann kennen, und sie beschließen zu heiraten, „bez veškeré lásky“,242 wie sie selbst
konstatiert. Doch scheinbar teilten sie denselben Wunsch: sie sehnten sich nach Normalität und einer Familie. Zwar fragt sie sich heute, ob es nicht egoistisch war, so kurz
nach all den traumatischen Erfahrungen ein Kind in die Welt zu setzen, ohne einen Gedanken an mögliche gesundheitliche Konsequenzen für das Baby zu verschwenden,
aber das Bedürfnis nach einem neuen Leben war in der damaligen Situation so groß,
239 „Nicht ein halbes Wort habe ich erfunden, leider ist es so, eher habe ich vieles vergessen.“ Ebenda.
240 Vgl. Fahrt nach Auschwitz, Kälte in Bergen-Belsen, die Gelbsucht oder den Neujahrs-Appell,
Dok. 1-4, 6, 7.
241 Sogar beim letzten Transport teilt die Freundin noch mit Marta das eroberte Essen.
242 „Ohne jegliche Liebe.“ Dok. 1-8.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
69
daß gar keine Zweifel aufkamen: „Dneska nevím, že bysme bývali se tou myšlenkou
zabývali. Prostě chtěli jsme žít, chtěli jsme rodinu.“243 Im folgenden schildert sie die
weiteren Stationen der Familiengründung und schließt diesen Erzählblock ab, indem sie
auf das Thema Entschädigung zu sprechen kommt, die zu ihrer großen Empörung bis
zum Vorjahr ausblieb.244 Damit spannt sie selbst den Bogen vom Neubeginn in die
Gegenwart, d.h. es kommt zu einer Deckung der erlebten und erzählten Ebene.
Von selbst beginnt sie zu erzählen, daß sie ihre Autobiographie geschrieben hat, sowie ein Buch über ihre Verwandten, mit Photos belegt,245 womit sie sich nun dem Thema Gedenken an die ermordeten Angehörigen zuwendet. Sie bilanziert selber: „Takže
víc už udělat nemůžu, aby děti věděly, z čeho pocházejí.“246 Hier klingt an, daß das
Zeugnisablegen eine Brücke zwischen den Toten und ihren heutigen Nachkommen
schlagen soll, d.h. Marta ist bemüht, die Erinnerung an ihre ermordete Familie an die
nächste Generation weiterzugeben, und zwar, wie die folgenden Passage zeigt, nicht nur
durch ihre Autobiographie, sondern auch durch die Vermittlung familiärer Werte aus
ihrem Elternhaus, die sich unter dem Begriff ,Familiensinn‘ zusammenfassen lassen:
„A moje děti jsou vychovaný asi tak jako já jsem byla, vyplatila se mi moje výchova,
protože myslím, že můžu prohlásit, že májí dobrou Kinderstube a pocit sounáležitosti k
rodině. A to jsem v nich vypěstovala já, protože jsem, ono to nepříjde samo od sebe, musí
proto člověk něco udělat a něco obětovat.“247
Allerdings ist zu fragen, ob diese überaus starke Bedeutung des ,Familiensinns‘ für
Marta nicht möglicherweise gerade im Zusammenhang mit der Verfolgung zu sehen ist
und der schmerzhafte Verlust der Angehörigen nun durch besonders intensive Hingabe
und Fürsorge für die neu gegründete Familie kompensiert wird.
243 „Heute kann ich mich nicht erinnern, daß uns dieser Gedanke damals beschäftigt hätte. Wir wollten
einfach leben, wollten eine Familie.“ Dok. 1-9.
244 „Žili jsme do teďka, měli si to nechat a strčit někam, protože je to ostuda všech ostud.“ „Wir haben
bis jetzt gelebt, sie hätten es behalten und sich sonstwohin stecken sollen, denn das ist die größte
Schande aller Zeiten.“ Ebenda.
245 Zu den Photos sagt sie, wie sehr sie darum von anderen Holocaust-Überlebenden beneidet wird, da
fast niemand über Erinnerungsstücke aus der Vorkriegszeit verfügt. Daß sie ihr erhalten geblieben
sind, verdankt sie ihrem ehemaligen nichtjüdischen Verlobten, der sie über den Krieg für sie aufbewahrte.
246 „Also mehr kann ich nicht machen, damit die Kinder wissen, woher sie stammen.“ Dok. 1-10.
247 „Und meine Kinder sind wohl so erzogen wie ich, meine Erziehung hat sich ausgezahlt, denn ich
denke, ich kann sagen, daß sie eine gute ,Kinderstube‘ und Familensinn haben. Und das habe ich ihnen vermittelt, weil, so etwas kommt nicht von selbst, dafür muß man etwas tun und gewisse Opfer
bringen.“ Ebenda.
70
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
2.1.4. Zusammenfassung
Abschließend läßt sich sagen, daß die Shoah Martas gesamte erzählte Lebensgeschichte
überschattet. Die Vorkriegszeit erscheint lediglich als Zeitraum der völligen Harmonie
und Unbeschwertheit vor der Katastrophe. Den größten Teil von Martas Erzählung
nimmt die Verfolgungserfahrung ein, die sich in zwei Themenblöcke aufteilt, einmal
den Verlust der Familie und zum anderen die durch die Nationalsozialisten erfahrene
Entrechtung und Entmenschlichung. Offensichtlich war es in diesem Gespräch ihr
Hauptanliegen, zum Gedenken an ihre ermordeten Verwandten die KZ-Zeit zu dokumentieren. Nach ihrem weiteren Leben gefragt, beschränkt sich Marta auf den familiären Bereich248 und schildert die gelungene Familiengründung, die für sie der einzige
Weg zurück ins Leben war. Denn da ihre gesamte Familie ausgelöscht wurde, gibt es
nichts, woran sie aus der Vorkriegszeit anknüpfen könnte, niemand ist übrig, mit dem
sie ihre Erinnerungen teilen kann. Insofern bleibt nur ein völliger Neuanfang mit jemandem, der die Erfahrungen der Verfolgungszeit selbst erlebt hat und sich daher in derselben Situation wie sie befindet. Martas Identität zerfällt in einen Teil, der zu der ermordeten Familie gehört, und einen Teil für die Zeit danach, wo sie versucht, diesen
Verlust durch die Fürsorge für die eigenen Kinder und die Aufrechterhaltung der Erinnerung zu überwinden. Man kann daher von einer zerbrochenen Identität sprechen, da
es nicht möglich ist, die Zeit vor und nach der Verfolgung in einen einheitlichen
Sinnzusammenhang zu bringen.
2.2. Soziale Identität
Wiederholt wurde darauf hingewiesen, daß sich Marta bis zur Okkupation durch die
Deutschen nicht als ,anders‘ empfand, daß also ihre jüdische Herkunft für sie vollkommen belanglos war. Vielmehr fühlte sie sich als patriotische Tschechin und hatte
einen nichtjüdischen Verlobten. ,Jüdischsein‘ war für sie daher eine Fremdzuschreibung, die von außen an sie herangetragen wurde, erstmals durch die antijüdischen
Bestimmungen ab 1939, durch das Vorurteil, Juden seien faul, oder als Schimpfwort
seitens der tschechischen Faschisten.
Auch im KZ fand von ihrer Seite keine Identifikation mit dem Judentum, sondern
vielmehr mit dem tschechischen Häftlingskollektiv statt.
248 Dabei war sie beispielsweise berufstätig, was wir nur durch die Bemerkung erfahren, daß sie seit der
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
71
Erst nach der Befreiung, als sie vor dem absoluten Nichts stand, wurde es plötzlich
für sie überlebenswichtig, einen jüdischen Ehepartner zu finden, da sie jemanden
brauchte, der ihre Verfolgungserfahrung teilen konnte, um überhaupt neu anfangen zu
können. Gleichzeitig war sie aber sehr bemüht, sich durch nichts von der tschechischen
Umgebung zu unterscheiden. So wurden die KZ-Erfahrungen von den Kindern ferngehalten und der deutsche Nachname in einen tschechischen geändert.249
Andererseits taucht in ihrer Schilderung der Nachkriegszeit mehrmals ein ,wir‘ der
Überlebenden, die Schicksalsgemeinschaft, auf – u.a. im Kontext mit der so lange ausgebliebenen Entschädigung -, und es stellt sich heraus, daß nicht nur ihr Mann, sondern
auch ihr Bekanntenkreis vorwiegend jüdisch ist, was darin zum Ausdruck kommt, daß
sie im Zusammenhang mit den Kindheitsphotographien von ,allen ihren Bekannten‘,
d.h. Holocaust-Überlebenden, spricht, die sie um diese Erinnerungsstücke beneiden.
Nicht nur Martas persönliche, auch ihre soziale Identität erfuhr durch den Holocaust
einen radikalen Bruch, da im Gegensatz zur Vorkriegszeit, als sie in gleichem Maße jüdische wie nichtjüdische Freunde und Bekannte hatte, nach 1945 aus dem Bedürfnis
nach Schicksalsgenossen vorrangig soziale Kontakte zu anderen Überlebenden entstehen, während nach außen hin nach wie vor eine völlige Assimilation angestrebt wird.
3. L.R.
3.1. Subjektive Sinnstruktur
3.1.1. Zeit vor der Verfolgung
Aus der Zeit vor der Verfolgung erinnert L. im Gegensatz zu Marta (und Eva) mehr als
nur ein paar biographische Daten, und zwar ihre ersten Schuljahre auf dem Land, wo sie
zunächst den katholischen Religionsunterricht besuchte, da in der kleinen Dorfschule
kein jüdischer Unterricht angeboten wurde. Ferner erwähnt sie ihre zahlreichen sportlichen Aktivitäten in Prag, insbesondere im tschechischen Turnverein Sokol.250 Wie
Marta stammt sie aus einer tschechisch-patriotischen Kaufmannsfamilie, in der die jüdische Religion eine marginale Rolle spielt.251 Die Tatsache, daß der katholische ReliZeit, als sie in Rente war, als Stadtführerin tätig war.
249 Vgl. historischer Überblick, Kap. 4.
250 Dok. 2-1.
251 Allerdings wird beides von L. erst durch ein Nachfragen meinerseits thematisiert, während Marta
von allein darauf zu sprechen kam. Vgl. Marta, Kap. 2.1.1.
72
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
gionsunterricht und ihr sportliches Engagement in der Darstellung verhältnismäßig viel
Raum einnehmen, weist darauf hin, daß beide Erfahrungen von großer Bedeutung für
L.s Biographie sind. Sie kündigen bereits das Bild an, das L. im folgenden von sich
selbst zeichnet: stets aktiv und engagiert, um das Beste aus der jeweiligen Situation zu
machen.252
3.1.2. Okkupation
Auch L. kommt sehr schnell auf die Okkupationszeit zu sprechen, die bei ihr ebenfalls
den größten Teil ihrer Erzählung einnimmt. Ihre Darstellung gliedert sich weniger in
Themenfelder als chronologisch, und zwar stets anhand der Stationen ihrer Lagerhaft.
Der Zeitraum der materiellen und sozialen Entrechtung ist bei ihr schwächer ausgebaut
als bei Marta, was vermuten läßt, daß sie ihn angesichts dessen, was danach kam, biographisch für weniger wichtig hält, zumal, wie sie sagt, über die Verbote ja bereits alles
allgemein bekannt sei.253 Insofern ist diese Phase überschattet von dem Endpunkt
Transport.
3.1.2.1. 1939-1942
Im Gegensatz zu Marta, die die soziale Ausgrenzung so ausführlich dargestellt und entsprechend darunter gelitten hat, war wohl für L. an ihren Arbeitsstätten der soziale
Druck nicht so stark, bzw. sie war nicht so exponiert wie die zur Zwangsarbeit eingesetzten Táborer Jüdinnen.
Mit dem ersten Arbeitgeber gab es zwar Probleme, aber erst dann, als L. und ihre
Cousine feststellten, daß er auch seine ,regulären‘ Angestellten ausbeutete und die beiden Jüdinnen sie davon überzeugten, ihn deshalb zur Rede zu stellen, woraufhin er die
Cousinen entließ. Auch hier zeigt sich L. wieder engagiert: auch wenn sie selbst ohne
Rechte ist, setzt sie sich für die Wahrung der Rechte der anderen ein. Der zweite Arbeitgeber hingegen war in ihren eigenen Worten ein „sehr sympathischer solider
252 Der katholische Religionsunterricht steht insofern in diesem Kontext, da er später bei L.s Emigrationsversuch eine wichtige Rolle spielt. Siehe weiter unten, Kap. 3.1.2.1.
253 Dok. 2-1. Ebenso wie bei Marta wird von L. als einzige der antijüdischen Maßnahmen der Umzug in
eine winzige Wohnung, d.h. die Verschlechterung des sozialen Status, hervorgehoben, was auch von
Jirka und etwas variiert von Eva thematisiert wird. Offenbar ist für alle das beengte Wohnen sinnbildlich für die erfahrene materielle wie soziale Einengung, da sie vorher zur gut situierten Mittelschicht gehörten.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
73
Mensch“.254 Offensichtlich waren L.s Erfahrungen mit dem tschechischen Umfeld
weniger enttäuschend.
Von biographischer Wichtigkeit war hingegen anscheinend ihr Emigrationsversuch.
Zu diesem Zwecke ließ sie sich taufen, wobei ihr der oben erwähnte katholische Religionsunterricht zugute kam. Doch dann verließ sie ihren nichtjüdischen Partner, mit
dem sie diesen Plan hatte verwirklichen wollen, und blieb zurück.255 In Anbetracht dessen, wie ausführlich die Taufe beschrieben wird, dahingegen eine Begründung für ihr
Zurückbleiben ausbleibt, ist zu vermuten, daß L. damit ihrem Selbstbild von einer aktiven, stets nach Lösungen strebenden Persönlichkeit entsprechen möchte, die alles in
ihrer Macht Stehende getan hat, um das Land zu verlassen und der sich anbahnenden
Katastrophe zu entgehen, dann aber persönliche Gründe den Plan vereitelten.
3.1.2.2. Theresienstadt
Daß die Verfolgung nicht nur die materielle und soziale, sondern auch die physische
Existenz bedroht, wird für L. und ihre Familie erstmals deutlich, als Anfang 1942 Nachrichten von Hinrichtungen aus Theresienstadt nach Prag dringen und sie um den bereits
deportierten Bruder bangen (was sich aber als gegenstandslos erweist). Somit steht Theresienstadt von Anfang an in einem tödlichen Kontext256 und markiert einen entsprechend radikalen Einschnitt in L.s Biographie. Die schrittweise Entmenschlichung,
die gegen Kriegsende in Bergen-Belsen gipfelt, nimmt hier ihren Anfang.
Den ersten Schock stellt für L. die Unterbringung im Sammellager dar: die Enge, das
Chaos zwischen all dem Gepäck, unzureichende Waschgelegenheiten, mit anderen
Worten der Verlust jeglicher Intimsphäre.
Hinzu kommt bei der Ankunft in Theresienstadt der Verlust des gesamten Gepäcks,
so daß den Neuankömmlingen nur das bleibt, was sie auf dem Leib tragen. Außerdem
wird die Familie auseinandergerissen, da der Vater getrennt untergebracht wird und das
Ghetto zu dem Zeitpunkt noch geschlossen ist. Trotzdem ergreift L. sofort wieder die
Initiative. Sie sucht sich Arbeit, um aus der Kaserne herauszukommen und das Terrain
zu erkunden. Und tatsächlich bringt ihr Engagement ihr Vorteile. Sie wird in der Land-
254 Dok. 2-2.
255 Dok. 2-1.
256 Marta hingegen macht die erste Erfahrung mit dem Tod im Zusammenhang mit der Vergeltungsaktion der Nationalsozialisten nach dem Attentat auf Heydrich, d.h.für sie setzt die Bedrohung
des Lebens schon vor dem Transport ein.
74
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
wirtschaft angestellt, wodurch sie im Gegensatz zu denjenigen, die auf die Verpflegung
im Ghetto angewiesen sind, an zusätzliche Nahrung herankommt. So unterstützt sie ihre
Familie und Freunde.257 Der Vater wiederum ermöglicht Frau und Tochter dank seines
Hausältestenpostens später den Umzug in sein separates Zimmer, so daß sich die Lage
nach dem ersten Entsetzen im Laufe der Zeit verbessert und ein gewisser Alltag einkehrt.258
In L.s Biographie nimmt Theresienstadt einen völlig anderen Stellenwert ein als bei
Marta. Die Deportation bedeutet einen massiven Einschnitt, da sie zunächst den Verlust
von Privatsphäre und sämtlichen Besitzes mit sich bringt. Nach einer gewissen Zeit
stellt sich aber eine gewisse Normalisierung des Lagerlebens ein, die hoffen läßt, so den
Krieg überleben zu können. Bei Marta hingegen erscheint die gesamte Zeitspanne in
Theresienstadt nur als Vorstufe vor der totalen Vernichtung, weshalb in ihrer Darstellung das Themenfeld Transportangst dominant ist, das bei L. gar nicht angesprochen
wird. Im Gegenteil, während Marta die Berufe und Privilegien der Verwandten nur
unter dem Gesichtspunkt des Transportschutzes thematisiert, stehen bei L. die sich
daraus ergebenden Vorteile im Lageralltag im Mittelpunkt. Es ist zu vermuten, daß ihre
Familienmitglieder ausnahmslos zum geschützten Personenkreis gehörten, was dann
auch erklärt, weshalb in ihrer Erzählung die Transportangst nicht auftaucht. Bei Marta
dominiert die erzählte Perspektive, bei L. hingegen die erlebte, in der man noch nicht
wußte, daß man machtlos der Vernichtungsmaschinerie ausgeliefert würde, sondern
versuchte, das Beste aus der gegenwärtigen Situation herauszuholen.259
3.1.2.3. Familienlager
Die Deportation nach Auschwitz-Birkenau in das sogenannte ,Familienlager‘ im Mai
1944260 setzt dem Theresienstädter Alltag ein jähes Ende und leitet eine weitere Steigerung der Entmenschlichung ein. Während die Familie im Ghetto noch eine gewisse
Privatsphäre genoß und sich mehr oder weniger unabhängig von den im Lager verteilten
Rationen ernähren konnte, wird in Zukunft beides nicht mehr möglich sein. Hinzu
kommt bald nach der Ankunft die Gewißheit über den Massenmord in den Gaskam-
257 Dok. 2-2.
258 Dok. 2-3.
259 So nahm L. auch aktiv am kulturellen Leben in Theresienstadt teil, sie sang in dem berühmten Chor
von Raffael Schächter.
260 Vgl. historischer Überblick, Kap. 3.2.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
75
mern, die jede Hoffnung, die Familie könnte gemeinsam überleben, zunichte macht.
Im Gegensatz zu Marta bleibt L. auch hier weitestgehend in der erlebten Perspektive,
so daß sich der Prozeß von der völligen Ahnungslosigkeit bezüglich des Bestimmungsortes bis hin zur schonungslosen Wahrheit sehr gut nachvollziehen läßt.
Auch L. ist völlig geschockt angesichts der Zustände im Viehwaggon, die alle bisher
gemachten negativen Erfahrungen um ein Vielfaches übertreffen, und hebt vor allem
den Verlust jeglicher Intimsphäre bei der Verrichtung der alltäglichen Bedürfnisse hervor.261
Bei der Ankunft versinkt sie im kollektiven ,wir‘ der Häftlinge und schildert das Entsetzen angesichts des Gebrülls und der neuen Umgebung, die die Neuankömmlinge
überhaupt nicht einordnen können:
„A viděli jsme dráty, to jsme viděli jen osvetlené dráty, nic jiného, to si člověk pomalu
nedovedl představit, co to je, kam jdeme.“262
Außerdem verfällt sie ins Präsens, was charakteristisch ist für die Textgattung des Erzählens, wenn die emotionale Betroffenheit besonders stark ist. Doch bald hebt sie sich
wieder vom Kollektiv ab und schildert ihre verschiedenen Versuche, auf die Situation
angemessen zu reagieren. Nach der Begegnung mit ihrer Cousine, die bereits früher im
Transport war und sie auffordert, ihr alle Habe zuzuwerfen, beginnt sie zu ahnen, daß
ihnen wieder alles weggenommen werden soll, weshalb sie Mittel und Wege sucht, das
zu verhindern. Ihr erster Versuch – sie vergräbt Bargeld – schlägt fehl, der zweite ist bereits erfolgreicher: Sie widersetzt sich den Anweisungen der Blockältesten, ihre Habe in
der Baracke zurückzulassen, da sie von einer Bekannten Rat eingeholt hat.
Auch weiterhin bleibt sie aktiv: sie stellt sich beim Tätowieren so an, daß sie eine
Zahl mit der Quersumme 13 erhält, welche sie für ihre persönliche Glückszahl hält, womit sie aus dieser erniedrigenden Erfahrung eine positive macht. Dann hört sie erstmals
Gerüchte über Gaskammern, geht ihnen auf den Grund und erfährt von einer privilegierten Bekannten die ganze Wahrheit:
„No, a já jsem potom snad tři dni probrečela zoufalstvím, že vlastně bezmocná musím jít
do plynu. No a teď jsem tam měla samozřejme bratra, rodiče, tetičku [...] a tím pádem jsem
261 Auch sie spricht in diesem Zusammenhang davon, wie unvorstellbar schrecklich die Situation war.
Vgl. Marta, Kap. 2.1.2.2.
262 „Und wir sahen Drähte, da sahen wir nur beleuchtete Drähte, nichts sonst, da konnte man sich langsam gar nicht mehr vorstellen, was das ist, wohin wir gehen.“ Dok. 2-4.
76
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
zjistila, že moje nejmilejší sestřenice, které tam byly v zářijovém transportu, už vlastně
nežijí.“263
Angesichts dieser Ohnmacht und Unausweichlichkeit des Todes kann sie nun nicht
mehr hoffen, durch ihr eigenes Handeln Einfluß auf die weitere Entwicklung zu nehmen. Stattdessen bemüht sie sich, den Lageraufenthalt wenigstens für diejenigen, die
am schwächsten und hilflosesten sind, so erträglich wie möglich zu machen: Sie arbeitet
im Kinderblock. In keinem anderen Zusammenhang ist die Vermischung der
Perspektiven in L.s Darstellung stärker als hier, denn sie kann nicht umhin zu sagen,
daß von all diesen Kindern keines mehr am Leben ist.264 Die Brutalität des Lageralltags
wird nirgends so deutlich wie hier, als L. von den Kindern und ihrem Verhalten
erzählt.265 Sie selbst kommentiert: „No, tam to bylo dost krutý, v Osvětimi.“266
Vom Lageralltag hat sie nur mehr das ständige Appellstehen, die überfüllten Baracken und den Hunger in Erinnerung.267
3.1.2.4. Auflösung des Familienlagers
Der nächste radikale Einschnitt in der erlebten wie in der erzählten Perspektive ist die
Auflösung des Familienlagers, die die Entmenschlichung noch mehr steigert.268
Erst jetzt wird deutlich, welchen Sonderstatus das Familienlager einnahm. Nun findet
erstmals eine Selektion statt, die L.s Familie auseinanderreißt, und im Gegensatz zu den
Neuankömmlingen an der Rampe, die noch nicht wissen, was mit den ,Nichtarbeitsfähigen‘ geschieht, ist für L. klar, daß die Ausgemusterten keine Überlebenschance haben, auch wenn sie diesen Umstand nicht direkt artikuliert. Der Bruder fährt zum
263 „Na, und dann habe ich wohl drei Tage durchgeweint vor Verzweiflung, daß ich machtlos ins Gas
gehen muß. Und jetzt hatte ich da natürlich meinen Bruder, meine Eltern, meine Tante [...], und so
fand ich heraus, daß meine Lieblingscousinen, die im Septembertransport gewesen waren, schon
nicht mehr am Leben waren.“ Dok. 2-5. Zum Schicksal des Septembertransports vgl. historischer
Überblick, Kap. 3.2.
264 Im Gegensatz zu Marta und Eva nimmt L. den Tod ihres Vaters nie vorweg, vgl. weiter, Kap.
3.1.2.7.
265 Ein Junge schreit jedesmal beim Anblick von einem SS-Mann: „der hat meinen Vater umgebracht.“
Wenn die Kinder vor dem Block ,spielen‘, hat L. Angst, jemand könnte ihnen aus dem Nebenlager
Essen zuwerfen und die Kinder dadurch zu nah an den elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun
kommen. Vgl. Dok. 2-5.
266 „Ja, es war ziemlich hart in Auschwitz.“ Ebenda.
267 „Tam byl strašnej hlad, tam neměl člověk už nic, kde by prišel k nějákemu jídlu.“ „Dort herrschte
schrecklicher Hunger, dort hatte man keine Möglichkeit mehr, irgendwo an Essen heranzukommen.“
Dok. 2-5. Hier kommt noch einmal die aufgezwungene Passivität zum Ausdruck. Nicht nur, daß
inzwischen klar geworden ist, daß sie alle zum Tode verurteilt sind, sondern zudem können auch im
Lageralltag durch Eigeninitiative keine zusätzlichen Lebensmittel mehr beschafft werden.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
77
Arbeitseinsatz ins Unbekannte, Mutter und Tochter werden zusammen weiterdeportiert,
der Vater, schon über sechzig, bleibt allein zurück.
Es ist anzunehmen, daß der Verlust des Vaters für L. eine der traumatischsten Erfahrungen der Shoah ist, da sie seine Ermordung im ganzen Text kein einziges Mal
erwähnt, während sie ansonsten sehr ausführlich und detailliert erzählt. Das zeigt sich
besonders deutlich in der Darstellung des Abschieds, bei der L. nur davon spricht, daß
sie „selbstverständlich“269 weinte, und sich dadurch schmerzhafte Erklärungen erspart.
Exkurs
Während bei den anderen Interviewpartnern die Vermischung der Perspektiven ein eindeutiger Indikator für biographisch bedeutsame Momente ist, bedient sich L. in ihrer
Darstellung eines anderen Mittels, denn sie bleibt, wie bereits mehrfach erwähnt wurde,
überwiegend in der erlebten Perspektive: Das eben zitierte „selbstverständlich“ (bzw.
tschechisch: „samozřejmě“) zieht sich durch den gesamten Text, und zwar taucht es immer dann auf, wenn etwas für die damalige Lebenswelt L.s Erwartungsgemäßes und daher in sich Logisches beschrieben wird. „Samozřejmě“ steht für die natürliche Alltagserfahrung, die für nicht weiter erklärungsbedürftig gehalten wird, da sie im gegebenen
sozialen Kontext allgemeiner Konsens ist.270 Daher ist dieser Begriff im gesamtem Text
ein Indikator dafür, wie der Zusammenbruch der Normalität ersetzt wird durch das
neue, unmenschliche System der Lagerwelt, das seine eigenen Regeln hat, die
allmählich zur alltäglichen Erfahrung werden. Dadurch, daß L. durch die Verwendung
des Ausdrucks „samozřejmě“ im jeweiligen ,Alltagswissen‘ bekannte Tatsachen
referiert, erspart sie sich häufig genauere Erklärungen ihrer Ausführungen.271
Auf der anderen Seite zeigt das Fehlen dieses Begriffs Umbruchsituationen, gänzlich
neue Erfahrungen, an, die das bisherige Alltagswissen übersteigen, wie etwa die erste
Fahrt im Viehwaggon und die Ankunft im Familienlager, bevor eine ,Gewöhnung‘ an
die Lagerroutine erfolgt.272
268 Vgl. historischer Überblick, Kap. 3.2.
269 Dok. 2-6.
270 Vgl. hierzu SCHÜTZ, ALFRED Die mannigfaltigen Wirklichkeiten, in: Gesammelte Aufsätze I, S.
237-298.
271 Und zwar ist die Verwendung dieses Stilmittels nicht beschränkt auf die Verfolgungszeit. Als sie
beispielsweise in der Episode mit dem deutschsprachigen Kindergarten (Dok. 2-1) erzählt, daß ihr
Vater „selbstverständlich“ dagegen war, daß das Kind anschließend auch eine deutsche Schule besuche, ohne zu sagen, warum, spiegelt sich darin wohl die in ihrem Umfeld verbreitete Grundhaltung von patriotischen tschechisch assimilierten Juden.
272 „Selbstverständlich“ für die Lagerwelt ist, daß man sehr früh geweckt wird, Appelle stehen muß, zu
78
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
3.1.2.5. Deportation nach Hamburg
Einen weiteren Verlust der Menschlichkeit bedeutet die an die Lagerauflösung anknüpfende Prozedur, der jeder ,arbeitsfähige‘ Häftling sonst direkt nach der Ankunft unterzogen
wurde,
nämlich
die
Ganzkörperrasur
und
der
Erhalt
neuer,
völlig
unangemessener Kleidung. Ab jetzt ist L. wirklich jeglichen persönlichen Besitzes
beraubt, und für kurze Zeit, bei der Schilderung der Fahrt im Viehwaggon, fällt sie
angesichts der allgemeinen Unsicherheit in Bezug auf das weitere Schicksal wieder ins
kollektive ,wir‘: „neměly jsme vůbec nic, absolutně nic. A tam jsme nevěděly, kam
jedem.“273
Doch im Gegensatz zu Marta, die seit der Selektion in Auschwitz ganz ohne Angehörige ist, ist L. mit ihrer Mutter zusammen, weshalb ihr persönliches Schicksal sich immer wieder von dem des Kollektivs abhebt, insbesondere auf dieser Zugfahrt, als L.s
von Krankheit geschwächte Mutter den Eimer für die Notdurft umkippt und L. nicht
einmal die Cousine bei der Reinigung des Waggons beisteht.
3.1.2.6. Zwangsarbeit
Die nun anschließende Schilderung der Zwangsarbeit hat zwei thematische Schwerpunkte: zum einen die tödliche Bedrohung durch Bombenangriffe, zum anderen Hunger
und Kälte und damit zusammenhängende soziale Kontakte und Begebenheiten, die zu
zusätzlicher Nahrung oder Kleidung führten.
Die erste zusätzliche Einnahmequelle waren Kontakte zu Zwangsarbeitern in den Fabriken, bei den Räumungsarbeiten in Hamburg dann auch zur zivilen Bevölkerung oder
schlicht und ergreifend zufällige Funde (auf Müllkippen, in den Ruinen usw.). Wenn es
sich um Entdeckungen aufgrund von Eigeninitiative handelt, wie etwa das Suchen von
Essensresten auf den Müllkippen, so wird der Fund zwischen Mutter und Tochter
aufgeteilt. Hilfe von außen oder Zufallsfunde bei der Arbeit hingegen kommen allen
Häftlingen zugute (wie etwa die Kartoffeln, der Laib Brot, das Fallobst, die Pilzsuppe).
den ,Arbeitsfähigen‘ gehören will, usw. Vgl. die Parallele bei der Deportation nach Theresienstadt:
„Selbstverständlich“ war, daß man zuerst zum Messepalast ging, der allgemein als Sammelplatz
bekannt war. Neu hingegen, und damit auch schockierend, waren die Zustände im Messepalast, die
Ankunft in Theresienstadt ohne jegliches Gepäck, die Unterbringung in überfüllten Kasernen. Doch
man lebte sich ein, und die alltägliche Lagererfahrung ersetzte die Maßstäbe des ,normalen‘ Lebens,
so daß es „selbstverständlich“ war, daß es nur kaltes Wasser zum Waschen gab und daß die Lebensmittelrationen völlig unzureichend waren.
273 „Wir hatten nichts, absolut nichts. Und wir wußten dort nicht, wohin wir fuhren.“ Dok 2-6.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
79
Stärker als vorher ist hier das kollektive ,wir‘ vorhanden.274
Entsprechend schlimm ist für L. die Verlegung in ein anderes Lager (Tiefstack), wo
keine Kontakte zur Außenwelt mehr möglich und die Gefangenen von den dürftigen
Lagerrationen abhängig sind.
Was die Bombenangriffe betrifft, so spielen sie für L. eine zentrale Rolle, da sie, dem
Vernichtungslager entronnen, eine neue permanente Lebensgefahr bedeuten. Bei einem
Angriff wird Tiefstack getroffen und L. entgeht nur knapp dem Tod.275
3.1.2.7. Bergen-Belsen
Die schrittweise Entmenschlichung findet in Bergen-Belsen ihren absoluten Höhepunkt,
da die Zustände dort mit keiner früheren Erfahrung vergleichbar sind. Dies wird auch
dadurch deutlich, daß hier das „samozřejmě“ nicht mehr auftaucht. L.s erste Eindrücke
von dort sind bewegungslose Körper am Wegesrand276 und ein Berg Schuhe, was L. sicherlich nichts Gutes ahnen ließ. Die Begegnung mit Bekannten im Lager bestätigt diesen ersten Eindruck: „A říkaly nám, že to tam je strašný, že za prvé se nic nedělá, že
jsou tam vši, že je tam hlad.“277 Die erste Unterkunft ist so überfüllt, daß man wie „Sardinen“278 geschichtet liegt, während es in der zweiten überhaupt kein Wasser gibt. Diese
letzten Wochen sind nurmehr ein einziges Dahinvegetieren: „tam jsme tedy vegetovaly
[...]“.279
Trotzdem will L. sich nicht einfach den Umständen ergeben, oder sie bemüht sich
zumindest in der Darstellung um diesen Eindruck, und schildert, wie sie sich aktiv um
Arbeit bemüht:
„Teď já jsem se snažila vždycky dostat někam, kde se dělá, protože jsem věděla, když
někde budu něco dělat, že třeba k něčemu příjdu.“280
274 Dok. 2-7f.
275 Dok. 2-9.
276 „Šly jsme a videly jsme cestou, jak támhle někdo leží, támhle někdo leží, jestli byli živí nebo mrtví,
to jsem nezaznamenala.“ „Wir gingen und sahen unterwegs, wie da jemand lag, dort jemand lag, ob
sie tot oder lebendig waren, konnte ich nicht feststellen.“ Dok. 2-9.
277 „Und sie sagten uns, daß es dort schrecklich ist, erstens würde man nichts tun, es gebe Läuse und
herrsche Hunger.“ Ebenda.
278 Ebenda.
279 „Dort vegetierten wir also [...].“ Dok. 2-10.
280 „Ich habe mich ja immer bemüht, irgendwohin zu kommen, wo man arbeiten kann, weil ich wußte,
wenn ich irgendwo arbeite, komme ich vielleicht zu was.“ Dok. 2-9. Das einzige allerdings, was sie
noch vor der Befreiung findet, sind Medikamente, was sie mit ihnen tat, wird nicht näher
80
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
In erster Linie bedeutet die Arbeit aber eine weitere Begegnung mit dem Tod, denn sie
sieht, wie Häftlinge Leichen die Straße entlangschleifen und in ein Massengrab werfen:
„To bylo něco príšernýho, když to člověk zjistil, že to je vlastně člověk.“281 Die zweimalige Verwendung des Begriffs ,Mensch‘ in diesem Satz ist sicherlich kein Zufall.
Einmal meint sie damit sich, das andere Mal die Toten, und wehrt sich damit gegen die
sie umgebende Unmenschlichkeit.
Die Ankunft der Engländer bringt zwar die Befreiung, aber zunächst keine konkreten
Veränderungen, da das Lager unter Quarantäne gestellt wird. Die Todesgefahr ist noch
nicht gebannt, denn eine Typhusepidemie hat sich ausgebreitet, und die Engländer tragen ungewollt zu weiteren Todesfällen bei, da die ausgehungerten Häftlinge die von
den Befreiern ausgeteilten Lebensmittel häufig nicht vertragen.
L. schildert ihr Entsetzen über die Zustände auf der Krankenstation und ihren erfolglosen Versuch, Wasser für die Kranken zu organisieren. Doch immerhin zahlen sich
ihre Streifzüge durch das befreite Lager aus. Sie findet Kleidung und Wäsche für sich,
ihre Mutter und eine Freundin. Ihr Engagement ist also endlich wieder erfolgreich und
bringt nicht nur ihr, sondern auch ihren Nächsten Erleichterung. Später, als sie erfährt,
daß ihr Bruder am Leben ist, pflückt sie in den Wäldern Heidelbeeren, die sie gegen
Zigaretten tauscht, um sie ihm mitbringen zu können.
Trotz der Entlausung und dem Umzug in andere Unterkünfte erkrankt L. schließlich
auch an Typhus, weshalb sie das Lager bis Anfang Juli nicht verlassen kann.
Offensichtlich mißfällt ihr ihre erneute Passivität in der gerade wieder gewonnenen
Freiheit sehr: „To už tady byla revoluce, to už tady byl konec, ale já jsem ještě byla v
Belsenu.“282
Zusammenfassend läßt sich über L.s Darstellung der Verfolgungszeit sagen, daß zu
den Themenfeldern Familie und Entmenschlichung, die Martas Erzählung dominieren,
bei L. ein weiteres hinzukommt, nämlich ihr stetiges Bemühen um eine Verbesserung
der Lage (Eigeninitiative). Deshalb bleibt sie auch vorwiegend in der erlebten Perspektive und nimmt die weitere Entwicklung seltener vorweg. Die Verfolgung beginnt für
sie wie für Marta mit dem Einmarsch der Deutschen, doch den Hauptteil ihrer Erzählung stellt ihre KZ-Haft, ein Prozeß der schrittweisen Entmenschlichung, dar, die mit
geschildert.
281 „Das war schrecklich, wenn man (tschech. Mensch) feststellte, daß das eigentlich ein Mensch ist.“
Dok. 2-9.
282 „Da war schon die Revolution [in Prag, Anm. H.S.], da war schon das Ende da, aber ich war immer
noch in Belsen.“ Dok. 2-10.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
81
dem Transport nach Theresienstadt beginnt und in Bergen-Belsen endet. Dank der Perspektive des damaligen Erlebens können die einzelnen Umbruchsituationen und die
zwischenzeitliche ,Gewöhnung‘ an einzelne Etappen sehr gut nachvollzogen werden.
Die einschneidendsten Erfahrungen waren sicherlich zum einen der Moment, als sie von
dem sich vor ihren Augen vollziehenden Massenmord an ihrer ,Rasse‘ erfuhr und somit
die Absichten des Nazi-Regimes offenlagen, und zum anderen die letzten Wochen in
Bergen-Belsen, wo der Tod ebenso allgegenwärtig war wie in Auschwitz.
Das Wissen um den Ausgang des Krieges ist natürlich trotzdem in ihrer Erzählung
präsent und prägt unbewußt die Darstellung. Da außer ihr auch Mutter und Bruder überlebt haben, ist das Themenfeld Familie weniger zentral als bei Marta und wird von den
Themenfeldern Entmenschlichung und Eigeninitiative überlagert.283 Die Ermordung des
Vaters dagegen wird nie direkt ausgesprochen, was vermuten läßt, daß sein Verlust für
sie eine Erfahrung ist, die noch immer sehr schmerzhaft ist.
Während Marta der Entmenschlichung immer wieder die Solidarität der tschechischen Häftlingsfrauen entgegensetzt, wehrt sich L. gegen die sie umgebende
Unmenschlichkeit durch aktive Bemühungen, ihr Los und das der ihr nahestehenden
Personen zu verbessern, weshalb sie wesentlich häufiger als Marta in der ersten Person
Singular erzählt.
3.1.3. Nach 1945
Das vorrangigste Problem nach der Rückkehr aus dem Lager ist das Fehlen einer
Wohnung (ausführlich schildert L. die Wohnungssuche ihrer Mutter und die Umstände,
die zur Rückgabe der Wohnung ihres späteren Mannes führten) und die völlige Mittellosigkeit.
L. selbst verläßt Prag bald wieder, um in einer Fabrik im Grenzgebiet zu arbeiten. Sie
nennt zwar keine Gründe dafür, aber angesichts dessen, wie zentral für sie ihrer eigenen
Darstellung nach im Leben das Arbeiten bzw. permanentes Engagement ist, kann man
vermuten, daß sie auch jetzt wieder selbst aktiv werden wollte, um neu anzufangen und
zumindest die materielle Not zu beheben. Auch nach ihrer zweiten Rückkehr nach Prag
schildert sie als erstes, wie und wo sie dort eine Arbeit findet. Erst dann kommt sie auf
ihren zukünftigen Mann und die Familiengründung zu sprechen. Die ersten Jahre sind
283 Allerdings wird durch die Eigeninitiative meist wiederum versucht, die Lage von Familienangehörigen oder Freunden zu verbessern, sie ist also kein Zug von Egoismus, sondern von Fürsorge.
82
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
nicht einfach, da sie nur vom Gehalt des Mannes leben, solange die Kinder klein sind.
Aber später beginnt L. gegen den Widerstand ihres Mannes wieder zu arbeiten, um zum
Lebensunterhalt der Familie beizutragen.
Ein weiterer Einschnitt in ihrer Biographie ist die tödliche Erkrankung ihres Mannes
gerade zu einem Zeitpunkt, „als wir aus dem Schlimmsten heraus waren.“284 Dadurch
gerät die Familie erneut in finanzielle Nöte, und die Tochter muß ihren Wunsch zu studieren aufgeben und stattdessen arbeiten gehen. L. ist überzeugt, daß die Krankheit
ihres Mannes eine Spätfolge seiner KZ-Haft ist, womit die Shoah ein weiteres Mal
massiv ihr Leben beeinflußt.
Über die weitere Familiengeschichte bis zur Geburt ihres Urenkels spannt sie den Bogen zur Gegenwart und kommt ebenfalls auf die so lange ausgebliebene Entschädigung
zu sprechen, die ihr jetzt, in ihrem hohen Alter, nur noch wenig nütze.
Auch nach dem Krieg bleiben also die gleichen Themenfelder dominant: Fürsorge für
die Familie, und zu diesem Zwecke persönliche Initiative auf der einen Seite, und die
Erfahrung des Holocaust auf der anderen Seite.
3.1.4. Zusammenfassung
Auch L.s erzählte Lebensgeschichte ist also von der Shoah dominiert, doch im Gegensatz zu Marta kann L. nach dem Krieg an die Zeit vor der Verfolgung anknüpfen, da sie
nicht vollkommen allein dasteht. So gelingt es ihr, ein einheitliches Bild ihrer Persönlichkeit zu entwerfen und Vor- und Nachkriegszeit in einen Sinnzusammenhang zu
bringen, basierend auf der Verfolgungserfahrung,285 sich niemals auf andere zu verlassen, sondern stets durch das eigene Handeln das Beste aus der jeweiligen Situation zu
machen. Die beiden wesentlichen Erlebnisse aus der Vorkriegszeit – katholischer Religionsunterricht und sportliches Engagement – stehen ebenso in diesem biographischen
Kontext wie die Tatsache, daß sie nach dem Krieg als erstes zu arbeiten beginnt und
sich später gegen den Willen ihres Mannes mit ihrem Arbeitswunsch durchsetzt, um die
finanzielle Lage der Familie zu verbessern. Auch die Darstellung der KZ-Haft ist im
wesentlichen vom Themenfeld Eigeninitiative geprägt, das der zunehmenden Entmenschlichung mehr oder weniger erfolgreich entgegengesetzt wird. Die trauma-
284 „když jsme se z toho nejhoršího dostali.“ Dok. 2-12.
285 Und hierher gehört ihrer eigenen Interpretation nach auch der frühe Tod ihres Mannes, durch den
die Familie über zwanzig Jahre nach Kriegsende noch einmal durch den Holocaust in existentielle
Bedrängnis gerät.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
83
tischsten Erfahrungen sind daher vermutlich diejenigen, die sie zu völliger Passivität
zwingen und keine Handlungsmöglichkeiten mehr bieten, wie das Schicksal des Vaters
und der anderen ,Arbeitsunfähigen‘ in Birkenau (was sie wohl deshalb nicht artikuliert),
das Angewiesensein auf die Essensrationen im Lager in Ermangelung anderer
Nahrungsquellen und schließlich das Massensterben in Bergen-Belsen, wo ihre Handlungsversuche erfolglos bleiben.
3.2. Soziale Identität
Auch L. sieht sich vorrangig als Tschechin. Noch stärker als bei Marta fällt auf, daß sie
die Bezeichnung ,Jude‘ oder ,jüdisch‘ nie verwendet, mit Ausnahme der Erwähnung des
Besuchs des jüdischen Religionsunterrichts ab der dritten Klasse, was aber auch so gedeutet werden kann, daß die Religion eine so geringe Rolle in ihrem Elternhaus spielte,
daß niemand daran Anstoß nahm, das Kind in den ersten Schuljahren in den katholischen Unterricht zu schicken. Vielmehr taucht ,Jude‘ nur als Schimpfwort seitens
eines deutschen Aufsehers auf, der die Häftlinge als „Saujuden“286 beschimpft, d.h auch
für L. ist ,Judesein‘ etwas von außen Aufgezwungenes, das für die Definition ihrer
selbst bis zur Verfolgung keine Rolle gespielt hat. Im Gegenteil war sie im tschechischnationalen Turnverein Sokol aktiv und wuchs, wie bereits erwähnt wurde, in einem
tschechisch-patriotischen Haushalt auf.
Es ist denn auch gewiß kein Zufall, daß nach der Befreiung, noch bevor sie zurückkehrt, ihre Identifikation mit der tschechischen Nation zweimal angedeutet wird:
Einmal erklärt sie hier das ,wir‘: ,my‘ „z Čech“,287 und zum anderen nimmt sie Bezug
auf die Prager Revolution,288 die, historisch wie auch immer einzuordnen, die aktive
Zurwehrsetzung des tschechischen Volkes gegen die deutsche Besatzungsmacht
symbolisiert.
Nach 1945 heiratet sie ebenfalls einen jüdischen Holocaust-Überlebenden. Aber sie
erwähnt diese nicht unerhebliche Tatsache erst auf ein Nachfragen meinerseits, und
auch hier fällt der Ausdruck ,Jude‘ nicht, vielmehr beginne ich die Frage: „Váš manžel
taky byl...?“, woraufhin sie sofort ergänzt: „Můj manžel, ano“,289 und dann die
Stationen seiner Lagerhaft aufzählt.
286
287
288
289
84
Dok. 2-7.
,wir‘ „aus Böhmen“. Dok. 2-11.
Ebenda.
„Ihr Mann war auch [...]?“ „Mein Mann, ja.“ Dok. 2-12.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Auch wenn sie nicht wie Marta explizit erklärt, warum sie einen Überlebenden geheiratet hat, so ist doch zu vermuten, daß es ähnliche Gründe waren. Außerdem taucht
auch in ihrer Erzählung ein ,wir‘ der Überlebenden auf, als sie sich über die so lange
ausgebliebenen Entschädigungszahlungen empört.
Das ,Jüdischsein‘ ist also für sie kein freiwilliger, positiver Bestandteil ihrer Identität,
sondern nur mit der Verfolgungserfahrung verknüpft, die sie in ihrem weiteren Leben
für immer mit den anderen jüdischen KZ-Überlebenden verbindet.
4. Eva R.
4.1. Subjektive Sinnstruktur
4.1.1. Zeit vor der Verfolgung
Über die Zeit vor der Verfolgung sagt Eva nicht mehr als Marta, sie beschränkt sich auf
die Angabe des Geburtsjahrs- und orts und betont, „ganz normal“ gelebt zu haben, verwöhnt, „in einem hübschen Haus“ mit vielen Freunden, „jüdische[n] und deutsche[n]“.290 Offensichtlich ist auch für Eva in diesem Kontext nur wichtig, die
ungetrübte Kindheit, in der es keine Unterschiede gab, im Gegensatz zu der weiteren
Entwicklung hervorzuheben.
4.1.2. Erste Diskriminierungen und Flucht
Nach dieser kurzen Einleitung beginnt sie bereits mit der Schilderung der ersten antisemitischen Erfahrungen, die für sie, im Sudetengebiet aufwachsend, wesentlich früher
einsetzen als für die beiden tschechischen Jüdinnen, nämlich schon im Frühjahr 1938.
Unter dem Einfluß des nationalsozialistischen Deutschlands291 radikalisieren sich auch
die Sudetendeutschen, und es kommt zu judenfeindlichen Demonstrationen.292
Nach den Sommerferien 1938 erlebt Eva die erste soziale Ausgrenzung: In der Schule
werden sie und ihre jüdischen Mitschüler gezwungen, separat zu sitzen, und langjährige
Schulfreundinnnen wenden sich von ihnen ab: „Wir waren auf einmal wie Aus-
290 Dok. 3-1.
291 „Der Hitler hat ja hie und da ein paar Reden gehalten.“ Ebenda.
292 „nach diesen Reden sind die Leute durch die Straßen gegangen und haben gebrüllt: ,Juden raus‘.“
Ebenda. Vgl. historischer Überblick, Kap. 1, sowie Anm. 97.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
85
sätzige.“293 Eva versucht, dieses Verhalten zu erklären, als ob sie sich heute noch
einmal trösten wollte: „Das war die Propaganda, ich glaube, das war nicht aus ihrem
Kopf.“294 Als die Lage immer bedrohlicher wird und die ersten Scheiben eingeworfen
werden, ergreift die Familie die Flucht nach Prag, zunächst Mutter, Tochter und
Großmutter, die Männer (Vater und Onkel) folgen wenig später. Eva, die ihren Worten
nach regelmäßig weinend aus der Schule nach Hause kommt, ist trotz der allgemeinen
Bestürzung zunächst sehr glücklich über diesen Entschluß, zumal es heißt, vorerst wolle
man nur ein paar Tage wegbleiben, bis sich die Lage wieder beruhigt.
Die erste Freude wird sehr bald getrübt, als Eva feststellen muß, daß sie, ohne es zu
merken, über Nacht zu mittellosen Flüchtlingen geworden sind. Auch in Prag sind sie
sozial isoliert, denn angesichts der Emigrantenströme, verstärkt noch durch das Münchner Abkommen, sind sie nicht sehr willkommen:
„Wir haben den Boden unter den Füßen verloren, wir wußten nicht, wohin wir gehören.
Hier war die Situation so, hier waren viele Flüchtlinge, die Tschechen waren auch nicht
sehr begeistert von uns.“295
Mit der Flucht vollzieht sich für Eva auf einen Schlag der völlige Zusammenbruch der
Normalität, den die Juden in den tschechischen Gebieten erst mit der schrittweisen Entrechtung durch die Nationalsozialisten erleben.
Eva freundet sich schließlich mit einem jungen tschechischen Juden an, der ihr Verlobter wird. Dies befreit sie ein wenig aus der Isolation, da er gebürtiger Prager ist und
sie in seine Familie integriert. Dennoch ist die Lage anscheinend so bedrückend, daß sie
zusammen emigrieren wollen, doch nur ihm gelingt es, eine Woche nach der Okkupation nach England auszureisen.
Sie schildert, wie er sich erfolglos bemühte,296 auch ihr und seiner Familie zur Ausreise zu verhelfen, und nimmt in diesem Kontext die Ermordung ihrer und seiner Verwandten vorweg. Die Vermischung der erlebten mit der heutigen Perspektive ist auch
hier wieder ein Indikator für besonders gravierende biographische Momente,297 ganz
gleich, ob sie bereits zum Zeitpunkt des Erlebens oder erst in der späteren Deutung von
293
294
295
296
297
86
Ebenda.
Ebenda.
Dok. 3-1. Vgl. auch historischer Überblick, Kap. 2.
Zu den Emigrationsbedingungen siehe historischer Überblick, Kap. 3.1.3.
Wie bereits vorher die Flucht aus ihrer Heimatstadt: „Wir sind nie mehr zurückgekommen.“
Dok. 3-1.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
großer Tragweite waren. So ist die mißglückte Emigration zwar sicherlich auch zum
Zeitpunkt des Erlebens tragisch gewesen, dennoch ist die tödliche Konsequenz dieses
Faktums und ihr Ausmaß für Evas Biographie eine nachträgliche Interpretation.
Als jedoch Evas Großmutter einen Tag nach der Abreise des Verlobten Selbstmord
begeht298 und die spätere Entwicklung, die für die Großmutter wesentlich qualvoller gewesen wäre, antizipiert wird, verhält es sich genau andersherum. Dieses Erlebnis ist
ohne Zweifel ein großer Schock für die Familie, aber die Vorstellung, was sich die
Großmutter damit erspart hat, ist im nachhinein tröstlich.
Im Vergleich mit den anderen biographischen Erzählungen fällt hier auf, daß die
Okkupation und die damit zusammenhängenden antijüdischen Maßnahmen von Eva gar
nicht thematisiert werden. Der deutsche Einmarsch wird lediglich im Zusammenhang
mit der erschwerten Emigration erwähnt, desweiteren ist vor der Deportation nach Theresienstadt neben dem Selbstmord der Großmutter nur noch die Tuberkulose-Erkrankung des Vaters geschildert, die zur Folge hat, daß zunächst nur Mutter, Tochter und
Onkel (als Freiwilliger, um bei den Frauen zu sein) deportiert werden.299 Diese völlige
Vernachlässigung der antisemitischen Verbote läßt vermuten, daß sie biographisch für
Eva keine gravierende Verschlechterung mehr mit sich brachten, da sie ohnehin als
Flüchtling bereits alles verloren hatte.
4.1.3. Theresienstadt
Erst der Transport nach Theresienstadt bringt einen weiteren radikalen Einschnitt. Die
Familie wird auseinandergerissen, der Vater bleibt zurück, der Onkel wird von den
Frauen getrennt untergebracht, und da das Ghetto noch geschlossen ist, können sie ihn
nicht einmal verabschieden, als er drei Monate später weitertransportiert wird. Auch
hier vermischen sich wieder die Perspektiven, die Willkür des Lagers setzt die
,normale‘ Erfahrung des Alltags außer Kraft, daß sich Familienangehörige in der Not,
insbesondere Männer ,schutzlosen‘ Frauen, beistehen können.
Die Darstellung der Lagererfahrung in Theresienstadt gliedert sich für Eva in drei
Phasen, die durch zwei einschneidende biographische Erlebnisse bestimmt werden:
Evas Verhaftung und den Transport ihrer Eltern.
298 In der Zweiten Republik wurde ein Anstieg jüdischer Selbstmorde verzeichnet, vgl. historischer
Überblick, Kap. 2.
299 Auch hier vermischen sich wieder erlebte und erzählte Perspektive, als Eva angibt, daß der Vater bis
1942 im Krankenhaus liegt. Vgl. Dok. 3-3.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
87
4.1.3.1. ,Eingewöhnung‘
Eva beginnt mit der Schilderung des Lageralltags. Zentrale Themen sind wie auch bei
L. die Arbeit in der Landwirtschaft und damit zusammenhängend die Beschaffung von
zusätzlichen Lebensmitteln, um die Familie zu ernähren, die nach und nach vollzählig
versammelt ist. Auch wird das Gefühl der Unfreiheit durch den Arbeitseinsatz
außerhalb des Ghettos gelindert. Nach dem Schock der ersten Monate gewöhnt man
sich ein und schöpft neue Hoffnung:
„Aber, irgendwie war man jung und man hat geglaubt, irgendwie wird man das überleben.
Damals hat man von Polentransporten keine Ahnung, wohin die gehen und wie die Leute
dort leben, das wußten wir nicht.“300
Doch ist die Beschreibung des Alltagslebens relativ knapp und allgemein gehalten, es
werden keine konkreten Erlebnisse präsentiert.
Der Übergang von der bloßen Beschreibung hin zur Erzählung, in der Eva ihre Arbeit
konkretisiert, steht bereits im Kontext ihrer Verhaftung.
Beim Schafeweiden außerhalb des Lagers bekommt Eva von einem „Mann in Eisenbahnuniform“301 ein Päckchen mit Lebensmitteln geschenkt, das bei einer Kontrolle am
Ghettoeingang entdeckt wird. Auffallend ist, daß sich Eva für die Annahme des Päckchens („wir waren doch hungrig“, Kontrollen waren „noch nicht üblich“302) und die anschließende Notlüge über seine Herkunft (bevor sie überhaupt den Inhalt der Lüge artikuliert) rechtfertigt. Im ersteren Fall will sie vielleicht erklären, weshalb sie das hohe
Risiko des Schmuggels überhaupt einging, doch möglicherweise spielt wie im zweiten
Fall hier bereits die erzählte Perspektive hinein, denn diese Tat, und insbesondere ihre
Lüge, hat dramatische Folgen: unbeabsichtigt belastet sie einen guten Freund, der
daraufhin nach „Polen“ geschickt wird. Ausführlich stellt sie dar, weshalb sie seinen
Namen angegeben hat.
„Unsere Jungen, die konnten, denen hat der Chef von der Landwirtschaft, das war ein
Deutscher, der hat ihnen damals mehr oder weniger offiziell bewilligt, sie konnten sich auf
einigen Beeten dort etwas pflanzen. Da hab ich gesagt, die Zwiebel hab ich von den
Jungen bekommen. Das war ein großer Fehler, weil der Deutsche von der Landwirtschaft
300 Dok. 3-3.
301 Ebenda.
302 Ebenda.
88
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
das dann geleugnet hat, und der Junge ist nach Polen gegangen.“303
Eva selbst wird einen Monat lang eingesperrt, und nur die Intervention ihres Vaters, der
aufgrund eines Ordens aus dem Ersten Weltkrieg zu den geschützten Personen gehört,
bewahrt sie vor dem Transport. Doch für die Tochter ist es „eine Tragödie“,304 daß sie
zurückbleibt und an ihrer Stelle ein Unschuldiger deportiert wird. Auch wenn Eva vorher sagte, daß die Ghettoinsassen ahnungslos waren in Bezug auf das Schicksal der
Transporte, wird hier deutlich, als was für eine Bedrohung sie im Ghetto empfunden
wurden. An dieser Stelle wechselt sie in die heutige Perspektive, teilt mit, daß der Junge
nicht zurückgekommen ist und daß diese Erfahrung sie bis heute quält:
„Das ist auch so ein Erlebnis, das eigentlich, das ich nie ganz, ganz [sucht nach Worten]
vergessen hab, und damit kann ich mich nie mehr abfinden.“305
Die Hypothese, daß die Vermischung der Ebene des damaligen Erlebens und der
Gegenwartsperspektive auf besonders traumatische Erlebnisse hinweist, wird hier durch
die Biographin selbst bestätigt.
4.1.3.2. ,Normalisierung‘
Nach Evas Entlassung geht das Leben weiter, sie nimmt ihre vorherige Arbeit wieder
auf. Auch ihr Kontakt zu dem „Mann in Eisenbahnuniform“ wird fortgesetzt. Offenbar
stellt es für Eva einen moralischen Konflikt dar, daß sie seine Hilfe in Anspruch genommen hat, da sie relativ ausführlich auf seinen Charakter und seine Tätigkeit eingeht. Ob
dieser Konflikt allerdings für sie bereits damals bestand oder eine nachträgliche Interpretation ist, bleibt unklar. Deutlich wird aber, daß er zwar auf der einen Seite Eva und
anderen ohne Gegenleistung zur Seite stand, auf der anderen Seite aber Geschäfte auf
Kosten der Ghettoinsassen machte, indem er ihre Notlage ausnutzte. Ferner könnte man
vermuten, daß sich Eva auch hier noch einmal zu rechtfertigen sucht, warum sie das Risiko des strengstens verbotenen Kontaktes zu einem Arier eingegangen ist und damit
weiterhin, trotz ihrer Hafterfahrung, sich und andere gefährdet. Größer als die Gefahr
jedoch, erwischt zu werden, war die Dringlichkeit, zu zusätzlichem Essen zu kommen,
303 Dok. 3-4.
304 Ebenda.
305 Ebenda.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
89
vor allem für den tuberkulosekranken Vater.306
Ähnlich wie in der Phase der ,Eingewöhnung‘ vor ihrer Haft steht also die Versorgung der Familie mit Lebensmitteln im Mittelpunkt, und der Lageralltag pendelt sich
wieder ein:
„Also, das Leben hat sich so irgendwie normalisiert. Das heißt, das war auch so typisch, ja,
wir leben, wir haben uns schon so daran gewöhnt an das Leben, wir konnten uns das schon
langsam nicht mehr anders vorstellen. Man hat hier und da gelacht und sich unterhalten,
man war ja jung.“307
Damit schließt sie diese Phase ab und leitet das ,Ende‘ ein, das mit den Herbsttransporten 1944 beginnt: Auch Evas Eltern sind wie zahlreiche andere bisher ,geschützte‘
Personen unter den Deportierten. Eva spricht von einer „Liquidierung“308 des Ghettos,
und ähnlich wie Marta, die in diesem Zusammenhang von ihrem heutigen Wissensstand
argumentiert, nimmt auch Eva die spätere Entwicklung in dieser Passage mehrmals vorweg. Zum einen betont sie einleitend den Zeitpunkt der Transporte („gegen Ende des
Krieges“309), womit sie die besondere Dramatik der Situation andeutet: So lange hat die
Familie zusammen durchgehalten, und dann werden die Eltern so kurz vor der Befreiung noch ermordet.
Zum anderen schildert auch sie ihren Versuch, sich freiwillig zu melden, aber im Gegensatz zu Marta gelingt es ihr ihrer Darstellung nach nicht, eine Bewilligung für den
Transport zu erhalten. Hier vermischen sich die erlebte und erzählte Perspektive besonders stark, Eva kann dieses Ereignis nicht ohne Antizipation ihres heutigen Wissens
darstellen. Einerseits wird durch die mehrmalige Hervorhebung ihrer Ahnungslosigkeit
deutlich, wie schlimm für sie die damaligen Situation war, als sie machtlos von ihren
Eltern getrennt wurde, und das, obwohl sie noch hoffte, sie nach dem Krieg wiederzusehen. Dagegen steht die heutige Perspektive, nämlich daß das Transportverbot ihr im
Grunde genommen das Leben gerettet hat und daß sie ihren Eltern ohnehin nicht hätte
helfen können, da „sie damals gleich ins, in die Gaskammern geschickt wurden.“310
306 „Das war für uns wunderbar, mein Vater war doch tuberkulosekrank, und der brauchte auch etwas
zum Essen, also, ich war glücklich, daß ich die Möglichkeit hatte, ihm irgendwie zu helfen.“
Dok. 3-4.
307 Ebenda.
308 Ebenda.
309 Ebenda.
310 Dok. 3-5.
90
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
4.1.3.3. Das ,Ende‘
Unglücklich und allein bleibt Eva zurück, „ohne Lust zum Weiterleben.“311 Das erste
Ereignis, das sie wieder thematisiert, ist die Ankunft der Transporte aus bereits evakuierten KZs, und in dieser Passage versinkt Eva erstmals im kollektiven ,wir‘ der Theresienstädter Insassen, für die die Begegnung mit den Neuankömmlingen in zweierlei
Hinsicht von schwerwiegender Bedeutung ist. Erstens erfahren sie von ihnen die Wahrheit über die Vernichtungslager und können angesichts ihres elenden Zustands die geringen Überlebenschancen derjenigen erahnen, die nicht direkt vergast wurden. Zweitens stecken sie sich mit Typhus an.
Hier löst sich Eva wieder vom kollektiven ,wir‘ und schildert, wie sie ihr ,Eisenbahner‘ in den Wirren der letzten Kriegstage mit zu sich nach Hause nimmt, da Gerüchte kursierten, daß das gesamte Lager vergast werden sollte.312 Doch sie erkrankt
dort an Typhus und läßt sich wieder zurückbringen, um seine Familie313 nicht zu gefährden. An den weiteren Verlauf ihrer Krankheit hat sie keine Erinnerung mehr, sie setzt
erst mit der Entlassung wieder ein.
Das Themenfeld Familie, das angesichts der Ahnungslosigkeit über ihren Verbleib in
den letzten Monaten im Lager nicht präsent war, taucht sofort nach Kriegsende wieder
auf und wird mit dem Satz „ich hoffte, daß ich meine Eltern in Prag wieder treffen werde“314 abgeschlossen. Evas Einsamkeit wird zwar nicht direkt artikuliert, kommt aber
recht deutlich darin zum Ausdruck, daß sie nicht weiß, wo sie jetzt unterkommen und
was sie jetzt überhaupt tun solle. Die Wohnung eines Überlebenden wird für sie und
viele andere zur ersten Zufluchtsstätte, und wieder tritt ein kollektives ,wir‘ in den Vordergrund, das für die KZ-Rückkehrer steht, die völlig allein und mittellos vor dem
Nichts stehen. Die nötigste materielle Unterstützung erhalten sie von der jüdischen Kultusgemeinde, die Mittagessen ausgibt und Lebensmittel- und Kleiderkarten verteilt.
Nachdem die menschlichen Grundbedürfnisse – ein Dach über dem Kopf, Essen und
Kleidung – vorübergehend gedeckt sind, beginnt Eva mit der Suche nach ihrem Verlobten, der für sie die einzige Hoffnung und alleiniger Anknüpfpunkt an die Vorkriegszeit
ist.315
311
312
313
314
315
Ebenda.
Vgl. historischer Überblick, Kap. 3.2.
„Er hatte drei kleine Kinder und eine Frau“, Dok. 3-5.
Ebenda.
Sie macht ihn über seine ,arischen‘ Verwandten ausfindig. Wie entrückt die Vorkriegszeit für Eva
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
91
Die nun anschließende Schilderung des Wiedersehens ist ganz in der Perspektive von
damals gehalten: Wie sie ihm, nachdem sie ihn ausfindig gemacht hat, „sehr vorsichtig“316 einen Brief schreibt, da sie nicht weiß, ob er nicht inzwischen eine andere
geheiratet hat, wie sie sich völlig fremd sind, als sie sich „nach über sechs Jahren“
wiedertreffen, wie sie binnen von drei Tagen beschließen, zusammen ein neues Leben
zu beginnen.317 Hier markiert sie selbst einen biographischen Einschnitt – „Und das
war eigentlich das Happy End“318 – und wendet sich der Nachkriegszeit zu.
4.1.4. Nach 1945
Es sind dieselben Themen wie bei Marta und L., die in Evas Schilderung der Nachkriegszeit dominant sind: die Familiengründung (vgl. Marta), die Schwierigkeit der
Wohnungssuche (vgl. beide), materielle Not in den ersten Jahren (vgl. L.), die politische
Ursachen hat, da Evas Mann aufgrund seiner bourgeoisen Herkunft und des westlichen
Exils unter den Kommunisten berufliche Probleme hat und als studierter Rechtsanwalt
gezwungen ist, manuell zu arbeiten.
Dann springt sie ins Jahr 1989 und betont, wie glücklich ihr Mann war „daß wir wieder normale Zeiten erleben“,319 bevor er 1993 starb. Offensichtlich war es nicht nur für
ihn, sondern auch für Eva von großer Bedeutung, denn den Begriff „normal“ benutzt sie
in ihrer Lebensgeschichte wiederholt für Phasen von stabilen demokratischen Verhältnissen, wie ihre Kindheit, den Neuanfang nach 1945,320 und schließlich den letzten politischen Umschwung, der nun für die Zukunft hoffen läßt. Nach einer Kurzbiographie
ihrer Kinder321 schließt sie ihre Erzählung mit dem Satz: „No, und jetzt lebe ich ziemlich ruhig hier, hab Enkelkinder, ich glaube, mein Mann hätte Freude.“322
316
317
318
319
320
321
322
92
ist, zeigt sich darin, daß sie ihren Nachnamen vergessen hat und sich erst beim Durchlesen des Telefonbuchs daran erinnert.
Dok. 3-6.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Wenn auch mit der Einschränkung „mehr oder weniger“ (ebenda), worauf die Schilderung der
Schwierigkeiten ihres Mannes unter den Kommunisten folgt.
Wobei hier die Emigration der Tochter 1968 hervorzuheben ist – „Dann war die Besetzung durch
die Russen, da war damals so eine Panik und wir wußten nicht.“ (Dok. 3-6) – in Anbetracht der
Tatsache, daß ein Drittel der jüdischen Gemeindemitglieder damals das Land verließ. Offensichtlich
weckte die erneute feindliche Okkupation des Landes innerhalb von dreißig Jahren bei vielen alte
Ängste.
Dok. 3-7.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
4.1.5. Zusammenfassung
Im Vergleich zu den bereits analysierten Interviews fällt auf, daß aufgrund der Tatsache, daß Eva im sudetendeutschen Gebiet aufwuchs, die Verfolgung für sie wesentlich früher einsetzt als für die beiden tschechischen Jüdinnen. Da bereits die Flucht
nach Prag den Zusammenbruch der Normalität mit sich bringt, d.h. die soziale Isolation
und den Absturz in die Mittellosigkeit, werden die Verbote der Nationalsozialisten, die
ab März 1939 schrittweise die soziale und materielle Stellung der tschechischen Juden
einschränken, von Eva nicht mit einem Wort erwähnt. Familiäre Schicksalsschläge wie
der Selbstmord der Großmutter oder die Tuberkulose-Erkrankung des Vaters überlagern
die historische Entwicklung. Die Okkupation und der Kriegsausbruch werden nur im
Zusammenhang mit der mißglückten Emigration thematisiert, die für Eva die Trennung
von ihrem Verlobten, für dessen Familie den Tod bedeutete. Doch der nächste radikale
Einschnitt in ihrer Biographie, die Deportation nach Theresienstadt, ist ihr mit den beiden tschechischen Jüdinnen gemeinsam. Die Darstellung des Lagerlebens vereinigt
dann auch die dominanten Komponenten aus beiden Biographien, zum einen die
Aktivität zur Beschaffung von Lebensmitteln (Arbeit und Kontakt zum Eisenbahner) für
die Familie und dadurch die Sicherstellung eines mehr oder weniger erträglichen Alltags, zum anderen die Bedrohung der Familie durch Transporte. Gleich zu Beginn trifft
es den Onkel, dann entgeht Eva selbst der Deportation nur um Haaresbreite, und
schließlich müssen die Eltern gehen.
Im Gegensatz zu Marta und L., für die der Hauptteil ihrer Lagererfahrung mit der Deportation nach Auschwitz-Birkenau beginnt, ist für Eva die letzte Kriegsphase nicht
mehr von Bedeutung, es gibt keine Familie mehr, für die sich ein Engagement lohnen
würde, erwähnenswert sind erst wieder die Ereignisse unmittelbar vor Kriegsende, die
für sie persönlich wie für die Theresienstädter Insassen im allgemeinen (und hier sieht
sie sich als Teil dieses Häftlingskollektivs) von großer Tragweite sind. Die Ankunft der
Elendstransporte bringt die erschütternde Gewißheit über die deportierten Angehörigen
und eine Typhusepidemie, die auch nach der Befreiung des Lagers viele Todesopfer fordert.
Trotz der völlig unterschiedlichen Erfahrungen in den letzten Kriegsmonaten weist
Evas und Martas Erzählung der Rückkehr und des Neuanfangs große Ähnlichkeiten auf.
Das erste, was beide nach ihrer Genesung, und somit Entlassung aus dem Lager, erwähnen, ist die enttäuschte Hoffnung auf überlebende Verwandte. Die Befreiung bringt
zwar die lang ersehnte Freiheit, aber auch die tragische Gewißheit, als einzige der Familie noch am Leben zu sein. Beide sind zudem vollkommen mittel- und wohnungslos und
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
93
beginnen mit der Suche nach Männern, Eva nach einem konkreten, nämlich ihrem Verlobten, Marta beliebig nach einem Überlebenden, der ihre Erfahrungen teilen kann. Beide werden fündig, heiraten und gründen sofort eine Familie, um, wie beide sinngemäß
sagen, neu anzufangen.
Diese Parallele schlägt sich in ihren Lebensgeschichten in einer Dominanz des Themenfelds Familie nieder, das eng mit der Verfolgung verknüpft ist. Ihre Erzählungen
sind von Anfang an überschattet von dem Verlust der Familie, weshalb die gesamte
Darstellung auf die Transportwelle 1944 zuläuft, die für diesen Verlust ausschlaggebend war. Die Ermordung der Angehörigen wird von beiden allerdings bereits
wesentlich früher in anderen Kontexten erwähnt. Trotzdem wird von beiden nach der
Befreiung als erstes noch einmal dieser Verlust thematisiert, der dann hinter die
erfolgreichen Bemühungen, eine eigene Familie zu gründen, zurücktritt. Beide haben
keine Möglichkeit, an die Vorkriegszeit anzuknüpfen, da diese Vergangenheit
gemeinsam mit der Familie ausgelöscht wurde. Deshalb erscheint dieser Zeitraum in der
erzählten Lebensgeschichte völlig undifferenziert als ,unbeschattete Jugend‘. Auch bei
Eva kann man daher von einer zerbrochenen Identität sprechen, die sich in ein
verlorengegangenes Vorkriegs-Ich und ein von der Shoah geprägtes Nachkriegs-Ich
spaltet.
4.2. Soziale Identität
Bei Eva stellt sich die Frage nach ihrer Identität nicht nur in Bezug auf das Judentum,
sondern auch auf die nationale Zugehörigkeit.
Von ihrer Kindheit erfahren wir diesbezüglich lediglich, daß sie sowohl jüdische wie
deutsche Freunde hatte. Was das Judentum angeht, so geht Eva erst durch mein
Nachfragen auf die religiöse Praxis in ihrem Elternhaus ein, wie bei den anderen Interviewpartnern spielte die jüdische Religion eine marginale Rolle. Viel wichtiger ist für
Eva die Hervorhebung der Tatsache, daß es vor 1938 keine Unterschiede gab. Insofern
ist anzunehmen, daß auch für sie das Attribut ,jüdisch‘ vor allem eine Fremdzuschreibung von außen und kein maßgeblicher Bestandteil ihrer eigenen Identität war. Für die
beiden tschechischen Jüdinnen sind die nationalen Loyalitäten ganz klar auf Seiten der
Tschechen. Bei Eva verhält es sich hier komplizierter, sie selbst macht keine konkreten
Aussagen über ihre Beziehung zum Tschechoslowakischen Staat und zu ihrem deutschen Umfeld, und auch nicht, wann es in sprachlicher und ethnischer Hinsicht zum
Bruch kommt. Wie auch immer die Loyalitäten vor den ersten antisemitischen Ausschreitungen lagen, die Monate vor dem Münchner Abkommen bringen bittere Erfah94
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
rungen hinsichtlich des Verhaltens der deutschen Bevölkerung, was die Familie zur
Flucht veranlaßt. Aber auch in Prag ist die Familie in der ersten Zeit sozial isoliert, sie
stehen zwischen Tschechen und Deutschen, d.h. zwischen den nicht sehr entgegenkommenden Gastgebern und ihren Vertreibern. Erst als Eva sich mit einem tschechischjüdischen Prager anfreundet und verlobt, wird sie allmählich in das tschechische Milieu
der Prager Juden integriert. Es fällt allerdings auf, daß Eva selbst weder die Tatsache,
daß ihr Verlobter Jude, noch daß er tschechischsprachig war, von selbst erwähnt. Beides
ist für Eva offensichtlich selbstverständlich, und daher nicht weiter erwähnenswert. Und
auch erst beim genaueren Nachfragen erfahre ich, daß sie bis zu ihrer Flucht kein
Tschechisch konnte, sondern vielmehr erst durch ihren Verlobten und im Krieg diese
Sprache erlernte. Auch in der Beschreibung ihres sozialen Umfelds in Theresienstadt
macht Eva keine sprachlichen oder ethnischen Zuschreibungen, genauso wenig bei
nichtjüdischen Tschechen wie den Gendarmen oder dem Eisenbahner. Dahingegen
werden die Okkupanten und Lageraufseher als Deutsche bezeichnet, denen das ,wir‘ der
Theresienstädter Häftlinge, und, nach der Befreiung, der Überlebenden gegenübersteht.
Daß Eva den Krieg über und bei ihrer Rückkehr in ein tschechisches Häftlingskollektiv
integriert war, wird durch die Tatsache bestärkt, daß sie für die Zeit nach dem Krieg
keine Diskriminierungen aufgrund ihrer deutschen Herkunft erwähnt.
Insofern brachte die Verfolgungserfahrung für Eva einen völligen Bruch mit der
ethnischen Identität ihrer Kindheit.
Nach 1945 legten Eva und ihr Mann Wert auf eine völlige Assimilation an die tschechische Gesellschaft:
„Auch die Kinder haben wir nicht als Juden erzogen, wir wollten, nach all diesen Erfahrungen, daß sie ganz normal aufwachsen, ohne irgendwelche Hemmungen und ohne
irgendetwas zu spüren, daß sie etwas anderes sind, weil wir das doch so zu spüren bekommen haben.“323
Trotz dieser Bemühungen bekam Evas Mann offensichtlich die Auswirkungen der antisemitischen Kampagne im Zuge des Slánský-Prozesses zu spüren, als er gezwungen
war, manuell zu arbeiten.
Gefragt nach ihrer heutigen Beziehung zu Deutschland wird noch einmal ein ,wir‘ der
jüdischen Überlebenden deutlich, für die unmittelbar nach dem Krieg alles, was deutsch
323 Dok. 3-7.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
95
war, ein „rotes Tuch“324 war. Heute distanziert sich Eva davon und sagt, sie wolle nicht
dasselbe wie die „Deutschen“ damals tun und kollektiv ein ganzes Volk hassen: „Das
sind ja Leute, wie wir sind.“325 Daraus geht deutlich hervor, daß sie sich mit den „Deutschen“ in ethnischer Hinsicht nicht mehr identifiziert. Stattdessen fühlt auch sie sich mit
den jüdischen KZ-Überlebenden durch die gemeinsame Verfolgungserfahrung verbunden, legt aber vorrangig Wert darauf, ,normaler‘ Bürger einer demokratischen Gesellschaft zu sein, in der ethnische und religiöse Unterschiede keine Rolle spielen.
5. Jirka K.
5.1. Subjektive Sinnstruktur
5.1.1. Zeit vor der Verfolgung
Von allen vier Interviews nimmt bei Jirka die Zeit vor der Verfolgung am meisten
Raum ein. Doch es sind nicht Erinnerungen an Erlebnisse aus der Kindheit, die er
darstellt, sondern vielmehr soziologische Angaben über sein Elternhaus in Bezug auf
sprachliches, soziales und religiöses Milieu, was durch seine weitere Biographie und
insbesondere die Gegenwartperspektive bedingt ist. Später wird Jirka nämlich erzählen,
daß in den letzten Jahren sein Interesse an der Geschichte der böhmischen Juden
erwacht ist,
„an den Zusammenhängen, die irgendwo zurückgehen oder zurückgeführt werden können
auf das, was sozusagen meine Vorfahren erlebt haben und was sozusagen es ausgemacht
hat in der früheren Zeit, Jude zu sein.“326
Er, der früher seinen eigenen Worten nach eine besondere Beschäftigung mit seiner jüdischen Vergangenheit abgelehnt hat, setzt sich nun intensiv damit auseinander.
Deshalb ist es für ihn natürlich im Rahmen dieses Interviews wichtig, diesen Aspekt
seiner ,Herkunft‘ ausführlich darzustellen. In diesem Sinne beschreibt er das Milieu
seines Elternhauses, um (sich) den sozialen Kontext verständlich zu machen, in den er
hineingewachsen ist: gut situiert (dank der wohlhabenden Unternehmerfamilie der
Mutter), in einem intellektuellen, liberalen Umfeld (Freundeskreis des Vaters),
324 Dok. 3-8.
325 Ebenda.
326 Dok. 4-10.
96
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
zweisprachig und ohne religiöse oder nationale Bindung an das Judentum.327 Wie auch
bei den anderen Interviewpartnern spielte also die jüdische Religion in Jirkas Jugend
eine geringfügige Rolle, und auch er hebt an dieser Stelle hervor, daß es im Freundesund Bekanntenkreis Juden wie Nichtjuden gab.
Von großer biographischer Bedeutung war sicherlich die Scheidung der Eltern, als Jirka
14 war. Er blieb bei seinem Vater, der ihn, wie er wiederholt zum Ausdruck bringt, sehr
geprägt hat. Er nennt diese Zeitspanne des Zusammenlebens mit dem Vater
„Vielleicht meine wichtigsten Jahre, die so mein ganzes späteres [...] meine künftige Laufbahn auch vielleicht intellektuell und wissenschaftlich beeinflußt haben.“328
Hier spricht Jirka eines der beiden dominanten Themenfelder in seiner Biographie an,
das Themenfeld wissenschaftliche Karriere. Wie aus dem Zitat ersichtlich wird, sieht er
die Wurzeln seiner späteren beruflichen Orientierung in der intellektuellen Atmosphäre,
die zu Hause herrschte. Die geistigen Impulse aus dieser Zeit beschränken sich aber
nicht nur auf die beruflichen Ambitionen, sondern sind auch hinsichtlich der politischen
Prägung Jirkas von Bedeutung. Denn ein zweites zentrales Themenfeld in seiner erzählten Lebensgeschichte ist die Identifikation mit kommunistischen Idealen (Themenfeld
Politik). Ausführlich widmet sich Jirka daher hier der ideologischen Ausrichtung seines
Vaters – „er hatte einen linken Touch“329 – , die er als eine Art kosmopolitische „Vision“ einer marxistisch-humanistischen Gesellschaft ohne religiöse, nationale oder
Klassenunterschiede beschreibt, zusammengefaßt „eigentlich freiheitliche Werte“.330
Das „eigentlich“ kündigt bereits ein Rechtfertigungsbedürfnis Jirkas angesichts seines
Wissens um die spätere Entwicklung in der Nachkriegs-Tschechoslowakei an („dem
Marxismus [...] in seiner institutionalisierten Form im Ostblock“331), das das ganze
Interview durchzieht. Denn Jirkas Begeisterung für den Kommunismus brachte ihm
zweimal in seinem Leben bittere Enttäuschungen ein und führte zu einer erheblichen
Beeinträchtigung seines weiteren Lebenswegs. Um so stärker scheint sein Bedürfnis,
(sich) zu erklären, wie es zu seines Vaters, und durch diesen auch zu seiner Faszination
für den Kommunismus gekommen ist.
327 „[...] wir haben überhaupt nichts von jüdischen Riten, Feiertagen, jüdischer Küche etc. bei uns
praktiziert, das alles war uns fremd.“ Dok. 4-2.
328 Ebenda.
329 Ebenda.
330 Ebenda.
331 Ebenda.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
97
Die Begeisterung für sozialistische Ideale erklärt sich Jirka zum einen mit dem allgemeinen politischen Klima in der Vorkriegszeit – „in den 30er Jahren [...] war das
eigentlich eine Sache, die irgendwie uns ganz natürlich vorkam.“332 Was seinen Vater
angeht, ist er der Meinung, daß das streng orthodoxe Milieu, dem er entstammte, in ihm
einen besonderen „Drang nach liberaler Offenheit“333 weckte.
Dieses Bedürfnis nach Rechtfertigung und Erklärung seines politischen Handelns
macht es Jirka unmöglich, die erlebte Vergangenheit ohne Antizipation der weiteren
Entwicklung darzustellen. Hier bestätigt sich noch einmal die Hypothese, daß die Vermischung der erzählten und erlebten Perspektive ein Indikator für besonders einschneidende biographische Erfahrungen ist.
Auch eine weitere Hypothese, die bei der Analyse von L.s Lebensgeschichte aufgestellt wurde, erweist sich hier als richtig: Aus Kindheit oder Jugend werden nur Erlebnisse bzw. Aspekte thematisiert, wenn sie für die weitere Biographie bzw. das Selbstbild, das die interviewte Person von sich entwirft, von Bedeutung sind (vgl. L.s katholischer Unterricht, sportliche Aktivität). Sowohl bei L. als auch bei Jirka ist in ihren erzählten Lebensgeschichten eine Kontinuität vorhanden, die zwar durch die Shoah gewaltsam unterbrochen, aber nach 1945 wieder aufgenommen werden kann. Beide wenden sich nach Kriegsende sofort dem zu, was ein zentrales Element in ihrer Biographie
darstellt: L. beginnt zu arbeiten und nimmt damit ihr Leben selbständig in die Hand
(Aktivität). Jirka beginnt zu studieren und schließt sich begeistert den Kommunisten an.
Beides hat er in seiner Darstellung der Vorkriegszeit bereits angekündigt bzw., seine
späteren Entscheidungen vorwegnehmend, biographisch zu erklären versucht. Sowohl
bei L. als auch bei Jirka kann man von der Form der erzählten Lebensgeschichte darauf
schließen, daß es ihnen gelingt, sich trotz der Holocaust-Erfahrung ein Leben lang als
mit sich selbst identisch darzustellen, d.h. sie können Erlebnisse aus der Vorkriegszeit
aus heutiger Perspektive in einen übergreifenden Sinnzusammenhang einfügen, der ihre
persönliche Identität ausmacht. Hierbei spielt natürlich die Tatsache, daß auch ihre
Familienangehörigen (ausgenommen L.s Vater) überlebt haben, eine nicht unwesentliche Rolle.
Marta und Eva hingegen, deren gesamte Familien ausgelöscht wurden, erinnern aus
der Vorkriegszeit nichts als einen Gesamteindruck von einer ,unbeschatteten Kindheit‘,
die durch die Nationalsozialisten zerstört wurde. Für sie stellt die Shoah einen wesent332 Ebenda.
333 Ebenda.
98
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
lich radikaleren Bruch mit der Vergangenheit dar, da niemand mehr übrig ist, mit dem
sie Erinnerungen daran teilen könnten. Beide gründen unmittelbar nach Kriegsende eine
neue Familie und sprechen in diesem Zusammenhang von einem Neuanfang, ein Begriff, der bei Jirka und L. nicht auftaucht.
5.1.2. Erste Diskriminierungen
Wie für Eva beginnt auch für Jirka die Verfolgungserfahrung früher als für die tschechischen Jüdinnen, und zwar bereits mit dem Münchner Abkommen: „Das hatte einen
Rieseneinfluß auf unser ganzes Dasein, auf alles, was dann später kam. Das war
nämlich der Anfang vom Ende.“334 Auch hier kann er sich bei der Beurteilung dieses
historischen Ereignisses nicht von der Gegenwartsperspektive lösen. Dann wechselt er
aber in die erlebte Vergangenheit und schildert seinen Entschluß, als Reaktion darauf
das deutsche Gymnasium zu verlassen und auf eine tschechische Institution zu
wechseln. Offenkundig solidarisiert er sich mit den Tschechen gegen den sich auch
unter
den
tschechoslowakischen
Deutschen
zunehmend
ausbreitenden
Nationalsozialismus, was im übrigen noch vor dem Einmarsch der Deutschen die
Zwangspensionierung seines Vaters an eben jenem Gymnasium zur Folge hat.
Kurz spricht Jirka das Thema Emigration an, das wohl damals ernsthaft diskutiert,
aber dann wieder fallengelassen wurde, da es in der Zweiten Republik „irgendwie möglich [war], überleben zu können.“335 Auch hier nimmt er wieder die heutige Perspektive
ein, in der die sicherlich zum damaligen Zeitpunkt deprimierenden Diskriminierungserfahrungen aus diesem Zeitraum in keinem Vergleich zu der bevorstehenden nationalsozialistischen Ausrottungspolitik stehen.
5.1.3. Okkupation
5.1.3.1. Vor der Deportation
Somit markiert die Okkupation durch die deutschen Truppen einen weiteren radikalen
Einschnitt in Jirkas Biographie: „Das betraf uns dann ganz massiv.“336 Ähnlich wie L.
lehnt er es allerdings ab, auf die nun einsetzenden antijüdischen Maßnahmen einzu-
334 Dok. 4-2.
335 Dok. 4-3.
336 Ebenda.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
99
gehen. Beide halten es offenbar für überflüssig, etwas, das alle im gleichen Maße betraf
und überall nachzulesen ist, in ihre biographische Darstellung mit einzubeziehen. Daher
erwähnen sie nur die für die Familie relevanten Konsequenzen, die nicht nur bei L. und
Jirka, sondern auch bei Marta und Eva dieselben sind: der Verlust des früheren sozialen
Status. Abschließend faßt Jirka diese Phase in folgendem Satz zusammen: „Das war
also eine, ja, scheibchenweise, Einengung unserer materiellen, aber vor allem auch psychischen, sozialen Lage [...].“337 Konkret thematisiert wird die soziale Ausgrenzung
nicht.
5.1.3.2. Theresienstadt
Die nächste entscheidende Zäsur ist die Deportation nach Theresienstadt, und zwar um
so mehr, als Jirka im allerersten Aufbaukommando338 ist und ihm, als er Prag verläßt,
nicht bewußt ist, daß er bereits seine Freiheit eingebüßt hat:
„Und Ende 1941 wurde ich dann als erster unserer Familie mit einem Transport junger Juden nach, zunächst ins Unbekannte, angeblich in ein Arbeitslager deportiert, d.h. wir konnten noch frei in den Zug einsteigen, unter dem ,Schutz‘ tschechischer Gendarmen, und unterwegs stellte sich heraus, wir fahren nach Theresienstadt. [...] unsere Aufgabe bestand darin, vorzubereiten das sogenannte Ghetto. Wir ahnten noch nicht, was das alles bedeuten
würde.“339
Doch als wenige Wochen später die ersten Hinrichtungen wegen Kontakten zur Außenwelt stattfinden, tritt der Charakter des ,Ghettos‘ deutlich zu tage. Es dient der völligen
Isolierung vom ,normalen Leben‘ und der Unterwerfung der Insassen unter ein Terrorsystem, das eine alltägliche Bedrohung der physischen Existenz darstellt.
Angesichts dieser Lage beschließt Jirka zusammen mit einem Freund, die erste Möglichkeit zu nutzen, um aus Theresienstadt herauszukommen, weshalb sie sich freiwillig
für einen Arbeitseinsatz in den Bergwerken von Kladno melden. Ähnlich wie L. versucht auch Jirka, sich als aktiv und Herr seiner Handlungen darzustellen, und
tatsächlich gelingt es ihm in diesem Fall, seine Lage durch diesen Entschluß zu
verbessern, zumindest für 1 ¼ Jahre, bis er wieder nach Theresienstadt zurückdeportiert
wird. Auch über Kladno möchte er sich nicht ausführlich äußern. Wesentlich ist nur,
337 Ebenda.
338 Vgl. historischer Überblick, Kap. 3.2.
339 Dok. 4-3.
100
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
daß die Lebensbedingungen dort besser waren.
Zurück in Theresienstadt trifft er dort Mutter und Bruder an.340 Im wesentlichen stehen sich bei der Beschreibung von Theresienstadt zwei Erfahrungen gegenüber: Einerseits ist die Familie noch zusammen, durch seine Arbeit gelangt Jirka an zusätzliches
Essen, außerdem gibt es ein gut funktionierendes Beziehungsnetz unter den „Ersteinwohnern“,341 d.h. den jungen tschechischen Juden, die sich gegenseitig unterstützen,342
und sogar ein reges kulturelles Leben – „Das war eigentlich das Positive unter den
gegebenen Bedingungen.“343 Mit anderen Worten pendelt sich eine gewisse
,Normalität‘ des Lageralltags ein, die auch Eva (direkt) und L. (indirekt) zum Ausdruck
bringen. Andererseits wird dieser Zustand jedoch permanent bedroht durch die
sogenannten Osttransporte, vor denen jeder Angst hatte, obwohl niemand im Ghetto
wußte, was einem dort bevorstand:
„Das Negative bestand darin, daß man nie wußte, ob man nicht in einem Transport in
Richtung Osten weiterbefördert würde. Wir wußten zwar [...] nicht, was passierte, wenn
man irgendwo weiterdeportiert wird, aber es gab eine sehr weitverbreitete Psychose, daß
das nichts Gutes ist.“344
5.1.3.3. Herbsttransporte 1944 bis Kriegsende
Wie auch bei den anderen Interviewpartnern läuft also die gesamte Schilderung der
Theresienstädter Lagerhaft auf den Endpunkt Transport zu, der in der zitierten Passage
bereits angekündigt und im Anschluß daran konkretisiert wird: Den Herbsttransporten
1944 fallen nicht nur Martas Familie und Evas Eltern zum Opfer, auch Jirka und sein
Bruder werden nach Auschwitz weiterdeportiert. Die Mutter, die in einem geschützten
Betrieb tätig ist, bleibt allein zurück.
Jirka wird wie Marta am 28. Oktober deportiert. Auch er hebt hervor, daß es sich dabei um den letzten Transport aus Theresienstadt nach Auschwitz handelte, und nicht nur
das, er fügt hinzu, es sei sogar der allerletzte Transport überhaupt gewesen, der bei einer
340 Daß der Vater emigrieren konnte, wurde von Jirka bereits am Anfang des Interviews bei der Beschreibung seines Charakters vorweggenommen, da er wohl im Exil schwere psychische Probleme
hatte. Jetzt wird seine Emigration noch einmal erwähnt.
341 Dok. 4-4.
342 Im Gegensatz zu dem Elend der alten und kranken Juden aus Deutschland, das Jirka hautnah miterlebt, da er dafür zuständig ist, ihnen die Essensrationen auszuteilen Vgl. historischer Überblick,
Kap. 3.2.
343 Dok. 4-4.
344 Ebenda.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
101
Ankunft noch einer Selektion unterzogen wurde. D.h. auch Jirka kann sich der Perspektive der Gegenwart bei seiner Schilderung nicht entziehen. Ebenfalls nimmt er
gleich vorweg, daß er und sein Bruder beide überlebt haben, bevor er sich wieder dem
damaligen Geschehen zuwendet. Seine Darstellung ist sehr knapp. Den ersten Monat ist
er offensichtlich in Auschwitz an der Bahnstation beschäftigt, worüber er nichts weiter
verlauten läßt. Später wird er nach Gleiwitz verlegt, wo wohl die Bedingungen
erheblich schlechter waren als bisher, denn beim Anblick der dortigen Häftlinge –
„sogenannten Muselmännern, die also nicht mehr lange leben können“345 – wird den
Neuankömmlingen klar, daß ihnen nur die Hoffnung auf ein sehr schnelles Kriegsende
bleibt, um dem Erschöpfungstod zu entgehen. Hinzu kommt angesichts der bisherigen
Erfahrungen die dunkle Ahnung, daß die Deutschen sie vermutlich nicht einfach den
Russen in die Hände fallen lassen werden.
„Das war also sehr schlimm, das war ein Wettlauf um die Zeit, wie wird es weiterlaufen,
denn das war damals schon klar, daß eben die Deutschen den Krieg verloren haben, daß
die Front sich uns nähert, und wir ahnten auf der einen Seite was Schreckliches, weil man
sich nicht vorstellen konnte, daß sie uns einfach leben lassen, wenn das Gebiet besetzt wird
von den Russen, auf der anderen Seite ist man als Mensch immer gehalten, doch daran zu
glauben, daß man vielleicht durch ein Wunder es doch schafft.“346
Und tatsächlich werden die Gefangenen nicht einfach zurückgelassen, sondern auf die
„berühmten Todesmärsche [...] nach Westen gejagt“.347 Doch „das Wunder geschah“,348
und Jirka und einigen Mitgefangen gelingt unterwegs durch Zufall die Flucht. Er
schlägt sich auf befreites Gebiet durch, schließt sich im April der Armee von General
Svoboda an und erlebt so das Kriegsende.
Obwohl die Schilderung seiner KZ-Haft seit der Deportation nach Auschwitz-Birkenau sehr knapp ist,349 so fallen doch einige Dinge auf:
Bis zur Verlegung nach Gleiwitz spricht Jirka in der ersten Person Singular; zuerst
hat er das Schicksal seines Bruders nach der Selektion geschildert, im Gegenzug kommt
er jetzt auf sich zu sprechen. Daß er hervorhebt, ausgerechnet „am 24. Dezember, also
345
346
347
348
349
102
Dok. 4-4.
Dok. 4-5.
Ebenda.
Ebenda.
Vgl. im Gegensatz dazu den breiten Raum, die diese Zeitspanne in L.s und Martas Erzählungen
einnimmt.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
am Heiligabend“,350 nach Gleiwitz gekommen zu sein, dieser Rückgriff auf ein
christliches Fest zur zeitlichen Einordnung des Geschehens, bringt zum Ausdruck, wie
wenig sich Jirka mit dem Judentum, aufgrunddessen er verfolgt wird, identifiziert. Das
kollektive ,wir‘, das nun in Gleiwitz in Erscheinung tritt, meint die Gruppe der
Neuankömmlinge, also derjenigen, die sich noch nicht aufgegeben haben, die sich durch
ihre Hoffnung noch ihre Menschlichkeit bewahrt haben.351 Das ,wir‘ auf der Flucht
schließlich wird explizit erklärt als eine Gruppe von sechs jungen Tschechen.
Zusammen mit der Tatsache, daß sich Jirka der tschechoslowakischen Befreiungsarmee
anschließt, zeigt sich ganz deutlich seine völlige Identifikation mit der tschechischen
Nation. Dies ist bereits mehrfach angeklungen, unter anderem in Theresienstadt, wo
ebenfalls ein kollektives ,wir‘ dominant ist, das für die Solidargemeinschaft unter den
jungen tschechischen Ghettoinsassen steht.352
Dieser tschechische Patriotismus findet sich, wie bereits herausgearbeitet wurde, auch
in den Erzählungen von Marta und L., und in keinem der vier Interviews gibt es in den
Darstellungen der KZ-Haft einen einzigen Bezug zur jüdischen Kultur oder Religion.
Nirgends wird eine Teilnahme an jüdischen Feiertagen oder Gottesdiensten erwähnt.
Vielmehr singt L. in Theresienstadt im Chor ein Requiem und Marta am christlichen
Neujahrstag in Bergen-Belsen Liedgut aus der tschechischen Kultur. Zudem gibt sie wie
Jirka zur zeitlichen Einordnung verschiedener Stationen ihrer Lagerhaft christliche
Feiertage an (in Auschwitz-Birkenau kommt sie an Allerseelen an, in Bergen-Belsen
sind sie über Weihnachten). Das einzige, das alle vier im Lager und ihr ganzes weiteres
Leben mit dem Judentum verbindet, ist die gemeinsame Verfolgungserfahrung.
5.1.4. Nach 1945
Bei der Schilderung der Rückkehr fällt auf, daß Jirka überhaupt nicht auf die von allen
anderen thematisierte Mittellosigkeit eingeht, sondern – abgesehen von der Bemerkung
„so kam ich halt dann glücklich, aber ziemlich physisch erschöpft und krank zurück“353
– sich sofort den zentralen Themen in seiner Biographie, Politik und Wissenschaft, zuwendet. Noch einmal beginnt Jirka zu erklären, wie es zu seiner Begeisterung für den
350 Dok. 4-5.
351 Vgl. Zitat oben, „als Mensch immer gehalten“.
352 „Wir, die noch relativ jung und auch eine Gruppe von sehr solidarisch zusammenhaltenden sozusagen ,Ersteinwohnern‘ waren, unterstützten einander.“ Dok. 4-4.
353 Dok. 4-5.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
103
Sozialismus kam, die, wie ja bereits dargestellt wurde, schon vor der Verfolgung unter
dem Einfluß seines Vaters und Freundeskreises bestanden hatte und in der Häftlingszeit
bestärkt wurde.
„Wir dachten eben [...], daß es doch gelingen müßte, eine Gesellschaft zu schaffen, in der
eben Unterschiede der sozialen Herkunft, der Religion, der Nationalität, der Rasse keine
Rolle mehr spielen könnten.“354
Doch auf den ersten Enthusiasmus folgt bald eine bittere Enttäuschung. Nach der kommunistischen Machtübernahme werden sowohl der Vater als auch die Mutter verhaftet,
die beiden Brüder erhalten Berufsverbot, und für Jirka ist aus heutiger Sicht vollkommen klar, daß seine Familie erneut Opfer eines staatlich verordneten Antisemitismus wurde, und das durch ein Regime, von dem er sich genau das Gegenteil erhofft
hatte.
Diese Erfahrung stellt in zweifacher Hinsicht eine Zäsur in Jirkas Biographie dar,
zum einen hinderte sie ihn an der Ausübung seines Berufs, zum anderen brachte sie eine
Abkehr von den Kommunisten. Erst mit der Liberalisierungsphase ab Ende der fünfziger Jahre kann Jirka an beides wieder anknüpfen. Seine akademische Karriere kommt in
den sechziger Jahren in Gang, und er nimmt aktiv Anteil an der tschechischen Reformbewegung, die zum Prager Frühling führt. Während er seinen ersten politischen Einsatz
nach Kriegsende noch mit seiner spezifischen Verfolgungserfahrung rechtfertigt, so
sieht er das Engagement für einen ‚besseren Sozialismus‘ als ein allgemeines Phänomen
der tschechischen Gesellschaft. Diese Phase nennt Jirka „eine schöne Zeit“,355 und trotz
aller unternommenen Rechtfertigungsversuche356 bleibt er bis heute seinen Idealen treu,
indem er zweimal andeutet, daß nicht alles, was er damals zu verwirklichen gesucht
habe, aus heutiger Sicht zu verwerfen sei.357
Auch seine wissenschaftliche Arbeit steht in dieser Phase im Geiste der Reformbewegung: Jirka promoviert über wirtschaftliche Führungseliten in der Bundesrepublik, da
er, wie er sagt, „spürte, daß irgendwelche positiven Erfahrungen verwertbar wären für
unsere Ideen eines besseren Sozialismus“.358
354 Dok. 4-5.
355 Dok. 4-7.
356 Sicherlich auch hinsichtlich des heutigen Umgangs der tschechischen Gesellschaft mit ehemaligen
Reformern des Prager Frühlings, die häufig als Kommunisten geächtet werden.
357 Vgl. Dok. 4-6f.
358 Dok. 4-7.
104
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Statt in der Chronologie fortzufahren und auf das Scheitern des Prager Frühlings und
seine Emigration zu sprechen zu kommen, geht Jirka nun auf die ,jüdische Frage‘ ein,
das dritte große Themenfeld in seiner erzählten Lebensgeschichte, das, wie eingangs erwähnt wurde, erst in der jüngsten Zeit für ihn an Bedeutung gewonnen hat.
Er hebt hervor, daß er sich trotz seiner damaligen Haltung, die jegliche Identifikation
mit dem Judentum ablehnte, stets mit den anderen Überlebenden der Shoah durch die
gemeinsame Verfolgungserfahrung verbunden fühlte, auch wenn es ihm erst viel später
bewußt geworden ist: „Und wenn ich jetzt an die einigen wenigen denke, die heute noch
leben, das auch miterlebt haben, wir haben immer auf der gleichen Welle gedacht und
gefühlt.“359
Im Anschluß daran kommt er bereits in seiner Darstellung zum Ende und will nurmehr ,als Schlußwort‘ noch auf seine Frau und Familie eingehen. Während die bisherige Darstellung wenig Einblick in das persönliche Leben und Erleben Jirkas ermöglicht hat, sondern eher die öffentliche Sphäre von Politik und Zeitgeschichte betraf,
geht er hier erstmals auf ganz persönliche Erfahrungen ein.
Seine zukünftige Frau lernt er zu einem Zeitpunkt kennen, als seine Eltern gerade
beide im Gefängnis sind und er unter großer Verfolgungsangst leidet. Er betont mehrmals, daß seine spätere Frau aus einem völlig anderen gesellschaftlichen Kontext, nämlich einer tschechischen Handwerksfamilie, stammt. Für ihn wird dieser Umstand zu
einer großen Stütze angesichts seines „Verfolgungswahns“ und der „Erblast der Verfolgung der Juden“,360 die in ihm in derartigen Krisensituationen alle verdrängten Ängste
aus der Nazi-Zeit wieder aufleben lassen. Erst in diesem Zusammenhang kommt Jirka
auf die Invasion der Truppen des Warschauer Paktes zu sprechen, die ein weiteres
traumatisches Erlebnis dieser Art darstellt und zur Konsequenz hat, daß die Familie das
Land verläßt.361
An dieser Stelle wünscht Jirka seine Erzählung zu beenden und erbittet Einzelfragen.
Mit anderen Worten ist für ihn bereits das Wichtigste über sein Leben gesagt worden.
Für den Zeitraum nach der Verfolgung fällt auf, daß seine Darstellung in zwei Blöcke
zerfällt. Erstens den Block Karriere und Politik, sprich den ,öffentlichen Bereich‘, und
359 Ebenda.
360 Dok. 4-7f.
361 „Und dann eben, in diesen schweren Zeiten, nachdem der Prager Frühling [...] eben niedergeschlagen wurde, wo die Tschechoslowakei von sowjetischen Truppen besetzt wurde, wo allerdings
alle die Verfolgungen, die ich irgendwie schon verinnerlicht habe, wieder neu aufkamen und wir
emigriert sind, hat sie mir auch sehr geholfen.“ Dok. 4-8.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
105
zweitens den Block ,Persönliches‘. Interessant ist hierbei, wie er selbst dabei dieselben
Ereignisse in unterschiedlicher Hinsicht in seine Biographie einordnet. Im ersten Block
erscheinen die Repressionen durch die Kommunisten vorrangig als Zäsur für das politische und berufliche Weiterkommen. Die Verfolgungserfahrungen beider Unrechtsregime werden hier nur zur Erklärung des politischen Engagements thematisiert.
Erst im zweiten Block wird deutlich, welchen Einfluß diese Erfahrungen auf die ganz
persönliche Biographie Jirkas hatten. Nicht umsonst spricht er von einem unbewußten
Gefühl der Verbundenheit mit anderen Überlebenden, wenn auch ohne darauf einzugehen, worin sich dieses Gefühl geäußert hat. Aber im Zusammenhang mit der Beschreibung seiner Ehefrau, die ihm in Situationen, in denen die alten Verfolgungsängste
wieder hochkamen, aufgrund ihres völlig anderen familiären Hintergrunds zur Seite stehen konnte, wie Anfang der fünfziger Jahre und 1968, kann man erahnen, was er damit
meinte: die in vielen Überlebenden tief verankerte Angst vor einer Wiederholung all
dessen, was sie bereits einmal durchmachen mußten. Aus diesem Grund haben vermutlich auch so viele Juden die Tschechoslowakei in zwei großen Emigrationswellen verlassen.362
5.1.5. Zusammenfassung
Vergleicht man die Gestalt von Jirkas erzählter Lebensgeschichte mit den anderen Interviews, fällt ein struktureller Unterschied auf: Bei ihm nimmt die Schilderung der KZHaft wesentlich weniger Raum ein als bei den anderen, während hingegen Vor- und insbesondere Nachkriegszeit sehr viel stärker ausgebaut sind. Zwar ist er der einzige der
vier, der den Einfluß der Verfolgungserfahrungen auf sein weiteres Leben wiederholt
artikuliert, doch die Erfahrungen selbst kann oder will er nicht näher darstellen. Das bedeutet nicht, daß er sie für biographisch weniger bedeutend hält, sondern vielmehr, daß
er nicht in der Lage ist, sie in sein biographisches Selbstbild zu integrieren.
Jirkas Selbstbild zerfällt in zwei Identitätskomponenten: Erstens die Identifikation
mit der kommunistischen Bewegung als tschechoslowakischer Bürger, zweitens die
sehr viel jüngere Identifikation mit dem Judentum. Diese Identitäten beschränken sich
nicht auf eine persönliche, innere Empfindung, sondern werden auch nach außen
getragen und im eigenen Handeln umgesetzt: In der Vorkriegszeit wechselt Jirka zur
Demonstration seiner ideologischen wie nationalen Zugehörigkeit
vom deutschen
362 Vgl. Eva R., Anm. 321, und historischer Überblick, Kap. 5.
106
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Gymnasium auf eine tschechische Schule, in der Reformperiode setzt er sich auf
wissenschaftlicher Basis mit kapitalistischen Wirtschaftsformen auseinander, um neue
Anregungen für die Reformsozialisten zu finden, und heute, wo er sich für seine
jüdische Vergangenheit interessiert, beschäftigt er sich mit der Geschichte des
böhmischen Judentums.
Im krassen Gegensatz dazu stehen die Zeitspannen der staatlichen Verfolgung, in
denen es Jirka nicht möglich war, selbstbestimmt einen Beruf auszuüben, ganz zu
schweigen von der Erfahrung in den nationalsozialistischen Todeslagern, wo man nicht
einmal mehr das Überleben in der eigenen Hand hatte, sondern nur noch auf ein ,Wunder‘ bzw. einen Zufall hoffen konnte angesichts der Alltäglichkeit des Todes.
Später im Interview sagt Jirka, daß er seine damaligen Erlebnisse heute viel nüchterner betrachten kann. Tatsächlich ist die Darstellung seiner letzten Monate im KZ von
einer Nüchternheit, die sich auf eine knappe Beschreibung der einzelnen Stationen bis
zur Befreiung beschränkt. Angesichts dessen, daß sein Selbstbild, sprich seine persönliche Identität, auf Selbstverwirklichung in Beruf und Politik beruht, was im völligen
Widerspruch zu der nationalsozialistischen Entmenschlichung steht, wird dieser Umstand vielleicht verständlich. Die Zeitspanne der Verfolgung kann nicht in die Biographie integriert werden und ist daher äußerst kurz gehalten.
Außerdem unternimmt Jirka eine scharfe Trennung zwischen dem, was er „persönliches Leben“363 nennt und dem Bereich der Arbeit und Politik, der seine Erzählung dominiert. Um so interessanter ist der Vergleich mit den anderen Interviewpartnerinnen,
die alle vorwiegend den persönlichen Bereich hervorheben. In Anbetracht der Tatsache,
daß es sich hierbei um weibliche Biographien handelt, drängt sich die Vermutung auf,
daß dieser Gegensatz ein geschlechtsspezifischer ist, der dem damals gängigen
traditionellen Rollenbild entsprach: der Mann findet seine Selbstverwirklichung in der
Karriere und im politischen Engagement, die Frau hingegen in der Sorge um die
Familie. Eva und L. erzählen zwar von ihrer Berufstätigkeit nach 1945 (und erwähnen
in diesem Zusammenhang, daß ihre Ehemänner diesen Umstand nicht guthießen364),
aber dennoch liegt bei ihnen nicht die Betonung auf einer Verwirklichung im Beruf,
sondern auf der Verbesserung der materiellen Lage der Familie.
363 Dok. 4-7.
364 Evas Mann war der Überzeugung, ihm (als Anwalt) müsse es doch schließlich gelingen, die Familie
allein zu ernähren, L.s Mann befürchtete, daß das Familienleben darunter leiden würde. Vgl.
Dok. 3-6 und Dok. 2-11.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
107
5.2. Soziale Identität
Was die nationale Identität Jirkas angeht, so ist eindeutig konstatierbar, daß er sich mit
dem tschechoslowakischen Staat identifiziert hat, spätestens seit seinem Entschluß nach
dem Münchner Abkommen, auf das tschechische Gymnasium zu wechseln. D.h. ähnlich
wie Eva, die es allerdings nicht explizit deutlich macht, kehrt er sich von seinen deutschen Ursprüngen völlig ab. In Theresienstadt ist er in das tschechische Häftlingskollektiv integriert, auf seiner Flucht ist er ebenfalls mit jungen Tschechen zusammen,
und er schließt sich der tschechoslowakischen Befreiungsarmee an. Nach dem Krieg engagiert er sich für sein Land aktiv in der Politik, und heute sagt er, der in Deutschland in
der Emigration lebt, über die Tschechen: „Ja, das sind meine Leute. [...] Já si s nima
rozumím prostě.“365
Zur Rolle seiner jüdischen ,Herkunft‘ ist bereits gesagt worden, daß in den letzten
Jahren sein Interesse dafür erwacht ist. Er spürt heute eine emotionale Bindung an das
Judentum:
„Das fasziniert mich, daß es so etwas gibt, daß man die eigene Herkunft und Identität nicht
verleugnet, man kann auch stolz sein irgendwo drauf, [...] aber auf der anderen Seite, daß
man eben nicht sieht, daß in der Menschheit etwas übergreifend ist.“366
Und da beide Identitäten, die tschechische wie die jüdische heute für ihn wichtig sind,
sucht er, beide miteinander zu verknüpfen: „Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas
Ähnliches, das sind Kleinigkeiten, man mußte sich mal anpassen, man mußte überleben,
das gilt für Tschechen wie für Juden.“367
Mit anderen Worten fühlt er sich nicht nur mit jüdischen Holocaust-Überlebenden
durch das gemeinsame Schicksal verbunden, sondern auch mit den Tschechen, insbesondere durch den Prager Frühling und dessen Scheitern.
Im Vergleich zu den anderen Interviews fällt auf, daß er der einzige ist, der seine Beziehung zum Judentum thematisiert und reflektiert, was aber mit seiner insgesamt sehr
analytischen Herangehensweise an sein Leben zusammenhängt, in der sich sein neues
geschichtliches und sein traditionelles soziologisches Interesse widerspiegeln.
365 „Mit denen verstehe ich mich eben gut.“ Dok. 4-11.
366 Dok. 4-11.
367 Ebenda.
108
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
E. Abschließende Bemerkung
Bei der Analyse der Interviews standen konkret zwei Anliegen im Mittelpunkt: Einerseits wurde das ganz persönliche, subjektive Erleben von Geschichte und sein Niederschlag in der erzählten Lebensgeschichte, die subjektive Sinnstruktur der Biographie,
herausgearbeitet, andererseits wurde die soziale Identität der Interviewpartner untersucht, um festzustellen, welche Rolle die Kategorie ,jüdisch‘ für ihre eigene Selbstbeschreibung spielt.
Die subjektive Brechung der erlebten Geschichte in den biographischen Erzählungen
wurde in der Auswertung der einzelnen Interviews ausführlich dargestellt. Abschließend möchte ich darauf eingehen, welche sozialen und historischen Topoi in den
Gesprächen für die Biographie von besonderer Signifikanz sind, welche Strukturen die
Erinnerung und somit die Erzählung prägen und welchem biographischen Wandel die
Identität der Erzähler unterworfen ist.
1. Niederschlag sozialer und historischer Faktoren im subjektiven Erleben der
Biographen
• Geschlecht
Von den sozialen Faktoren ist zunächst das Geschlecht zu nennen, das für das Selbstbild
und die Themenwahl von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Bei den Frauen dominiert
die private Sphäre, im Mittelpunkt steht die Familie und die Sorge um ihr Wohlergehen,
bei Jirka hingegen der öffentliche Bereich, Beruf und Politik. Dies ist eine mögliche
Erklärung dafür, daß die Frauen sehr ausführlich über ihre Lagererfahrungen sprechen,
während Jirka diese Phase knapp und chronistisch hält. Man könnte vermuten, daß es
den Frauen leichter fällt, über Persönliches zu sprechen, da sie sich vor allem darüber
definieren, Jirka aber seine Lebensgeschichte gemäß seinem wissenschaftlichen Interesse sehr nüchtern und analytisch präsentiert und daher subjektive Details und besonders
erniedrigende Momente der Lagerhaft weniger thematisiert.368
• Ethnisches Umfeld
368 Er schildert im Gegensatz zu Marta und L. weder die Fahrt im Viehwaggon und die Ankunft in
Auschwitz, noch seine erste Begegnung mit der Realität der Gaskammern, und auch der Todesmarsch erscheint lediglich als Datum – „Es kamen dann noch die berühmten Todesmärsche“ (Dok.
4-5) -, ohne daß näher auf die Umstände eingegangen wird.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
109
Weiter ist das ethnische Umfeld, in dem die Interviewpartner aufwuchsen, von Bedeutung, denn Eva und Jirka erfahren als deutsch assimilierte Juden bereits vor der
Okkupation Diskriminierungen durch die deutsche Umgebung. Damit liegt der biographische Einschnitt, der die Verfolgung einleitet, bei ihnen wesentlich früher als bei
den beiden tschechischen Jüdinnen, für die diese Erfahrung erst mit dem deutschen
Einmarsch beginnt. Außerdem bringt die Shoah für Eva und Jirka eine völlige Abkehr
von ihrer deutschen Herkunft, wenn auch in Evas Fall möglicherweise weniger als
bewußte Entscheidung, denn aufgrund der Tatsache, daß mit ihrer Familie auch die
Kindheit im Sudetenland unwiederbringlich verloren ist.
• Elternhaus
Was das Elternhaus anbelangt, so stammen alle aus der Mittelschicht und repräsentieren
das jüdische bürgerliche Milieu von Handel- und Gewerbetreibenden einerseits oder
Angestellten des öffentlichen Dienstes (Jirkas und Evas Vater waren Gymnasiallehrer)
andererseits. Ihre Eltern bzw. Großeltern halten noch die großen jüdischen Feiertage,
aber die jüdische Religion hat im Alltag keine Bedeutung mehr. Der erste schmerzhafte
biographische Einschnitt durch die Verfolgung ist daher für alle vier der Verlust des
früheren bürgerlichen Sozialstatus und die grundsätzliche Erfahrung der Ausgrenzung
aufgrund ihres ,Jüdischseins‘, das für sie bisher keine wesentliche Rolle gespielt hat.
• Lokalität
Ferner hat sich gezeigt, daß Marta am stärksten die erfahrene soziale Ausgrenzung thematisiert, was vermuten läßt, daß der soziale Druck in der Kleinstadt Tábor wesentlich
größer war als in Prag. Außerdem ist sie die einzige, die neben dem Verlust des Sozialstatus auch andere Verbote aufzählt. Eva hingegen, für die bereits die Flucht 1938 den
Zusammenbruch der Normalität in sozialer wie materieller Hinsicht bedeutete, erwähnt
die ab 1939 einsetzenden antijüdischen Maßnahmen überhaupt nicht, was deutlich die
unterschiedliche Wahrnehmung historischer Wirklichkeit zum Ausdruck bringt.
• Soziale Position
Dies zeigt sich auch, wenn man vergleicht, welche Funktion Theresienstadt in den vier
Biographien einnimmt, eine Erfahrung, die alle teilen: Von zentraler Bedeutung ist bei
allen die soziale Stellung der eigenen Person und der Familienangehörigen im Ghetto,
die durch Beruf, Privilegien oder Kontakte maßgeblichen Einfluß auf die Ernährungslage und den Schutz vor Transporten hatte. Nur bei Marta fehlt das Themenfeld Essen
110
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
völlig, was dadurch zu erklären ist, daß sie im Gegensatz zu den anderen nicht aktiv an
der Lebensmittelbeschaffung beteiligt, durch ihren Bruder aber ausreichend versorgt
war, so daß dieses Problem angesichts der permanenten akuten Bedrohung durch abgehende Transporte kaum ins Gewicht fiel. Bei L. hingegen ist die Transportangst kein
Thema, was wiederum annehmen läßt, daß ihre Familie bis zum Zeitpunkt der Deportation vor Transporten geschützt war.
• Ausgeliefertsein
Trotz eines gewissen Maßes an ,Normalität‘ im Theresienstädter Lageralltag beginnt
schon hier die grausame Willkür der Selektion, die zuerst die einen, dann die anderen
vor Transporten bewahrt, um letztlich dann doch fast alle zu deportieren und nur mehr
einen Bruchteil der Protektoratsjuden im Ghetto zurückzulassen. Insofern sind es nun
rein willkürliche äußere Umstände, die das Erleben dieser Phase prägen. Eva bleibt völlig allein als eine der wenigen in Theresienstadt zurück. Die letzten Kriegsmonate bringen für sie bis kurz vor Kriegsende, als die Evakuierungstransporte das Lager erreichen
und eine Typhusepidemie ausbricht, keine neuen Erfahrungen. Die Vorteile ihrer sozialen Stellung haben für sie jeglichen Sinn eingebüßt, da niemand mehr da ist, den sie dadurch versorgen könnte, so daß aus diesem Zeitraum nichts mehr thematisiert wird. Für
Marta, L. und Jirka hingegen beginnt mit der Deportation nach Auschwitz-Birkenau der
eigentliche Leidensweg. Marta, an der Rampe von ihren Eltern getrennt und von nun an
ebenfalls allein, versinkt größtenteils im ‚wir‘ des tschechischen Häftlingskollektivs,
dessen Solidarität der äußeren Entmenschlichung entgegengesetzt wird. Auch Jirka wird
durch den Transport von seinen Angehörigen getrennt, und in seiner Darstellung steht
ein ,wir‘ im Vordergrund, das die Gruppe der Neuankömmlinge in Gleiwitz bezeichnet,
die sich von den bereits zu ,Muselmännern‘ gewordenen dortigen Häftlingen abhebt und
sich noch nicht aufgegeben hat. Durch ihre Hoffnung bewahren sie sich einen letzten
Rest Menschlichkeit. L. bleibt bis zur Befreiung mit ihrer Mutter zusammen, so daß ihre
Schilderung wesentlich ichbezogener ist, und sie reagiert auf Augenblicke völliger Passivität und Entmenschlichung stets mit Fürsorge für Hilfsbedürftige, etwa im Familienlager durch ihre Arbeit bei den Kindern. Solidarität, Hoffnung und zwischenmenschliche Fürsorge, so wehrt sich jeder auf seine eigene Weise gegen den Verlust der
Menschenwürde.
• Einsamkeit und Mittellosigkeit nach der Rückkehr
Nach der Befreiung stehen die Überlebenden vor dem materiellen Nichts, ihr früheres
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
111
soziales Umfeld ist zerstört, die Wiedereingliederung ins Alltagsleben erfordert angesichts der traumatischen KZ-Erfahrungen und des Verlusts der alten Welt sehr große
Anpassungsleistungen.
Hier tritt wieder die geschlechtliche Komponente zum Vorschein. Die Frauen heiraten und gründen eine neue Familie, wenn auch L. im Gegensatz zu Eva und Marta erst
1946, Jirka nimmt unmittelbar sein Studium auf und wird in der kommunistischen Partei aktiv. In der Darstellung schlägt sich dieser Unterschied darin nieder, daß alle drei
Frauen ihre völlige Mittellosigkeit und insbesondere das Problem, eine Wohnung zu
finden, ausführlich schildern, während Jirka die materielle Not gar nicht thematisiert,
sondern stattdessen intensiv auf das Themenfeld Kommunismus eingeht. Parallel dazu
bleibt die weitere Schilderung der Frauen vorwiegend auf den persönlichen Bereich beschränkt, während Jirka, gerade wegen seines politischen Engagements exponiert, nach
der kommunistischen Machtübernahme im Zuge des Slánský-Prozesses erneut Opfer
staatlicher Repressionen wird, was seinen weiteren Lebensweg massiv beeinflußt.
• Prager Frühling
Nach der Enttäuschung über das gewaltsame Ende des Prager Frühlings verläßt Jirka
mit seiner Familie das Land. Offenbar war dieses historische Ereignis auch für Eva und
L. von erheblicher Bedeutung, wenn auch wiederum weniger bezüglich der eigenen
Person denn eines Familienmitglieds. So geht Evas Tochter ebenfalls in die
Emigration,369 und L. verschafft ihrem Sohn eine Lehrstelle, da sie fürchtet, er könne
eingezogen werden. In Anbetracht dessen, daß damals ein Drittel der Mitglieder der
Jüdischen Gemeinde die Tschechoslowakei verließ, kann man vermuten, daß die
erneute militärische Besetzung des Landes unter den Überlebenden alte Ängste wieder
hochkommen ließ und viele veranlaßte, diesmal sofort die Koffer zu packen, bevor es
wieder zu spät wäre.
Hier kann man bereits erkennen, daß die Shoah diejenige Erfahrung ist, die das Erleben der Nachkriegszeit bis heute am nachhaltigsten beeinflußt hat, weshalb sie naturgemäß auch ausschlaggebend ist für die Gegenwartsperspektive und das Selbstbild der
Biographen. Dies führt unmittelbar zu der Frage nach der Beziehung zwischen Geschichtserfahrung, Erinnerung und Erzählen.
369 Vgl. Eva R., Anm. 321.
112
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
2. Wechselwirkung zwischen Erleben, Erinnerung und biographischer Selbstdarstellung
Nach der Befreiung folgte für die meisten Überlebenden eine lange Zeit des Verdrängens, die auf zwei Gründe zurückzuführen ist. Einerseits war angesichts der
schmerzlichen Last der Erinnerung das Bedürfnis nach Normalisierung groß. Andererseits weigerte sich häufig ihr soziales Umfeld, sich mit ihren Erlebnissen auseinanderzusetzen. In den sozialistischen Ländern wurde zwar der Antifaschismus großgeschrieben, aber Opfer des Nationalsozialismus wurden lediglich unter dem Aspekt
des politischen Widerstands gewürdigt, während hingegen eine Auseinandersetzung mit
dem Schicksal der ,rassisch‘ Verfolgten unterblieb. Das Schweigen über die eigene Person war also auch eine notwendige Bedingung für die Reintegration ins ,normale‘ Leben, wollte man die Kommunikation mit dem Umfeld aufrechterhalten. Neben dem geringen Interesse an ihren Schicksalen kam die Schwierigkeit hinzu, einem Außenstehenden die Erfahrungen der extremen Verfolgung überhaupt vermitteln zu können.
Beides war für viele ein Grund, einen jüdischen Ehepartner zu suchen, der diese Erfahrungen teilte, man denke an Eva, Marta und L. Jirka hingegen wählte einen anderen
Weg des Neubeginns – politisches Engagement in den Reihen der Kommunisten – , der
völlig fehlschlug, da er ausgerechnet von denjenigen, die er für Garanten einer egalitären antifaschistischen Gesellschaft gehalten hatte, erneut aufgrund seiner jüdischen
Herkunft verfolgt wurde. Erst die Heirat mit einer nichtjüdischen Tschechin und Proletarierin ermöglichte ihm eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
Aufgrund der Schwere der traumatischen Erfahrung und ihrer physischen und psychischen Folgen begannen viele Überlebende erst mit dem „stabilisierenden Gegengewicht
von ungefähr 40 Jahren“,370 über ihre Erlebnisse zu sprechen. Hinzu kam, daß mit dem
Wegfall der ideologischen Schranken seit 1989 eine verstärkte Forschungstätigkeit über
den Holocaust und jüdische Themen einsetzte und parallel dazu weltweit das Interesse
der Öffentlichkeit an der Shoah zunahm.371 Zwei Projekte, die Shoah Foundation und
370 MEYER, BEATE Projekt „Hamburger Lebensläufe – Werkstatt der Erinnerung“. Eine Zwischenbilanz, in: BIOS 7 (1994), Heft 1, S. 120-134, hier S. 121.
371 In der westlichen Welt gab es drei Phasen, in denen Holocaust-Überlebende öffentlich zu Wort
kamen: zunächst unmittelbar nach 1945, allerdings hielt das Interesse nicht sehr lange an. Ein zweites Mal 1960 im Rahmen des Eichmann-Prozesses, und das dritte Mal 1978, als die amerikanische
Serie „Holocaust“ weltweit heftige Reaktionen und infolgedessen eine stärkere Auseinandersetzung
mit der Shoah hervorrief. Um den Überlebenden die Möglichkeit zum Sprechen zu geben, entstand
daraufhin beispielsweise das Video-Projekt in Yale. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus
und der deutschen Wiedervereinigung kam es zu einer weiteren Expansion der Beschäftigung mit
der Shoah, und im Zusammenhang mit Spielbergs Film „Schindlers Liste“ entstand ein weiteres Vi-
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
113
die systematische Sammlung des Jüdischen Museums in Prag, begannen nun, sich für
die Erinnerungen der tschechischen Juden zu interessieren. Die hohe Bereitschaft seitens der Überlebenden, öffentlich Zeugnis abzulegen, entspringt meist dem Gefühl, es
den ermordeten Familienmitgliedern und Freunden schuldig zu sein.372 Zwar wird
dieses Anliegen in den Interviews nur von Marta explizit formuliert, aber Jirkas
verstärktes Interesse an der jüdischen Vergangenheit und seine Publikationstätigkeit,
Evas Bemühungen um die Veröffentlichung ihres Theresienstädter Tagebuchs, das die
ersten zwanzig Jahre nach Kriegsende auf dem Boden des Wäschekorbs versteckt lag,
und die Bereitschaft aller, nicht nur mir, sondern auch Spielberg bzw. dem Jüdischen
Museum Interviews zu gewähren, stützt diese Vermutung.
Trotz des langen zeitlichen Abstands sind die traumatischen Erfahrungen heute nach
wie vor schmerzhaft präsent.373 Im Gegenteil, gerade im Alter werden die Erinnerungen
infolge der körperlichen Veränderungen und dem damit verbundenen Gefühl der
Schwäche und Hilflosigkeit noch drängender.374 Viele Erfahrungen sind nicht erzählbar,
da sie zu schmerzhaft und oft nicht mit dem heutigen Selbstverständnis in Einklang zu
bringen sind. Die KZ-Erlebnisse widersprechen häufig den gängigen (eigenen wie gesellschaftlichen) Moralvorstellungen, weshalb es sehr schwer fällt, diese zu thematisieren, ohne das eigene Scham- und Ehrgefühl zu verletzen.375
372
373
374
375
114
deo-Projekt, die Shoah-Foundation, die sich vornahm, weltweit die Erinnerungen der Überlebenden
aufzuzeichnen. Vgl. hierzu Anm. 187.
Pollak schreibt in dem Zusammenhang, daß sich die Überlebenden stets in dem Dilemma befanden,
sich einerseits den ermordeten Verwandten gegenüber verpflichtet zu fühlen, die Erinnerung an sie
und das an ihnen verübte Verbrechen zu wahren, andererseits um des eigenen Überlebens willen
diese Erinnerungen verdrängen zu müssen: „Nur wer das KZ überlebt hat, kann ein glaubwürdiger
Zeuge sein, aber die Vergangenheit vergessen oder nicht öffentlich über sie reden wollen ist unter
Umständen eine Bedingung für ihre Überwindung.“ POLLAK Grenzen des Sagbaren, S. 89.
Laut Geoffrey Hartman dient die Erinnerung dazu, den Verlust der Zeit vor der Verfolgung
aufgrund des Fehlens von Fotos oder persönlichen Gegenständen der ermordeten Verwandten zu
kompensieren und gleichzeitig im Prozeß des Trauerns der Ermordeten zu gedenken. Deshalb sind
die Erinnerungen auch nach fünfzig Jahren noch so intensiv wie unmittelbar nach Kriegsende:
„Aber die allgemeine Genauigkeit des Erinnerns ist erstaunlich: man hat vermutet, daß die
Überlebenden in Abwesenheit materieller Überbleibsel aus ihrem vorherigen Leben (wie zum
Beispiel Fotos oder persönliche Gegenstände, mit denen sie etwas verbanden) jedes Bruchstück an
Erinnerung wie einen Schatz hüteten. Der Möglichkeit beraubt, Beerdigungen und förmliche Rituale
abzuhalten, mag gerade die Schmerzhaftigkeit ihrer Erinnerungen zu einem für die Trauerarbeit
wichtigen Identitätsmal geworden sein, das auch in der Zeit nach der Befreiung weiterwirkte.“
HARTMAN Von Überlebenden lernen, S. 198.
Sie stehen zudem in einer Lebensphase, die ihre ermordeten Verwandten nie erreichen konnten, was
ihren frühen Tod und den Abbruch der Generationenfolge um so schmerzlicher ins Bewußtsein
treten läßt. Vgl. LEZZI, EVA Leben und Älter werden, S. 392., sowie Marta N., Anm. 210.
„Wird das Verhalten im KZ auch nur implizit mit der Elle der herrschenden Moral gemessen, müssen sich letztlich die ,Überlebenden‘ mit der unhaltbaren Erwartung auseinandersetzen, daß sie sich
wie Helden verhalten und damit nicht nur überlebt, sondern auch ihre Würde gewahrt haben sollen.
Die bloße Antizipation eines solchen Anspruchs macht jede Kommunikation über das KZ äußerst
schwierig.“ POLLAK, S. 165.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Obwohl es den Überlebenden aus diesen Gründen schwer fällt, direkt über traumatische Erlebnisse zu sprechen, sind es gerade diese, die ihre Erinnerung prägen, und sich
demzufolge in der Erzählstruktur niederschlagen. Die Erinnerung, so wurde im ersten
Kapitel erläutert, konstituiert sich aus biographisch bedeutsamen Erlebnissen, wobei sie
je nach Gegenwartsperspektive umgedeutet werden. Traumatische Erfahrungen bleiben
nicht nur unvergeßlich, sondern sie sind so prägend, daß die Betroffenen sich ihnen ein
Leben lang meist nicht entziehen können:
„Als traumatisch im psychologischen Sinne soll ein Ereignis bezeichnet werden, das die
Lebensgeschichte bzw. das subjektive Zeitbewußtsein nachhaltig stört; der Betroffene
leidet an Reminiszenzen, an einer Vergangenheit, die nicht vergeht. Das Ereignis ist
zumeist so gravierend, daß es zunächst verdrängt wird, es bleibt dann latent, bis es durch
einen späteren Anlaß wieder aktualisiert wird.“376
Daher fällt es den Überlebenden schwer, ihr Leben als sinnvolles Ganzes darzustellen
und die Shoah-Erfahrung in ihr Selbstbild zu integrieren:
„Die Verfolgung, die physische und psychische Vernichtung ihres Lebensumfelds und von
Teilen
ihrer
selbst
zerstörte
ihr
Kontinuitätsgefühl
nachhaltig.
Die
erlebte
Lebensgeschichte bietet sich diesen Menschen als „zerrissene“ und fragmentarische dar,
und ein Zusammenhang zwischen einzelnen Lebensphasen – und das bedeutet hier:
zwischen der Zeit vor der Verfolgung, der Verfolgungszeit und der Zeit nach dem
Überlebthaben – kann nur schwer hergestellt werden.“377
Die Analyse der vorliegenden Interviews hat zwei biographische Grundtypen ergeben,
nämlich Jirka und L. auf der einen, und Eva und Marta auf der anderen Seite, deren biographische Selbstdarstellung sich wesentlich unterscheidet aufgrund der Tatsache, daß
erstere nicht ihre gesamte Familie durch die Shoah verloren haben und daher im Gegensatz zu Eva und Marta Vor- und Nachkriegszeit miteinander verknüpfen können. So
schaffen beide ein kontinuierliches Selbstbild, in dem sie als engagierte aktive Persönlichkeiten erscheinen. Die Verfolgungszeit steht dazu in einem radikalen Gegensatz,
weshalb sie versuchen, die traumatische Erfahrung der Entmenschlichung und des völligen Ausgeliefertseins zu umschiffen. Dabei entwickeln sie unterschiedliche Strategien.
376 Trauma-Modell aus dem Kontext der Freudschen Psychoanalyse, aus: NOLTE, HELMUT Das Trauma
des Genozids und die Institutionalisierung der Erinnerung, in: BIOS 5 (1992), Heft 1, S. 83-93, hier
S. 88.
377 ROSENTHAL Erlebte und erzählte Lebensgeschichte, S. 120f.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
115
Jirka hält die Phase der Verfolgung äußerst knapp, verzichtet fast ganz auf schmerzhafte
oder erniedrigende Details und widmet sich in wesentlich größerem Umfang seinem politischen und beruflichen Werdegang vor und nach dem Krieg, was natürlich auch damit
zusammenhängt, daß er in diesen Bereichen wegen seiner Herkunft erneut Opfer
staatlicher Verfolgung wurde. L. hingegen schildert ihre KZ-Erfahrungen sehr ausführlich und stellt sich dabei selbst als handelndes Individuum in den Vordergrund, das
selbst in Momenten äußerster Entmenschlichung um Eigeninitiative und Fürsorge für
Hilfsbedürftige bemüht war. Gleichzeitig vermeidet sie es, besonders schmerzhafte Erlebnisse, wie die Ermordung ihres Vaters, direkt auszusprechen. Dieses Selbstbild einer
engagierten Person deutet sie in der Schilderung der Vorkriegszeit bereits an, um nach
1945 darauf aufzubauen.378 Außerdem fällt im Vergleich mit Eva und Marta bei beiden
auf, daß sie moralische Konflikte im Lager gar nicht thematisieren.379
So versuchen sie, den Bruch, den die Shoah für ihre Biographie bedeutete, zu umgehen, indem sie sich in ihrer Erzählung mit verschiedenen Mitteln darum bemühen, diese
Phase trotzdem in ihre Biographie zu integrieren.
Für Eva und Marta hingegen ist nach 1945 keine Möglichkeit gegeben, an die Vorkriegszeit anzuknüpfen, denn diese wurde mit ihren Familien zusammen ausgelöscht.
Entsprechend erscheint dieser Zeitraum lediglich als ungetrübtes Ganzes, das im völligen Kontrast steht zu dem, was danach kam. Die Schilderung der Verfolgung läuft entsprechend auf den Endpunkt Herbsttransporte zu, der die familiäre Einheit für immer
zerstörte, und nach Kriegsende ist die Gründung einer neuen Familie für sie die einzige
Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen und den Verlust der Angehörigen zu überwinden. Durch diesen Bruch mit der Vergangenheit ist es für sie unmöglich, ihre
Lebensgeschichte in einen kontinuierlichen Sinnzusammenhang zu bringen, sondern sie
zerfällt in ein ,Vorher‘ und ,Nachher‘. Man kann daher von einer zerbrochenen Identität
sprechen, da sie im Gegensatz zu Jirka und L. nicht einmal Vor- und Nachkriegszeit
miteinander in Einklang bringen können.
Trotz dieser zwei unterschiedlichen Grundtypen kann man mit Rosenthal für alle vier
Interviewpartner konstatieren, daß sie „ihr Leben nur im Referenzrahmen der Shoah se-
378 Wie bei den anderen Frauen steht zwar auch bei L. die Familie im Mittelpunkt der Darstellung, aber
sie betont stark ihren Beitrag zu Existenzsicherung, denn neben der Verfolgungserfahrung ist sicherlich der frühe Tod ihres Mannes mitverantwortlich für ihre Überzeugung, daß man sich im Leben
stets nur auf sich selbst verlassen kann.
379 Man denke an Martas Konflikt mit dem Diebstahl der Eßschale und Evas Notlüge, die für ihren Bekannten so fatale Folgen hat.
116
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
hen“380 können.381 Dies zeigt sich auch sehr deutlich in der Beschaffenheit ihrer
sozialen Identität.
3. Soziale Identität
Vor der Verfolgung stellte für keinen der Interviewpartner ihr Judentum in sozialer Hinsicht eine wesentliche identitätsstiftende Komponente dar. Unabhängig vom ethnischen
Umfeld waren alle vier sehr assimiliert, hatten jüdische wie nichtjüdische Freunde, und
die jüdische Religion spielte eine vollkommen marginale Rolle. Doch durch die Rassenideologie der Nationalsozialisten wurden sie auf einmal zu einer Zwangsgemeinschaft,
die auf die ethnische bzw. rassische Kategorie des ,Jüdischseins‘ reduziert und kollektiv
zum Tode verurteilt wurde. Somit stellte das Judentum für sie vorrangig eine gewaltsame äußere Fremdzuschreibung mit fatalen Folgen dar. Entsprechend fand auch in den
Lagern keine Identifikation mit dem Judentum statt, sondern man identifizierte sich mit
dem tschechischen Häftlingskollektiv. Nach der Befreiung wurde noch mehr als vor der
Okkupation Wert auf ein völliges Aufgehen in der tschechischen Gesellschaft gelegt,
um sich durch nichts von den nichtjüdischen Mitbürgern zu unterscheiden. Symptomatisch hierfür war die Änderung der deutschen Nachnamen in tschechische, die Jirka
und Marta vornahmen, der von Eva artikulierte Umstand, daß sie ihre Kinder ganz ,normal‘, d.h. nicht als Juden erzogen hat, um ihnen das Gefühl des Andersseins zu ersparen, und die jahrelange Verdrängung der Vergangenheit um ihrer selbst und auch um
der Kinder willen, wie sie Marta und Jirka zum Ausdruck bringen. Trotzdem bilden sie
erzwungenermaßen eine Schicksalsgemeinschaft, die sie ihr ganzes weiteres Leben mit
anderen jüdischen Überlebenden auf besondere Weise verbindet, was Jirka, wie zitiert
wurde, sogar selbst explizit ausspricht und bei den drei Frauen vor allem dadurch deutlich wird, daß sie alle drei nach dem Krieg jüdische Männer geheiratet haben, obwohl
das ,Jüdischsein‘ vor der Verfolgungszeit kein Kriterium für die Partnerwahl darstellte.
Zudem taucht bei allen in der Schilderung der Nachkriegszeit in verschiedenen Kontexten ein ,wir‘ der Überlebenden auf.
380 ROSENTHAL Erlebte und erzählte Lebensgeschichte, S. 126.
381 Zwar thematisieren Jirka und L. auch andere biographische Erlebnisse aus Vor- und Nachkriegszeit,
doch auch diese stehen im Kontext ihres Selbstbildes, das maßgeblich von der Shoah gepägt ist. So
spielt der Kommunismus für Jirka bereits vor dem Krieg eine wichtige Rolle, aber seine KZ-Erfahrung ist es, die ihn darin bestärkt und in späteren Krisensituationen die alte Verfolgungsangst wieder
hochkommen läßt. Und der von L. so ausdrücklich betonte katholische Religionsunterricht auf dem
Lande ist vorrangig in Hinblick auf ihren späteren Emigrationsversuch von Bedeutung.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
117
F. Ausblick
In der vorliegenden Arbeit sollte u.a. gezeigt werden, wie fruchtbar es für den
Historiker sein kann, sich von der traditionellen historischen Methode zu lösen und
durch Verknüpfung der Oral History mit methodischen Anregungen aus den
Nachbardisziplinen neue Impulse für die Geschichtsschreibung zu gewinnen. Vergleicht
man das Bild, das einem von der Geschichte der tschechoslowakischen Juden durch den
ereignisgeschichtlichen
Überblick
einerseits
und
durch
die
Analyse
lebensgeschichtlicher Interviews direkt Betroffener andererseits vermittelt wird, zeigen
sich doch signifikante Unterschiede, die dafür sprechen, die Perspektive der betroffenen
Subjekte in die geschichtliche Darstellung mit hereinzunehmen.
So ergaben sich bei der Analyse von vier erzählten Lebensgeschichten Erkenntnisse
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Erleben, die aus einer ereignisgeschichtlichen Betrachtung der ,Juden in der Tschechoslowakei‘ nicht hervorgehen. Beispielsweise hat sich erwiesen, welchen Einfluß das soziale Umfeld der Vorkriegszeit sowohl
auf die subjektive Wahrnehmung als auch auf den faktischen Verlauf der Verfolgung
hatte, etwa im Fall der deutsch assimilierten Juden, die wesentlich früher Diskriminierungen erfuhren als die tschechisch assimilierten Juden. Oder es zeigte sich, daß trotz
des voranschreitenden Ausgrenzungsprozesses dieser Zeitraum von allen als Ganzes mit
dem Endpunkt Transport dargestellt wurde.
Diese Beispiele verdeutlichen den doppelten Erkenntnisgewinn der biographischen
Methode. Einmal erhält man Aufschluß über die soziale Verfaßtheit des Erlebens, d.h.
die äußeren Einflüsse der historischen bzw. sozialen Wirklichkeit, die die Erfahrungen
und die weitere Wahrnehmung des Biographen prägen. Zum anderen offenbart sich die
Ebene der heutigen, persönlichen Sicht der Dinge, die die biographische Erzählung beeinflußt. Drittens kann darüber hinaus aufgrund der Wechselwirkung zwischen Erleben
und Gegenwartsperspektive und der Tatsache, daß sich beides stets an sozialen Deutungsmustern orientiert, die soziale Beschaffenheit der Identität der Interviewpartner ermittelt werden.
Dies ermöglicht einen neuen Umgang mit Quellenmaterial, da nicht nur Daten der
äußeren Wirklichkeit wissenschaftlich verwertet werden, sondern ihre subjektive Verarbeitung mit einbezogen werden kann. Dadurch gewinnt die historische Forschung die
Möglichkeit, ihre Betrachtung auf andere historische Subjekte auszuweiten, deren Er-
118
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
fahrungen in den traditionellen schriftlichen Quellen nicht enthalten sind, so daß sie
nicht mehr nur als „statisches und abstraktes Element des historischen Hintergrunds“382
erscheinen, sondern die Auswirkungen von historischen Ereignissen und Prozessen für
ihr alltägliches Leben und Handeln damals wie heute deutlich werden.
382 FRIEDLÄNDER, SAUL Das Dritte Reich und die Juden, S. 12.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
119
G. Literaturverzeichnis
Theorie
Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte, hrsg. v. Berliner Geschichtswerkstatt, Münster 1994.
BERGER, PETER, L. / LUCKMANN, THOMAS Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 1970.
BOROVSKY, P. / VOGEL, B. / WUNDER, H. Einführung in die Geschichtswissenschaft I:
Grundprobleme, Arbeitsorganisation, Hilfsmittel, Opladen 1980.
BOTZ, GERHARD Neueste Geschichte zwischen Quantifizierung und „Mündlicher Geschichte“. Überlegungen zur Konstituierung einer sozialwissenschaftlichen Zeitgeschichte von neuen Quellen und Methoden her, in: Botz, Gerhard (Hg.): „Qualität und Quantität“: Zur Praxis der Methoden der historischen Sozialwissenschaft,
Frankfurt a. M. / New York 1988 (=Studien zur historischen Sozialwissenschaft,
Bd. 10), S. 13-42.
BRECKNER, ROSWITHA Von den Zeitzeugen zu den Biographen. Methoden der Erhebung und Auswertung lebensgeschichtlicher Interviews, in: Alltagskultur,
Subjektivität und Geschichte, S. 199-222.
BRIESEN, DETLEF / GANS, RÜDIGER Über den Wert von Zeitzeugen in der deutschen
Historik, in: BIOS (Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History) 6
(1993), Heft 1, S. 1-34.
CHRISTL, ILONA The connection between life-course and the civil right movement
Charta 77 and its contribution to the development of a civil society. Soziologischer Teil des Endberichts des Forschungsprojektes 28/94 der CEU. Praha 1996.
DILTHEY, WILHELM Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den
Geisteswissenschaften, Göttingen 1979 (=Wilhelm Dilthey, Gesammelte
Schriften, Bd. VII).
DROYSEN, JOHANN GUSTAV Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, hrsg. v. Rudolf Hübner, München 1967.
FISCHER-ROSENTHAL, WOLFRAM Biographische Methoden in der Soziologie, in: Handbuch Qualitative Sozialforschung, S. 253-256.
FRIEDLÄNDER, SAUL Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 19331939, München 1998.
FRIEDLÄNDER, SAUL Auseinandersetzung mit der Shoah: Einige Überlegungen zum
Thema Erinnerung und Geschichte, in: Geschichtsdiskurs Bd. 5: Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945, Frankfurt a. M. 1999,
S. 15-29.
FRISCH, MAX: Das Lesen und der Bücherfreund, in: Ausgewählte Prosa, Frankfurt a. M.
1968.
FRUNDER-OVERKAMP, GESINE In Vorbereitung befindliche Universitätsschriften aus der
Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. Verzeichnisse 1995-1999 (Ausgabe
Nr. 34-38). München 1996-2000 (=Osteuropa-Institut München. Mitteilungen,
Bd. 11, 22, 29, 40 und 41).
120
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
FUCHS, WERNER Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden,
Opladen 1984.
Handbuch Qualitative Sozialforschung, hrsg. v. Flick. U. / v.Kardoff, E. / Keupp, H. /
v.Rosenstiel, L. / Wolff, München 1991.
HARTMAN, GEOFFREY, H.: Von Überlebenden lernen. Das Videozeugen-Projekt in
Yale, in: Ders. (Hg.): Der längste Schatten, Berlin 1999, S. 194-215.
HARTMAN, GEOFFREY, H. Zeitalter der Zeugenschaft: Steven Spielberg und die
Überlebenden der Judenvernichtung, in: FAZ, 10.9.1998, S.41.
HERZBERG, WOLFGANG Überleben heißt Erinnern. Lebensgeschichten deutscher Juden,
Berlin / Weimar 1990.
HYNDRÁKOVÁ, ANNA / LORENCOVÁ, ANNA Systematic Collection of Memories Organized by the Jewish Museum in Prague, in: Judaica Bohemiae 28 (1992), S. 5363.
HYNDRÁKOVÁ, ANNA / LORENCOVÁ, ANNA Česká společnost a židé podle vzpomínek
pamětníku, in: Terezínské Studie a Dokumenty 1999, Praha 1999, S. 97-118.
IGGERS, GEORG G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert, Göttingen 1993.
JECHOVÁ, KVĚTA Lidé a společenství charty 77. Souvislosti životních příběhů a
občanského hnutí Charta 77 se zřetelem na jeho přínos k rozvoji občanské
společnosti. Závěrečná zpráva historické části biografického výzkumu, Praha
1996.
KELLER, BARBARA Rekonstruktion von Vergangenheit. Vom Umgang der „Kriegsgeneration“ mit Lebenserinnerungen, Opladen 1996.
KÖLSCH, JULIA Nation heißt: sich erinnern...?, in: Nassehi, A. (Hg.): Nation, Ethnie,
Minderheit, Köln 1997, S. 287-307.
LAMNEK, S. (Hg.): Qualitative Sozialforschung Bd. 2: Methoden und Techniken, Weinheim 1993.
LANGER, LAWRENCE, L. Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, New Haven /
London, 1991.
LEZZI, EVA Oral History und Shoah. Ein Literaturbericht, in: Mittelweg 36 (1996),
S. 48-54.
LEZZI, EVA Leben und älter werden in Deutschland: Alltagserfahrung und Erinnerungsformen, in: Archiv der Erinnerung. Interviews mit Überlebenden der Shoah.
Bd. I: Videographierte Lebenserzählungen und ihre Interpretationen, hrsg. v.
Gelbin, Cathy / Lezzi, Eva / Hartman, Geoffrey / Schoeps, Julius, Potsdam 1998,
S. 357-395.
LICHTBLAU, ALBERT Als hätten wir dazugehört. Österreichisch-jüdische Lebensgeschichten aus der Habsburger Monarchie, Wien 1999.
LÜDTKE, ALF (Hg.): Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen
und Lebensweisen, Frankfurt a. M. 1989.
MEAD, GEORG HERBERT Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus, Frankfurt a. M. 1968.
MEYER, BEATE Projekt „Hamburger Lebensläufe – Werkstatt der Erinnerung“. Eine
Zwischenbilanz, in: BIOS (Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History)
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
121
7 (1994), Heft 1, S. 120-134.
MÜLLER-HANDL, UTTA „Die Gedanken laufen zurück...“ Hessische Flüchtlingsfrauen
erinnern sich, Wiesbaden 1993.
NIETHAMMER, LUTZ Diesseits des „Floating Gap“. Das kollektive Gedächtnis und die
Konstruktion von Identität im wissenschaftlichen Diskurs, in: Platt, Kristin / Dabag, Mihran (Hgg.): Generation und Gedächtnis: Erinnerungen und kollektive
Identitäten, Opladen 1995, S. 25-50.
NIETHAMMER, LUTZ: Einführung, in: Ders. (Hg.?): Lebenserfahrung und kollektives
Gedächtnis – Die Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1985, S. 7-33.
NIETHAMMER, LUTZ (Hg.): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis – Die Praxis
der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1985.
NIETHAMMER, LUTZ: „Oral History in den USA. Zur Entwicklung und Problematik
diachroner Befragungen“, in: Archiv für Sozialgeschichte 18, S. 457-501.
NIETHAMMER, LUTZ: Postskript. Über Forschungstrends unter Verwendung diachroner
Interviews in der Bundesrepublik, in: Ders. (Hg.): Lebenserfahrung und
kollektives Gedächtnis – Die Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1985,
S. 471-477.
NIETHAMMER, LUTZ / VON PLATO, ALEXANDER (Hgg.): Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960, Bd. 1: „Die Jahre weiß man nicht, wo man
die heute hinsetzen soll.“ Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet; Bd. 2: „Hinterher merkt man, daß es richtig war, daß es schiefgegangen ist.“ Nachkriegserfahrungen im Ruhrgebiet; Bd.3: „Wir kriegen jetzt andere Zeiten.“ Auf der Suche der
Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern. Bde. 1-2. Berlin / Bonn
1983; Bd. 3. Berlin / Bonn 1985.
NOLTE, HELMUT Das Trauma des Genozids und die Institutionalisierung der Erinnerung, in: BIOS (Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History) 5
(1992), Heft 1, S. 83-93.
OEVERMANN, U. Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre
allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften, in:
Soeffner, H.G. (Hg.): Interpretative Verfahren in den Sozial- und
Textwissenschaften, Stuttgart 1979, S. 352-434.
OSTERLAND, M. Die Mythologisierung des Lebenslaufs. Zur Problematik des Erinnerns,
in: Baethge, M. / Essbach, W. (Hgg.): Soziologie: Entdeckung im Alltäglichen,
Frankfurt a. M. 1983.
OTÁHAL, MILAN / VANĚK, MIROSLAV Sto studentských revolucí. Studenti v období
pádu komunismu – životopisná vyprávění, Praha 1999.
VON PLATO, ALEXANDER Einleitung zum Schwerpunkt: Oral History in der Sowjetunion, in: BIOS (Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History) 3 (1990),
Heft 1, S. 1-7.
VON PLATO, ALEXANDER Oral History als Erfahrungswissenschaft. Zum Stand der
„mündlichen Geschichte“ in Deutschland, in: BIOS (Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History) 4 (1991), Heft 1, S. 97-119.
POLLAK, MICHAEL Die Grenzen des Sagbaren. Lebensgeschichten von KZ-Überlebenden als Augenzeugenberichte und als Identitätsarbeit, Frankfurt M. 1988.
122
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
QUINDEAU, ILKA Trauma und Geschichte. Interpretationen autobiographischer Erzählungen von Überlebenden des Holocaust, Frankfurt a. M. 1995.
ROSENTHAL, GABRIELE „... Wenn alles in Scherben fällt...“ Von Leben und Sinnwelt
der Kriegsgeneration, Opladen 1987.
ROSENTHAL, GABRIELE Geschichte in der Lebensgeschichte, in: BIOS (Zeitschrift für
Biographieforschung und Oral History) 2 (1988), S. 3-15.
ROSENTHAL, GABRIELE „Als der Krieg kam, hatte ich mit Hitler nichts mehr zu tun.“
Zur Gegenwärtigkeit des „Dritten Reichs“ in erzählten Lebensgeschichten,
Opladen 1990.
ROSENTHAL, GABRIELE Antisemitismus im lebensgeschichtlichen Kontext. Soziale
Prozesse der Dehumanisierung und Schuldzuweisung, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 3 (1992), S. 449-479.
ROSENTHAL, GABRIELE: Die erzählte Lebensgeschichte als historisch-soziale Realität.
Methodologische Implikationen für die Analyse biographischer Texte, in: Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte, S. 125-138.
ROSENTHAL, GABRIELE Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur
biographischer Selbstbeschreibungen, Frankfurt a. M. 1995.
ROSENTHAL, GABRIELE Überlebende der Shoah: Zerstörte Lebenszusammenhänge –
Fragmentierte Lebensgeschichten, in: Fischer-Rosenthal, W. / Alheit P. (Hgg.):
Biographien in Deutschland, Opladen 1995, S. 432-455.
ROSENTHAL, GABRIELE Der Holocaust im Leben von drei Generationen. Familien von
Überlebenden der Shoah und von Nazi-Tätern, Giessen 1997.
ROSENTHAL, GABRIELE / FISCHER-ROSENTHAL, WOLFRAM Narrationsanalyse biographischer Selbstpräsentationen, in: Hitzler, R. / Honer, A. (Hgg.): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik, München 1997, S. 133-164.
SALNER, PETER Prežili Holokaust, Bratislava 1997.
SCHÜTZ, ALFRED Gesammelte Aufsätze 1. Das Problem der sozialen Wirklichkeit, Den
Haag 1971.
SCHÜTZ, ALFRED. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Frankfurt a. M. 1974.
SCHÜTZE, FRITZ Kognitive Figuren des autobiographischen Stehgreiferzählens, in:
Kohli, M. / Robert, G. (Hgg.): Biographie und soziale Wirklichkeit, Stuttgart
1984, S. 78-117.
SIEDER, REINHARD Bemerkungen zur Verwendung des „Narrativinterviews“ für eine
Geschichte des Alltags, in: Zeitgeschichte 9 (1982), S. 164-178.
STRAUB, JÜRGEN Zeit, Erzählung, Interpretation. Zur Analyse von Erzähltexten in der
narrativen Biographieforschung, in: Röckelein, H. (Hg.): Biographie als
Geschichte, Tübingen 1993.
VORLÄNDER, HERWART Mündliches Erfragen von Geschichte, in: Vorländer, Herwart
(Hg.): Oral History. Mündlich erfragte Geschichte, Göttingen 1990, S. 7-28.
WEBER, MAX Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie,
Tübingen 1980 (1921).
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
123
WELSKOPP, THOMAS Westbindung auf dem „Sonderweg“. Die deutsche Sozialgeschichte vom Appendix der Wirtschaftsgeschichte zur Historischen Sozialwissenschaft, in: Geschichtsdiskurs Bd. 5: Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und
Neuorientierungen seit 1945, Frankfurt a. M. 1999, S. 191-237.
Historischer Überblick
ADLER, H.G. Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft, Tübingen 1955.
Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“. K 55. Výročí hromadné
deportace evropských Židů. Mezinárodní vědecká konference, Ostrava 1995.
BENZ, WOLFGANG Endlösung – zur Geschichte des Begriffs, in: Akce Nisko, S. 62-77.
BLODIG, VOJTECH Die letzte Phase der Entwicklung des Ghettos in Theresienstadt, in:
Theresienstadt in der „Endlösung der Judenfrage“, hrsg. v. Kárný, M. / Kárná, M.
/ Blodig, V., Prag 1992, S. 267-278.
BRANDES, DETLEF / KURAL, VÁCLAV (Hgg.): Der Weg in die Katastrophe, Essen 1994.
BROD, PETER: The Jews of Czechoslovakia after the Political Changes of 1989, in: Review of the Society for the History of Czecholsovak Jews 4 (1991/92),
S. 151-165.
BROD, PETER Židé v poválečném Československu, in: Židé v novodobých dějinách,
Praha 1997, S. 147-162.
COHEN, RENAE / GOLUB, JENNIFER Attitudes towards Jews in Poland, Hungary and
Czechoslovakia. A comparitive Survey, New York 1991.
FLEISCHMANN, GUSTAV The Religious Congregation, 1918-1938, in: The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys, Vol. I, Philadelphia / New York
1968, S. 267-329.
FRIEDMANN, FRANZ Einige Zahlen über die tschechoslowakischen Juden, Prag 1933.
HAHN, FRED The Dilemma of The Jews in The Historic Lands of Czechoslovakia.19181938, in: East Central Europe 10 (1983), S. 24-39.
HAHN, FRED Treatment of the Holocaust in Postcommunist Czechoslovakia (The Czech
Republic), in: Braham, R. (Hg.): Antisemitism and the Treatment of the Holocaust
in Postcommunist Eastern Europe, New York 1994, S. 57-78.
HÁJKOVÁ, ALENA Erfassung der jüdischen Bevölkerung des Protektorats, in: Theresienstädter Studien und Dokumente 1997, hrsg. v. Kárný, M. u.a., Prag 1997,
S. 50-62.
HERMAN, JAN The Development of Bohemian and Moravian Jewry, 1918-1938, in: Papers in Jewish Demography 1969, Jerusalem 1973, S. 191-206.
HILBERG, RAUL Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt M. 1990.
HOSTOVSKÝ, EGON The Czech-Jewish Movement, in: The Jews of Czechoslovakia.
Historical Studies and Surveys, Vol. II, Philadelphia / New York 1971,
S. 148-154.
IGGERS, WILMA Die Juden in Böhmen und Mähren, München 1986.
The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys, Vol. I-III, Philadelphia /
124
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
New York 1968-1984.
KAIENBURG, HERMANN Das Konzentrationslager Neuengamme 1938-1945, Bonn 1997.
KÁRNÝ, MIROSLAV „Konečné řešení“. Genocida českých Židů v německé protektorátní
politice, Praha 1991.
KÁRNÝ, MIROSLAV Ergebnisse und Aufgaben der Theresienstädter Historiographie, in:
Theresienstadt in der „Endlösung der Judenfrage“, hrsg. v. Kárný, M. / Kárná, M.
/ Blodig, V., Prag 1992, S. 26-40.
KÁRNÝ, MIROSLAV Die Protektoratsregierung und die Verordnungen des Reichsprotektors über das Jüdische Vermögen, in: Judaica Bohemiae 29 (1993), S. 54-66.
KÁRNÝ, MIROSLAV Terezínský rodinný tábor v „konečném řešení“, in: Terezínský
rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau. Sborník z mezinárodní konference, Praha
7.-8.3.1994, hrsg. v. Kárný, M. / Kárná, M. / Brod, T., Praha 1994, S. 35-49.
KÁRNÝ, MIROSLAV Kalendárium terezínského rodinného tábora v Birkenau (19431944), in: Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, Sborník z mezinárodní
konference, Praha 7.-8.3.1994, hrsg. v. Kárný, M. / Kárná, M. / Brod, T., Praha
1994, S. 190-198.
KÁRNÝ, MIROSLAV Die tschechoslowakischen Opfer der deutschen Okkupation, in:
Brandes, Detlef / Kural, Václav (Hgg.): Der Weg in die Katastrophe, Essen 1994,
S. 151-160.
KÁRNY, MIROSLAV Die Theresienstädter Herbsttransporte 1944, in: Theresienstädter
Studien und Dokumente 1995, hrsg. v. Kárný, M. u.a. Prag 1995, S. 7-31.
KESTENBERG-GLADTSTEIN, RUTH The Jews between Czechs and Germans in the Historic Lands, 1848-1918, in: The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and
Surveys, Vol. I, Philadelphia / New York 1968, S. 21-71.
KOLB, EBERHARD Bergen-Belsen. 1943 bis 1945, Göttingen 1996.
KREJČOVÁ, HELENA Český a slovenský antisemitismus 1945-1948, in: Stránkami
soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám Karla Kaplana, Praha 1993,
S. 158-172.
KREJČOVÁ, HELENA Židé a česká společnost. Léta 1938-1939, in: Akce Nisko, S. 53-61.
KULKA, ERICH The Annihilation of Czechosloval Jewry, in: The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys, Vol. III, Philadelphia / New York 1984,
S. 262-328.
LEDERER, EDUARD Krize v židovstvu a v židovstí, Praha 1934.
LEDERER, ZDENěK Terezín, in: The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and
Surveys, Vol. III, Philadelphia / New York 1984, S. 104-164.
LEXA, JOHN G. Anti-Jewish Laws and Regulations in the Protectorate of Bohemia and
Moravia, in: The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys,
Vol. III, Philadelphia / New York 1984, S. 75-103.
LIPSCHER, LADISLAV Die soziale und politische Stellung der Juden in der Ersten Republik, in: Die Juden in den böhmischen Ländern, Vorträge der Tagung des
Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 27.-29. November 1981, München /
Wien 1983, S. 269-280.
MAIMANN, SAMUEL Das Mährische Jerusalem, Prostějov 1937.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
125
MENDELSOHN, EZRA The Jews of East Central Europe Between The World Wars,
Bloomington 1983.
MEYER, PETER Jews in the Soviet Satellites, Syracuse 1953.
MILOTOVÁ, JAROSLAVA Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Prag, in:
Theresienstädter Studien und Dokumente 1997, hrsg. v. Kárný, M. u.a., Prag
1997, S. 7-30.
PÄTZOLD, K. / SCHWARZ, E. Tagesordnung: Judenmord. Die Wannseekonferenz am
20. Januar 1942. Eine Dokumentation zur Organisation der „Endlösung“, Berlin
1992.
PÄTZOLD, KURT „Die vorbereitenden Arbeiten sind eingeleitet.“ Zum 50. Jahrestag der
Wannseekonferenz, inTheresienstadt in der „Endlösung der Judenfrage“, hrsg. v.
Kárný, M. / Kárná, M. / Blodig, V., Prag 1992, S. 51-62.
POJAR, MILOS 1000 let společného života Židů a Čechů v českém státe, in: Akce Nisko,
S. 21-31.
POLÁK, ERICH Perzekuce Židů v protekorátu v letech 1939-1941, in: Akce Nisko,
S. 174-182.
RABINOWICZ, AHARON MOSHE The Jewish Minority, in: The Jews of Czechoslovakia.
Historical Studies and Surveys, Vol. I, Philadelphia / New York 1968, S. 155-265.
RABINOWICZ, OSKAR K. Czechoslovak Zionism: Annalecta to a History, in: The Jews of
Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys, Vol. II, Philadelphia / New York
1971, S. 19-136.
ROTHKIRCHEN, LIVIA The Jews of Bohemia and Moravia: 1938-1945, in: The Jews of
Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys, Vol. III, Philadelphia / New
York 1984, S. 3-74.
ROTHKIRCHENOVÁ, LIVIE Osud Židů v Čechách a na Moravě v letech 1938-1945, in:
Osud Židů v Protektorátu 1939-1949. Sborník studií Livie Rothkirchové, Evy
Schmidt-Hartmannové a Avgidora Dagana, Praha 1991, S. 17-79.
ROTHKIRCHEN, LIVIE Motivy a záměry protektorátní vlády v řešení židovské otázky, in:
Akce Nisko, S. 160-173.
SCHMIDT-HARTMANN, EVA Protektorat Böhmen und Mähren, in: Benz, Wolfgang
(Hg.): Dimension des Völkermords: Die Zahl der jüdischen Opfer des
Nationalsozialismus, München 1996, S. 353-379.
SKORPIL, PAVEL Probleme bei der Berechnung der Zahl der tschechoslowakischen
Todesopfer des nationalsozialistischen Deutschland, in: Brandes, Detlef / Kural,
Václav (Hgg.): Der Weg in die Katastrophe, Essen 1994, S. 161-164.
SRUBAR, HELENA Eine schreckliche Zeit. Tschechisch-jüdische Überlebensgeschichten
1939-1945, Konstanz 2001.
STÖLZL CHRISTOPH Die ,Burg‘ und die Juden, in: Bosl, K. / Steinbach, M. K. (Hgg.):
Die ,Burg‘. Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš, Bd. II, München 1974, S. 79-110.
STRÁNSKÝ, HUGO The Religious Life in the Historic Lands, in: The Jews of
Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys, Vol. I, Philadelphia / New York
1968, S. 330-357.
126
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
SVOBODOVÁ, JANA Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992, Praha
1994.
Terezínská pamětní kniha. Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy
1941-1945, Díl.I. a II., hrsg. von Miroslav Kárný, Praha 1995.
Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, Sborník z mezinárodní konference,
Praha 7.-8.3. 1994, hrsg. v. Kárný, M. / Kárná, M. / Brod, T., Praha 1994.
Theresienstadt in der „Endlösung der Judenfrage“, hrsg. von Kárný, M. / Kárná, M. /
Blodig, V., Prag 1992.
Theresienstädter Studien und Dokumente 1994-1999, hrsg. v. Kárný, M. u.a., Prag
1994-1999.
The Use of Antisemitism against Czechoslovakia. Facts, Documents, Press Reports,
London 1968.
WELTSCH, FELIX Masaryk und der Zionismus, in: Rychnovsky, Ernst (Hg.): Masaryk
und das Judentum, Prag 1931, S. 67-116.
WITTE, PETER Deportationen ins Ghetto Litzmannstadt und Vernichtung in Chelmno –
Zwei Etappen des Entscheidungsprozesses in der „Endlösung der Judenfrage“, in:
Akce Nisko, S. 148-159.
WLASCHEK, RUDOLF M. Juden in Böhmen, Wien / München 1990.
ZÁMEČNÍK, STANISLAV Der Fall Nisko im Rahmen der Entstehungsgeschichte „der
Endlösung der Judenfrage“, in: Akce Nisko, S. 92-99.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
127
128
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Anhang
Dokument l: Marta N.
Helena: Je 1. října 98 a jsem tady u paní N., a prosila bych Vás, abyste mi vyprávěla svůj celý
život, od začátku, od dětství, jak se na to pamatujete, co Vám je důležité. Marta: No jsem
narozená v Táboře, je to v Jižních Čechách, je to překrásné historické staré město, vyznačovalo
se tím, že bylo vždycky jenom české, ryze české, a že dejme tomu 45 km vzdálenější
Budějovice byly už napůl německé a u nás tedy se německy nemluvilo nikdy. Byli jsme patrioti
náramný. To město je velice krásné, leží mezi řekou Lužnicí a rybníkem Jordánem. Já jsem
měla moc hezké dětství, krásné dokonce, měla jsem ještě bratra o čtyři roky mladšího, s kterým
jsme se měli velice rádi a zrovna 28. září, teď před třemi dny, jsem svítila svíčičku na památku
jeho, protože to byl den, kdy jsem ho naposled viděla, kdy odcházel 28. září roku 44 s
transportem z Terezina do Osvěčimi. Zahynul, když už o něm mluvím a vzpomínám na něj,
zahynul v Litoměřicích na Richardu, to byla... nikdo jsme vlastně ani nevěděli, že tam je
příšernej KZ a bohužel asi týden před koncem války... To byli český mládenci, kluci v jeho
věku tenkrát, asi kolem dvaceti, dvaadvaceti let, kteří byl odtransportováni z Terezína do
Auschwitzu a odtud do Litoměřic. Z těch všech se vrátil pouze jeden, Petr Langsielový, nikdo
jiný z nich to nepřežil..., ale to jsem přeskočila trochu. A já jsem vyrostla ve velice
spořádaných... Helena: Jaký jste ročník? Marta: Jsem ročník 1919, můj bratr byl 1923. Já
jsem..., my jsme měli doma, na hlavní třídě jsme bydleli proti divadlu, měli jsme obchod a
výrobu konfekce. Když v roce 39 se z nás stal Boehmen und Maehren, protektorát, tak jsme
jako Židi po různých zákazech a nařízeních, kdy se začaly odevzdávat napřed, já nevím, zlato a
sportovní věci, jízdní kola, šicí stroje, prostě všechno, každý týden vyšlo jiné nařízení, co jsme
nesměli mít, kdy jsme museli začít nosit hvězdy a byli omezovaný i v nákupech nebo v době
nákupu, museli jsme opustit náš byt na hlavní třídě, kde Židi nesměli bydlet a přestěhovali nás
do příšerného bytu na Staré město v Táboře, z našeho velikého čtyřpokojového bytu do kuchyně
a pokoje, a to všechno ještě pořád...bylo to hrozný, ale pořád jsme ještě byli doma. V tu dobu
tenkrát... ještě chci říct, že já jsem byla zasnoubená s učitelem, který byl křesťan, chodila jsem s
ním necelých šest let, mí rodiče celkem dost... mě nutili dokonce, abysme se vzali v domnění, že
třeba se zachráním a aspoň... byla to doba šílená. No já jsem ovšem odmítla nakonec, i když už
bylo dohodnutý, kdy se budeme brát, tak já jsem to nakonec odmítla, protože jsem chtěla... a
myslela jsem si, že bude mnohem lepší, když půjdu s rodičema, že jim budu víc nápomocná než
když budu někde placatit se a budu sama a budu mít o ně starost. Čehož nelituju, nikdy jsem
nelitovala, ale k tomu se ještě dostanu. V době, asi začátkem 42. roku, ano, nebo konec 41.
roku, v Táboře byl velkostatek... blízko Tábora byl velkostatkář pan Vodňanský, bylo to mezi
Bechyní a Táborem u Malšic, a ten si na pracovním úřadě vyžádal levnou pracovní sílu, tudíž
Židovky, mladé holky, tenkrát jsme byly mladé a chodily jsme tedy denně, já už to dneska
nevím, ale strašné moc kilometrů pěšky tam a pěšky zpátky. Přesto prese všechno jsme to tak
nějak braly víceméně z legrace a..., byly jsme holt mladý. Musely jsme být do osmi hodin večer
doma, to byl zákaz chodit po osmé hodině.,. vycházet a byl taky zákaz vycházet z okresu, tzn.,
že to už nebyl okres Tábor, kam my jsme chodily, tudíž jsme musely mít zvláštní povolení na
to. A když nás ta práce nebo pan velkostatkář tam zdržel, protože nám dával tu nejhroznější
práci, kterou ani deputátníci mu nechtěli dělat, třeba když byl největší vítr, tak jsme práškovaly
pole a tak různě. A my jsme mu chtěly dokázat, že přesto, že jsme Židovky... a říkalo se že
Židovky jsou lenivý, tak jsme mu chtěli dokázat, že to, co uměj jeho deputátníci, a dělali to celej
život, že my dokážeme taky, takže jsme se tam nadřely, dneska vidím, jaká to byla blbost ale
byly jsme holt mladý. Nadělaly jsme mu tam taky různý škody na těch polích, v poledne, když
šli deputátníci na oběd, tak my jsme jedly na poli a tam jsme, co jsme mohly kolem dokola mu
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
129
taky trochu poničily, abysme se mu pomstily. Třeba jsme lámaly větve na ovocných stromech...
různé takové věci..., stejně jsme mu tu škodu... to, co on udělal nám, to nebylo nic, ta pomsta
naše. Vzpomínám si... Helena: Víte, jak se jmenoval? Marta: Vodňanský. Jeho syn dostával
statek zpátky teď. Chodily jsme Táborem, tedy jsme musely procházet Starým městem
každý den do té práce, a když přišel... když přišla Heydrichiáda, to byla doba, kdy po
atentátu na Heydricha v květnu, tak jsme procházely Koutnovskou branou, to je starý
táborský hrad a tam byla v té bráně vyvěšena jnjéna lidi, které den před tím zatkli a ten
druhý den odpravili, zastřelili. A my jsme... jak jsme šly dolů k Lužnici, tak bylo už
slyšet... kolik tam bylo jmen tolik salv jsme slyšely z kasáren. Bylo to hr..., byla to
strašlivá doba. Můj bratr, ten jezdil zase na... blízko Tábora jezdili ty kluci mladý, do
dnešního... dneska se to jmenuje..., no býval to Baťov a dneska je to..., já si vzpomenu,
asi 10 km, ani ne, od Tábora. Tam jezdili dělat kanalizaci a různé věci, taky za pár
grošů. V zimě jsme, než jsme šly sem na ten statek, tak jsme musely chodit mést v zimě
sníh na ulicích, bylo to tak tristní, protože kluci, kteří s námi ještě tři roky předtím, než
přišli Němci, tancovali a stýkali jsme se a někteří z nich se dali k Vlajce, to byli vlastně
čeští fašisti, měli svůj časopis taky, týdeník, který se jmenoval Vlajka, a tam bylo
napsáno vždycky, každý týden o někom z nás, protože takřka všecky my Židovky a
nebo Židi mladí byli tak asimilovaní v tu dobu, že bylo jedno, jestli jsi Žid nebo nejsi
Žid a ta společnost byla tak smíšená, že víceméně jsme nerozlišovali nic, až když... od
doby, kdy přišli Němci. A tihleti Vlajkaři třeba stáli kolem nás, udělali obrovskej kruh,
když jsme museli mést sníh a řvali na nás: Hele Židovky, dělejte, dělejte!..., bylo jich
málo, nebylo jich mnoho u té Vlajky, ale bohužel byli. Po válce se dali potom prudce do
KSČ. To jsem sama svědkem toho, jednoho, o kterém vím konkrétně, že... kterej na nás
takhle pokřikoval, že byl potom nějakým dost vysokým funkcionářem v Libni v
podniku, jmenoval se Ota Ševčík, abych řekla všechno. Hodně jsem zapomněla, ale
tohle náhodou ne. No a tak jsme dělali dělali a čekali potom na transport. Proslýchalo
se: už přijde Tábor na řadu, potom zas Písek napřed, potom zas Budějovice a tak různě,
takže my jsme žili vlastně v očekávání, že odjedeme. Nevěděli jsme kam, ale už to bylo
tak deprimující všechno, že byly chvíle, kdy jsme si říkali, určitě mnozí z nás i já: Snad
už, aby to přišlo, protože tohle není život. Na ulici jsme nesměli, ten mládenec, s kterým
jsem tedy ty léta chodila, ten k nám chodil na černo, večer, když ho nebylo vidět, a to
jsme seděli v kuchyni, protože ven jsme spolu nemohli, a no bylo to hrozný. Ale bylo to
hrozný relativně, nebylo to nic proti tomu, co nás čekalo a co jsme prožili, to jsme
tenkrát naštěstí nevěděli. Můj bratr v tu dobu, protože byl v Táboře mladý rabín, Ota
Presser, který si vzal potom paní Ančerlovou, která se po válce vdala za Karla Ančerla,
dirigenta českého, tak ten zavedl v Táboře, v tom českém, ryze českém městě, mezi
těma českejma Židama, který o sionismu víceméně nic nevěděli, tak ty kluky trošičku
zverboval a á konto toho taky šli můj bratr a spoustu mládeže, omladiny, dělali
Hachšará, pokládali to za přípravu na tehdejší odjezd do Palestiny, tzn. že dělalo se v
zemědělství, taky zase u nějakého sedláka, velice těžce a taky všechno tam dokázali
jako ti, co to dělali celý život... Helena: To bylo ještě před válkou? Marta: To bylo před
válkou... Helena: V 38.roce? Marta: To bylo pozdějc, protože Němci přišli v 39. Takže
to bylo tak 38, 39. No ale potom dokonce, když už byl protektorát Boehmen und
Maehren, tak přišel bratr s tím, že by měl možnost odjet do Palestiny tehdejší, já jsem
ho prosila, aby to nedělal, bude mě to... až do smrti si to budu vyčítat, protože jsem
říkala že... prostě jednak jsem se o něj bála a za druhé jsem věděla, že by to rodiče
130
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
velice těžce nesli a myslela jsem si, že když budeme rodina pohromadě a my dva mladí,
že budeme rodičům, kteří byli relativně velice mladí, moje maminka, když šla do plynu,
byla tak stará, ani ne tak stará, ještě mladší o nějaký měsíc, jako je dneska můj syn.
Mému synovi je 52 let. Takže to byli relativně velice mladí lidé. No bratr zůstal,
neodjel, možná, že by to přežil a zachránil se, možná, že taky ne, co vím, ale mohla
jsem mu aspoňto šílený utrpení, který nakonec prožil, ušetřit. Pak konečně... no potom
chodily různé zprávy, co si smíme vzít sebou, jak mají být zabalený Bettrolle, to byly
peřiny zabalený do rolí, chystalo se sebou... kolik kilo si smíme vzít sebou inklusive
nějaké malé živobytí, takže se dělalo do foroty placičky, abysme měli a na sucho tohle...
a mladí lidi se začali přeškolovat na různá řemesla, protože se říkalo, jak je nutné, aby
jako každý měl nějaké řemeslo. Můj bratr se učil..., no učil, chodil za rohem k takovému
strašně slušnému, on byl tělesně postižený, chuděra, ale... hodinář v Táboře, já jsem
jméno zapomněla, ale byl velice, velice hodný k nám, tak ten tam chodil učit se jako
hodinářem a rozebral..., s velkým elánem se pustil do rozebírání hodin v bytě, to jsme
ještě bydleli doma ve svém velkém bytě. Všechny hodiny a budíky rozebral, potom je
musel nést tomu mistrovi, aby je dal dohromady, protože se mu vždycky buď
nedostávalo nějakého kolečka nebo mu přebývalo nějaké kolečko. No hodinářství nikdy
v životě nepoužil dál, ale to bylo všechno..., to jsme si všechno namlouvali. Pak přišel
den konečně, kdy bylo řečeno, že musíme do transportu a že odjedeme do Terezína.
Helena: Takže o Terezíně jste věděli, že to existuje? Marta: Ano, to jsme věděli, že to je
jako sbérnej ten..., věděli jsme taky, tak matně, to byly zprávy, že z Terezína jdou dál,
jmenovalo se to pracovni tábory že... jestli v tom Terezíně zůstanem nebo ne, to jsme
nevěděli. No přisel nakonec Befehl, že tedy budem odjíždět... že musíme opustit byt 13.
listopadu 1942. Tři dny, tedy dvě noce jsme spali ve škole, shodou náhod ve škole Hany
Benešové, tak se jmenovala, ta škola, tam jsem já taky chodila, určitě se všechny děti
hrozně těšily, že mají, že mají dva dny, dokonce čtyři dny, týden volna, protože šel
napřed transport Tábor-město, jmenoval se CB a potom šel Tábor-venkov. To bylo,
myslím, CB 2 nebo jak... to už se nepamatuju, tzn. ty vesnice kolem Tábora, které
okresem patřily do okresu Tábor, ty šly. Takže týden vlastně takřka měly ty děti volno a
určitě se strašně těšily, že mají volno a nikdo si z nich určitě neuvědomil na konto čeho
to volno dostaly. Protože my jsme v té škole přenocovali a 16. ráno asi ve 4 hodiny
jsme tedy museli sbalit Bettrolle a šli jsme na nádraží. My jsme si s bratrem vymysleli
předtím už, že ten klacek od koštěte, jak se to jmenuje, ta hůl, to jsme prostě vyndali z
toho koštěte a na ten jsme navlíkli ty různé role a ruksaky a tašky a nesli jsme to spolu,
abysme ušetřili jako tu tíhu rodičům. Byla to strašně smutná cesta přes celé město a v
Táboře se vědělo, že od kostela, z náměstí na nádraží je to kilometr a já až do dneska
mám představu, když mi někdo řekne 3 kilometry, tak si představuju tři cesty z náměstí
na nádraží, abych si..., abych věděla, kolik jsou asi 3 km. Takže jsme šli ten kilometr k
tomu nádraží, bylo to takové listopadové ošklivé počasí, studené, sychravé, sem tam
bylo vidět, že se odhrnuly záclony, když jsme šli hlavní třídou a lidi za záclonama
vykukovali, no a zřejmě někteří byli rádi, že se konečně zbaví Židů, ačkoli se žilo až do
doby než přišel..., než přišli Němci, tak se žádný mimořádný antisemitismus... v Táboře
nebyl. Bylo to daný snad tím, že jsme byli tak sžitý s těma lidma, že se nedělaly žádné
rozdíly. Do templu... moje maminka byla sice věřící, ale nijak moc, do templu chodila
pouze na velké svátky jednou za rok, a to vždycky říkala, že jde jen z piety ke svým
rodičům, což dodržuju i já, protože se modlit neumím a vzpomínám na ně i jindy,
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
131
nejenom jako v tom templu. Můj tatínek byl, židovsky se tomu říká, amhorec, člověk,
který vůbec nevěřil, nikdy se nepostil, Židi mají... věřící Židi drží svátek, který se
jmenuje Jom Kippur, ten byl právě včera, a kdy se věřící Židi postí, můj tatínek se
nikdy nepostil, naše kuchařka se na ten den hrozně těšila, protože ta se postila a
nemusela vařit a panu šéfovi neuvařila ani kafe, natož aby mu dala oběd nebo snídani a
říkala, že mu vařit nebude, že se postí s námi, takže můj tatínek chodil do kavárny, kam
chodil velice rád, a i když nebyl půst, na to kafe i na ten oběd, a vím, že maminka každý
rok, na to si vzpomínám, byla smutná z toho, že tatínek prostě jí to snad dělá naschvál.
Když jsme potom byli v Terezíně, tak tatínek náš..., můj tatínek říkal: Vidíte, jakej já
byl tenkrát chytrej, já jsem se už tenkrát nepostil, takže já mám ňákej foršus, přece
jenom jsem byl chytřejší.
No a to jen tak mimo. Když jsme přijeli..., jo odjeli jsme z toho Tábora, tenkrát ještě
osobním vlakem, ne hitlákama, nákladníma vozama jako potom, tudíž ještě jako lidi
osobním vlakem a dovezli nás až do Bohušovic, protože v tu dobu ještě v Terezíně
nebyla... nebylo spojení až do Terezína. Vlak jel do Bohušovic a z Bohušovic se muselo
pěšky, což bylo zase pár hezkejch kilometrů, takže zase jsme nesli ty zavazadla. Přišli
jsme do Terezína, tam nás ukvartýrovali do nějakých kasáren. Terezín bylo kdysi
město... čistě město kasáren a v domech, které tam byly poskrovnu, žily pouze oficírské
rodiny. Celkem to mělo asi ca. 3 000 obyvatel celé to město, kde když udělali v 41. roce
z toho ghetto židovské, kam začaly chodit transporty napřed pouze z Cech a Moravy,
protože v tu dobu už Slovensko bylo samostatný stát, odtrhlo se od nás, drželo s
Němcema, takže napřed z Čech a z Moravy a potom vlastně z celé Evropy. V Terezíně
bylo, po různu, takových 50 000 - 60 000 Židů, protože tam byl velký posun, velký
pohyb lidí, transporty přicházely, transporty odcházely. My když jsme přijeli, tak nám
bylo řečeno, že nás nebudou ani ubytovávat, protože půjdeme hned dál. Takže na těch
rolích a na tom Gepaecku, co jsme si přinesli, jsme se váleli asi tři dni a potom přišli
nám oznámit, ze je už brzo k vánocům, že se rozhodli, tedy Němci, komandatura
německá, že začnou střídat Němce z té komandatury na vánoce, tedy dovolené, takže
nás ještě ukvartýrují a že pojedeme až po Novém roce někam. Takže jsme si oddechli,
no tak že nás ubytovali, prostě jsme se museli vystěhovat z těch kasáren, já už dneska
vůbec nevím, jak se jmenovaly, nevzpomínám si, šlojska jsme tomu říkali, prostě z ty
šlojsky jsme se vystěhovali. Můj tatínek byl z první války raněnej, jako mladej a měl
prostřelenou lopatku, tudíž byl invalida. Jak vzniklo tohle nařízení, že ti, kteří byli
ranění nebo byli invalidi z 1. světové války jsou chráněni, že nemusí být transponováni
dál, to nevím, ale každopádně mu bylo oznámeno, že chrání tím i svou manželku, mou
maminku, a celou tu dobu nebyli zařazeni do transportu. Zato já jsem byla takřka v
každém transportu, který jel. Vzhledem k tomu, že můj bratr měl mezi tou omladinou
známé, to byli vlastně tenkrát sionisti, takže někteří z nich dělali taky na tom
Transportleitunku, jakým způsobem nevím, z toho transportu jsem..., musela jsem
vždycky nastoupit, bylo to šílenej nervák a byla jsem vyreklamovaná, bohužel za mne
musel jít někdo jiný. Takovej je život, takóvej je osud. A můj bratr dělal v Terezíně v
Landwirtschaftu, v zemědělství, v zahradě a můj tatínek dělal Ghettowache v Terezíně,
byl určenej a to byla jako policie, se dá říct, chudák, měl takovou čepici..., nosili akorát,
jako jinou, všichni stejnou, kterou fasovali a měl nějaké služby, někde hlídal u kasáren.
A byli jsme ubytováni různě, někdo v kasárnách, my jsme byli čirou náhodou ubytováni
v jednom domě, dole byl kdysi obchod, byl to strašnej kamennej dům, studenej, v tom
132
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
obchodě bývalým... tam spali mužský, můj tatínek a muži ještě s ním a v prvním
poschodí jsem spala já s maminkou. Můj bratr bydlel někde na půdě s nějakou
omladinou. Bylo tam šíleně štěnic a blech. Měly jsme palandy v té místnosti, nedá se
říct v tom pokoji, bylo nás tam asi 10 nebo 12 v té malé místnosti, žen tedy nahoře. Ty
štěnice byly šílený, nejhorší to bylo v létě vždycky, to jich bylo ještě víc, to se spalo
potom na dvoře na dece, protože se vůbec nedalo spát vevnitř..., to byl..., to lezly úplně
ze zdi, když jsme si pověsily hřebík, abysme si mohly pověsit něco na hřebík a ten
hřebík vypadl, tak z té díry lezly procesím štěnice a blechy skákaly. Jinak já jsem byla
zařazená do Schneiderei, do dílny, kde se spravovaly uniformy pro německé vojáky- Až
nakonec potom, protože předtím, to jsem už byla chráněná zase já, protože byly určité
úseky zaměstnání, které Vás chránily před odjezdem do transportu a do Auschwitzu. To
jsem ovšem ze začátku neměla, to jsem žila sice taky, ale až když jsme spravovali ty
uniformy, tak jsme byli tak potřební, že jako nás nechtěli pouštět. V tu dobu mezitím
odjel můj bratr, musel prvním transportem, 28. září začal první transport, končil
jedenáctým transportem a sice 28. října. Tím prvním odjel můj bratr... Helena: 43 ?
Marta: 44. A já s rodičema jsem odjela tím posledním. Kdybych bývala věděla, ze je to
poslední, tak jsem nenastoupila, nenechala moje rodiče odjet, ovšem to jsme nevěděli.
Helena: Co jste věděli? Marta: Nic... Helena: A taky ne, kam pojedete? Marta: Nic, nic.
Že jedeme někam na práci do nějakého jiného lágru, ale kam, to jsme nevěděli. Vědělo
se třeba různě... od mých známých z Tábora přišel od syna Rudy Boehma, kamarád
mého bratra, taky byl s nima na Hachšará, přišel lístek z Auschwitzu, že konečné se
sešel s tatínkem. Jeho tatínek byl ale zatčen ještě v Táboře, odvezen do Oranienburku v
roce 41, dokonce přišla zpráva, aby poslali nějaké peníze a že můžou dostat jeho popel,
ta rodina. Takže se to jmenovalo, že byl umučenej, že zemřel. A najednou přišel li stek
od toho Rudy, od toho jeho syna, který už předtím odjel do Auschwitzu s nějakým
transportem, že se konečně sešel s tatínkem. A my jsme byli úplně u vytržení, když
jsme to četli, protože jsme si nedokázali domyslet, že se sešel s tatínkem, že to
znamenalo, že má už tak blízko do nebe, že se jako s tím tátou sejde, ale skutečně jsme
si namlouvali, že to byla tenkrát lež a že táta jeho žije. Až když jsme sami zjistili, co to
znamenalo. Takže jsme skutečně nic nevěděli. Já jsem v tu dobu, kdy dostali předvolání
mí rodiče, musela jsem a prosila jsem vedoucího produkce, kam ta Schneiderei, pod
kterou, to se jmenovalo produkce, patřila, se sepjatýma rukama, aby mě uvolnil, že se
hlásím dobrovolně s rodičema, což napřed nechtěl, potom nakonec jsem řekla, jestli mě
neuvolní, že se stejně se tam jako dostanu do hitláku, ze je nenechám odjet, tak mě
uvolnil. Někdo se mohl těšit, že dostal vysoké číslo a že se tímto zach..., někoho jsem
zachránila, protože když jsem se hlásila dobrovolně, tak někdo z těch... mohl být
vyřazený z transportu. Ale to mě do dneska nikdy nemrzelo a nemrzí, protože sice jsem
s nima jenom jela jenom tu cestu, protože ten moment, co jsme přijeli do Auschwitzu,
to bylo velice brzy ráno, pojem času nemám, nevím, jestli jsme jeli jednu noc a jeden
den nebo dvě noci a den nebo obráceně, nevím. Každopádně jsme úplně za tmy ráno
brzo přijeli, dorazili do Auschwitzu na rampu, museli jsme všechna zavazadla nechat v
hitláku. Ta cesta byla příšerná, nedalo se sednout, nedalo se lehnout, jen se stálo, a
nemohli jsme upadnout, protože jsme se opírali jeden o druhého, tak plnej byl ten
hitlák, hrozný to bylo, byly tam dvě takové konzervy, plechovky od velkých konzerv,
které se používaly, když někdo volal, že potřebuje na malou stranu nebo prostě na
záchod, tak to se podávalo nad hlavou, bylo to něco příšernýho, mezi mnou a maminkou
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
133
pod nohama nám umřel, spadl na zem, nějaký starší pán, který zemřel po té cestě, bylo
to prostě něco, něco, co se nedá vylíčit. Když jsme vylezli, museli vylézt z toho vagónu
napůl křiví a zmrzlí, tak křičeli ti esesáci, co na nás řvali: Ven, ven, ven. Nic se nesmělo
vzít, já jsem si připadala jako obrovská hrdinka, protože jsem propašovala takovou
malou kabelku pod kabátem s maminčinejma lékáma, myslela jsem si, jak nejsem
šikovná a chytrá, že se mi to podařilo. No a pak jsme, když jsme vylezli, na rampě stál
pan Mengele a museli jsme do dvoustupů, nebo vím já, čtyřstupů se zařadit. Ne napřed
zvlášť muži a zvlášť ženy. A to se šlo jako před pana Mengeleho a ten zase ještě
rozdělil, já jsem byla s maminkou, na mladé a staré, to znamená, jak jsme se pak
domysleli na práceschopné a ne práceschopné. Pochopitelně, že jsme všichni a všechny
vypadali o dvacet let starší, po ty šílený cestě, takže maminku zařadil do těch
práceneschopných, na links nebo rechts a mne na tu druhou stranu. U tatínka to bylo asi
taky tak, tam jsem..., tam figurovali samí muži na té druhé straně. Potom jsme stály až
do svítání zas na nějaké jiné rampě, kde nás takovej mladej esesák, kluk usmrkanej,
ošklivej, hlídal, nemůžu říct, že by na nás řval. Ale furt tam chodil a my jsme musely
stát a čekat, na co jsme nevěděly. A já jsem se ho troufala zeptat, kdy uvidíme ty, co šly
na tu druhou stranu, že tam mám maminku a on mi řekl: Zítra. A já jsem měla takovou
radost, že řekl zítra, že jsem sundala hodinky a dala jsem mu ty hodinky, které on si
vzal. A,.., ono to bylo jedno, protože pak jsme je stejně házely do misky, všecko, co
jsme měly. Ale o to nešlo, měla jsem aspoň chvilinku radost, že se sejdeme zítra. Pak
přijel náklaďák a odvážel nás někam, tedy nás vybrané na tu stranu asi k přežití. A tam
jsme přišly do obrovské místnosti, musely jsme všechno svléct ze sebe, samozřejmě,
kdo měl nějaký řetízek, to bylo stejně už jenom něco málo, zlato už se odevzdávalo,
akorát kdo měl Ehering, byl ženatej, vdanej, tak mu ho sřezali, hodinky kdo měl, to se
všechno házelo do nějakých misek, do nahá jsme se musely svléct a ve štrůdlu husím
pochodem jsme šly někam. Po té pravé straně v té místnosti byl takový obrovský plot
jako bývá u zahrady, jako plechový, železný a odzdola až nahoru ke stropu. A za tím
plotem bylo navršené až někde ke stropu šatstvo. To bylo to, co ty lidi museli ze sebe
svlékat. Když jsem přišla na řadu, tak jsem zjistila, že nás holej všude, od hlavy
počínaje až dolů a takže jsme byly od toho momentu bez vlasů a bez... oholené.
Vyfasovaly jsme nějaké věci na sebe, boty, které nám byly většinou veliké, mužské,
žádné punčochy, žádné prádlo, já jsem vyfasovala takové sametové šaty na tmavomodré
půdě a měly vždycky tři tečky-zelenou, červenou a žlutou a kabát černý, který neměl
futro, ale měl vatelín a to byla úžasná věc, protože ten vatelín jsem vyškubávala a
dávala jsem si ho mezi nohy, my jsme neměly žádné kalhoty a byl listopad. Někdy na
Dušičky asi jsme museli dorazit. A potom jsem si z něj dávala na hlavu.. .dělala
takový... jako z kapesníku se dělá dětem proti úpalu. No a byly jsme v Terezíně... byly
jsme v Auschwitzu, tu první noc nás zahnali ke krematoriu, to jsme potom zjistily až, ze
je to krematorium, stály jsme tam celou noc a byla to noc, kdy byli.. .kdy šli do plynu ti,
kteří byli vyřazení z toho transportu. Takže já jsem si odbyla pohřeb, nevím pro kolik
generací, dopředu, byla to strašná noc, pořád nás jenom počítali, Polky řvaly do piontek,
do piontek, to znamená do pětistupů, jak jsme pak zjistily, potom jsme k ránu zase šly
na ten... někam, kde jsme jako bydlely. Já nevím do dneska, jestli jsme byly.. já jsem
ztratila absolutně pojem času, jestli jsme byly v tom Auschwitzu pět dnů, týden nebo
deset dnů nebo čtyři dni, nevím. Vím, že přišel Befehl... nic jsme nedělaly, jen se furt
stály apely a furt nás počítali, vyfasovaly jsme esšálek a to bylo... pak přišli, že nás... že
134
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
jedeme dál. Přijel, jak jsme se pak dozvěděly, velký transport Židovek z
Ravensbrueckenu, veliký transport a nás bylo...nás nebylo mnoho, co nás vybrali, nás
připojili k těm ženám z Ravensbrueckenu a vždycky se to všechno dělalo v noci. A
vezli nás někam, nevěděly jsme kam, až najednou jsme vystupovaly z těch hitláků a
zase pěšky se šlo, ještě deku jsme taky fasovaly, takovou tu koňskou houni šedivou, ale
byla nade všecko, pokud byla a až jsme došly k nějakému obrovskému stanu, asi jako
celta, jako velikánský cirkus, no tam nás zahnali dovnitř, tam byla na zemi sláma, bylo
to velikánský, a tam jsme ležely na té slámě jako do herinků, jestli nevíte... nevíš, co to
je... Helena: Nevím... Marta: Hlavou takhle, nohy takhle, jeden měl tady hlavu... takže
když se... a hustě naskládaný, takže, když se jedna otočila, tak vzbudila celou řadu. A
ráno nás vyhnali, řekli, že nesmíme si vzít ven, jo /konec l. strany/... jsme si předsevzaly
a dobře jsme udělaly, protože ty, které tam zůstaly, tak když jsme se vrátily, byly pryč.
My jsme nebyly samy jenom jako české holky v těch... v tom... pod tou celtou, byly tam
Řekyně, byly tam Polky a všechno možný a kam se hrabeme my... nebo jsme se hrabaly
my v rychlosti a šikovnosti na Polky a Řekyně. Než my jsme se rozhlédly, tak už... ty
byly tak rychlé, specielně ty polské Židovky. A vyhnali nás ven, tam nám do esšálku
dali... říkali tomu kafe, ale bylo to aspoň vlažné a byly tam takový koryta dřevěný a
kohoutky vodovodní na některých místech, takže jsme se tam mohly umýt, ovšem to
bylo na poli, bylo v listopadu a bylo to, jak jsme se potom dozvěděly, kde jsme, u
Hannoveru. Takže byla šílená zima a my neoblečené, ještě nezvyklé na to, že jsme
holohlavé a bez punčoch a tak, to dneska a nikdy nepochopím, že ani jedna z nás
neměla rýmu ani kašel. K nevíře. A potom nás zase zahnali do toho... mezi tím se stály
apely, jak dlouho jsme pod celtou byly... bydlely, zase nevím, jestli dva dni nebo tři dni
nebo... nevím. Dlouho ale ne, ale najednou se strhla šílená sněhová bouře, ale tak
strašlivá, větrná, že tu celtu to nějak nadzvedlo nebo roztrhlo nebo co, takže nás vyhnali
z té celty ven, zase v noci a někam nás hnali. A furt jsme šly a furt jsme šly a to se
muselo ne jít, to se běželo a to šli spousta těch, nevím, co to bylo, těch šupáků
německejch, odpornejch a řvali: schneller schneller a nevím, co ještě všechno, některý
mlátili těma pažbama, až jsme doutíkaly do Bergen-Belsenu, takže tohle muselo být...
patřilo pod Bergen-Belsen taky, ta celta. A Bergen-Belsen byl obrovský koncentrační
tábor z postavených dřevěných takových... domků, kde už ale byly umývárny, tzn., že
vevnitř byla taková... taky zase kohoutek a tam už nebyly dřevěný, ale takový nějaký
kamenný ty nádoby. Takže tam samozřejmě byla studená voda, ale taky jsme nesměly
vždycky, ale když se... nás vyhnali, tak jsme aspoň mohly umýt ten esšálek nebo umýt
sebe nebo opláchnout se, protože jsme se neměly do čeho utřít, neměly jsme nic. A já
jsem do toho... mně ukrad někdo esšálek. Mít esšálek a nemít esšálek, to byla otázka
života a smrti. Já jsem spala na palandě s Lojzkou Kornfeldovou tehdejší, ta přežila, žije
ve Francii, pocházela z Prostějova, báječná holka a ta byla asi tak o půldruhé hlavy větší
než já, hrozně šikovná, mnohem šikovnější než my leckteré a říkala... ta mi ten svůj
esšálek půjčovala, ovšem to nebylo řešení, protože když jsme fasovaly tu zupku, to byla
polévka, jako polévka...no voda, ale bylo to vlažný, bylo to teplý, tak to každej se s tím
mazlil, aby mu to co nejdýl vydrželo a ona chuděra musela spěchat, abych ještě já
mohla dostat. Říkala: To není možný, musíš ukrást někomu ten esšálek, jinak jsem si k
němu nemohla pomoct. Tak ona mi naordinovala, jak ukradnu ten esšálek, šly jsme ráno
se jako mýt a když tam přišly ty mladé holky, ty Řekyně, které bylyj moc krásné a
takové rvavé, byly mladší než jsme byly my, převážně, tak ona, když se ta jedna Řekyně
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
135
myla a položila ten esšálek, tak ona si tak stoupla ta Lojzka šikovně a ukázala mi, že ho
musím vzít a utéct s ním. Byl to šílenej okamžik, to co jsem provedla, měla jsem
hroznej, špatnej pocit, že ona chuděra nebude mít z čeho jíst, ale Lojzka říkala: To holt
se nedá nic dělat, ona, buď ujištěná, ukradne rychleji než Ty tenhleten... ale bylo to...
byla to nutnost. Takže jsem měla esšálek, pak jsem měla hrůzu, aby nepoznala, že je to
její, ale to se nedalo rozpoznat a hrozně jsem si ho hlídala od té doby. A nato jsem
dostala žloutenku, šílenou, musela jsem mít asi vysokou teplotu, protože jsem spala...
když se vcházelo do toho baráku, tak tam byly takové... jak se to jmenuje... jako podél
kolem toho domu byly takový vykopaný strouhy, jámy a dřevěným můstkem se chodilo
do toho... přes to byl dřevěný můstek a tudy se chodilo. A já v té horečce, zřejmě asi, šla
jsem čůrat, nedošla jsem až na latrínu a spadla jsem do té jámy, kde bylo taky načuráno
a bůhví co všechno. Nikdo si nemůžete představit, co to bylo za hrůzu. To už byl určitě
konec listopadu, já jsem se neměla do čeho převlíci, v té studené vodě jsem to vyprala,
tak vymáchala trochu, holky mě odmítly dát na marodku, protože kdo šel na marodku,
ten se nevrátil. Takže já jsem celou žloutenku... a vykládaly mi, že jsem žlutší než citrón
a pomeranč dohromady, já jsem se neviděla, měla jsem tak obrovskej odpor, když
nosily... když se fasoval chleba, ten kousíček, to byla vůně, na kterou jsem se vždycky
těšily, ale při tý mý žloutence jsem měla takovej odpor, že mě to nutilo k zvracení,
chleba jsem jíst nemohla a Lojzka ten můj příděl vyměnila s nějakýma Maďarkama za
drobátko cukru, který mi nosila, já jsem ho lízala a vybírala mi ze své polévky a i z mé
polévky, já jsem ji jíst taky nemohla, jenom když tam bylo náhodou kousíček brambory,
tak mi to šla opláchnout, protože ten čuch té polévky mi otáčel žaludek. No takže já
celou žloutenku prostála bez... neoblečená a zastrčená za tou Lojzkou v té piontce, aby
mě nebylo vidět, protože byla o hodně větší, a holky z druhé strany si vhodně stouply,
aby mě nebylo vidět, že jsem tak žlutá a já jsem jí vlastně, tu žloutenku, vystála na
apelech. Potom nás přišli nakupovat... mezitím byly vánoce a ten šupák, to byl ňákej
esesák, kterej řekl naší Lageraelteste, Hertě Bondyové, že nás hned v lednu přijdou
vybírat na práci a aby nám všem řekla, abysme se všechny hlásily, že kdo zůstane v
Bergen-Belsenu, že nepřežije, nemůže přežít. No načež přijeli tři chlapi, mužský v
civilu, měli takové krátké kožíšky, takové jako mívají... mívali dřív ti chlapi, co chodili
vykupovat dobytek po vesnicích. A my jsme se musely svléct do nahá v takové menší
místnosti a chodily jsme pochodem jedna za druhou a řekli: Levou ruku nahoru, dělalo
se kruh, potom pravou ruku nahoru, pak otočit a pořád se chodilo. A oni vyřazovali z
toho kruhu různé naše holky. Byla se mnou taky Dita Petschová, která měla, chuděra,
strašně tlustý nohy a byla v jiným stavu. Bylo to ovšem ještě brzo, nebylo to vidět a tím,
ze jí vyřadili, tak jsme jí radily.. .nebo jedna jí tam radila: Zastrč hodně břicho a vystrč
zadek, aby oni se dívali na ten zadek a nedívali se na ty nohy. Ona je neměla oteklé, ona
měla prostě tak silné nohy, byla to krasavice jinak. Až se dostala... zase zpátky vlezla do
toho kruhu, takže s námi mohla odjet, a fakticky těch pár ženskejch, který se nezařadily
nebo nemohly dostat do toho kruhu, tak nepřežila ani jedna ten Bergen-Belsen, přestože
to nebyl Vernichtungslager, to znamená, že tam nebyl plyn. Ale tam se umíralo na hlad
a vysílení. A nás potom odvezli... no ještě si .vzpomínám na jednu episodu na Silvestra
a Nový rok. Na Nový rok ráno nás vyhnali, byl nádherný den, na takovou pláň velikou,
kde bylo spoustu borovic a jiných stromů, ale hlavně borovice zasněžené, plné sněhu a
nádherné slunce. Kdyby to nebylo v lágru, tak by to byl nejkrásnější den na horách.
Samozřejmě, že bez toho kafe ráno, bez snídaně nás vyhnali a stáli jsme tam. Jelikož
136
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
esesáci slavili zřejmě Silvestr a chrápali, tak sem tam vždycky přišel jeden, zařval,
spočítal nás a zase Sel. A my jsme tedy stály na ten Nový rok, už nikdy žádná z nás
nezapomene, úplně bez ničeho, bez žrádla, bez pití až do večera a pak nás nahnali
zpátky do baráku a ani to kafe nám večer nedali. To byl opravdu strašně smutnej Novej
rok, hroznej. a tahleta Dita Petschová, která chtěla být herečkou, jestli to přežije, taky
byla, ta moc hezky zpívala, takže vždycky začala zpívat, když ten esesák odešel,
všechny možný písničky od Voskovce a Wericha, a protože jsme byly všechny
pamětnice toho divadla, a lituju svoje děti i jinou omladinu, který nemohli prožít tu
dobu toho Osvobozeného divadla, protože to bylo nenapodobitelný, a takže jsme tam
zpívaly, což nás drželo jako při životě a pak zas vlítnul nějakej ten esesák atd. A potom
nějak v lednu, během ledna, nevím už kolikátého, skutečně nás odtransportovali, někam
a dojeli jsme do Raguhnu bei Dessau. To bylo blízko Drážďan, tam někde. A tam jsme
dělaly ve fabrice, něco jsme tam... nějaké součástky na letadla. Tam jsme byly slušnějc
ubytovaný a ráno jsme utíkaly zase... proč se muselo utíkat, proč jsme my musely být
první na tom dvoře v té fabrice, ale nesměly jsme do... kde dělaly dělníci vlastně z celé
Evropy tenkrát kromě Němců a nesměly jsme do fabrik dřív až tam budou všichni,
takže jsme musely stát vždycky na tom dvoře, a když jsme měly v poledne jít si pro
zupku, tak většinou byl nálet Angličanů, takže všichni šli do krytu, my jsme nesměly,
takže když bylo po náletu, tak už bylo taky po jídle. Takže Angličani nás připravili se
svými nálety většinou o žrádlo ještě...o žrádlo..no... o tu trochu polévky. Zajímavé bylo,
a je to nutný si na to vzpomenout, že tam dělali Češi, Francouzi, Jugoslávci, Ukrajinci, a
že ty Češi se k nám chovali nejhůř v tý fabrice. Já si nepamatuju, že by nám nějaký
Čech něco dal, dokonce jsme prosily, jestli by nám nemohli zprostředkovat nějaký...
zprávu malou, když jedou domů na dovolenou nebo tak, ani... i to odmítli. Kdo se k
nám velice dobře choval, byli Francouzi a holky z Ukrajiny. Ty nám dávali slupky od
brambor a někdy v těch slupkách byla i celá brambora, což bylo úžasný. A já jsem tam
neděla dlouho, protože jsem... mi najednou začala otékat noha, dostala jsem flegmónu,
to jsem nevěděla, že to je flegmóna, a otékalo to čím dál tím víc, až už jsem vůbec
nemohla, modralo to a byla tam námi nějaká maďarská... byla to přej zubařka a ta mi
rozřízla tu nohu, některé holky mi držely hlavu, některé držely pikslu, kam kapalo to...
ta krev a hnis. Čím mi to rozřízla, nevím, jestli... nevím. Nebyla žádná tinktura, žádnej
ten... a já jsem nedostala absolutně žádnou otravu, noha mi přestala otékat, hnis odešel a
mám ještě... mám úplně malou jizvičku vidět, prostě zázrak. No a potom nás
odtransportovali... pak se říkalo, že musíme... ještě něco, já jsem v tu dobu, kdy jsem
měla tu nohu nemocnou, nemohla chodit do práce a přišla ta... Lageraelteste, že ta
esesačka, co nás hlídala, že se jí ptala, kdo umí šít a ona, že řekla... jestli tam je někdo,
kdo umí šít a ta Herta řekla, že jo, myslela na mne, tím že nemůžu taky chodit dělat, do
práce, a přinesla celtu obrovskou jako stanovou, abych jí ušila ruksak, tornu. No tak
jsem... a přinesla jehlu a nit a já jsem řekla, no to bez náprstku nelze vůbec jako prošít...
ušít, no tak šla sehnat ještě náprstek a já jsem šila, v ruce tedy, tu tornu. Což bylo pro
nás pro všecky náramně povzbuzující, protože jsme si domyslely, že chce utéct a že se
zřejmě blíží fronta, což skutečně bylo. Takže to bylo takový plný naděje. A tahleta
šupačka dokonce, to už byla ta Dita Petschová..., to už na ní bylo vidět, že je v jiným
stavu, dokonce přinesla v krabici od bot nějakou jako dětskou výbavičku... no
výbavičku... pár kousků jako pro miminko, což bylo úplně... to všechno nasvědčovalo
tomu, že se něco děje, že se blíží fronta, protože normálně by to neudělala. No a když
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
137
ale jí to ukázala, tak řekla jako ty Hertě, že to tam nemůže nechat, že by se do toho daly
vši. My jsme měly bílý vši všechny, strašnou spoustu. To jsme tenkrát nevěděly, že bílý
vši přenášejí skvrnitý tyfus, ale bylo to hrozný v těch... Jo mezitím jsme fasovaly taky
ty štráfatý šaty, pruhovaný, musely jsme odevzdat tyhle šaty, takže jsme fasovaly tyhle
štráfatý šaty, no ale prádlo samozřejmě ne, takže jsme furt chodily bez kalhot a bez
punčoch, a byla zima, šílená, to bylo... v listopadu jsme tam přijely, tohle se všechno
odehrávalo v zimě. No a potom jsme... najednou bylo avízo, že druhej den nás budou
někam transponovat. Přijeli nákladníma autama a někam nás vezli, až jsme přijely na
nějaké nádraží, kde to bylo, nevím, tam nás naložili do hitláků a jely jsme těma
hitlákama. Vtěch hitlácích, v každém tom voze byl nějaký Rumun, to byli rumunský
vojáci, který se hlásili k Němcům a nás hlídali. Takže dva byli v každém tom hitláků,
taky spali na zemi jako my, jenomže měli co jíst- oproti nám. A tahleta Lojzka
Kornfeldová, která byla tak strašně tuchtig, ta, když oni usnuli, tak jim ukradla cibuli
nebo...no prostě co se dalo. A to nás vždycky odvezli někam a potom nám vzali
lokomotivu, my jsme musely ven. Po cestě nám umřelo moc holek, ty jsme musely
zabalit do těch dek... do ty deky a když jsme zastavili, tak jsme tu mrtvolu musely snést
pod vagón, a když jsme nastupovaly a jelo se dál zase, tak jsme musely zase tu mrtvolu
vynést do toho vagónu, aby jsme na počet.. aby počet souhlasil. No a najednou jsme se
dozvěděly, že jedeme do Drážďan, Drážďany nás nepřevzaly, jak jsme se později
dověděly, protože měly přeplněno, prý, tak nás... jsme se dozvěděly, že nás vezou do
Terezína. My jsme byly ten první transport, nejubožejší, kterej se vrátil v nejhroznějším
stavu do Terezína, všechny se skvrnitým tyfem. Moc holek zemřelo po cestě, ale tam v
Terezíně už z nás žádná, ale velký neštěstí jsme přinesly do Terezína, protože jsme
nakazily lidi, který v Terezíně přežili válku a nakazili se od nás a zemřeli na konec
války vlastně na skvrnitej tyfus. Vím o několika případech. Jak dlouho jsem byla v
Terezíně, nevím, vím, že to bylo až nějak do června, nemám absolutně do dneska
ponětí, mám absolutní vokno, čím jsem se dostala z toho Terezína do Prahy. Dozvěděla
jsem se, že můj bratr se nevrátil, což bylo pro mne to nejhroznější, protože že šli rodiče
do plynu to jsem... toho jsem byla svědkem, ale věřila jsem, že se vrátí bratr a
vymýšlela jsem si, co všechno udělám a musím udělat, aby mohl dostudoval, že nikoho
jiného nebude mít, a že je mou povinností prostě se o něj postarat. A byl to pro mne
úplný šok, když jsem se dozvěděla, že se nevrátí, že zemřel... No tak to je asi celá..., ani
půl slova jsem si nevymyslela, bohužel je to tak, spíš jsem na mnoho věcí zapomněla.
To je asi všechno. Stačí to? Helena: Jak to pak šlo dál? Marta: No když jsem se vrátila,
byla jsem sama, neměla jsem nikoho, měla jsem jenom bratrance v Táboře, kteří to oba
přežili a jednu tetu arijskou, křesťanskou, od maminčinýho bratra ženu a její tři dcery v
Praze. Když jsem se do té Prahy vrátila, říkám, nevím, jestli vlakem nebo... nevím jak,
tak jsem šla k té tetě, ty mi půjčily nějaké oblečení, vážila jsem 36 kilo, neměla jsem
vlasy, protože nás znovu, my už jsme měly takovýho ježečka, ale v tom Terezíně, když
jsme přijely tak zavšivený, tak nás znovu oholili dohola a já jsem se tak rvala, jak jsem
měla asi vysokou teplotu při tom tytu s tím, co nás stříhal, ty vlasy holil, že jsem mu asi,
nevím jak, ale každopádně mi zůstala tady taková...jako měl Spejbl nebo Hurvínek,
tohleto... to už jako mě nechal bejt, takže jsem byla příšerná, úplně bez vlasů. No nechla
jsem si udělat po válce klobouk s falešnejma žijónama, šitý jako na síťce, takže jsem v
červenci a v srpnu v největším horku chodila v tom klobouku. A rozhodla jsem se, že
prvního mužskýho, a musí to být Žid... Chci ještě říct, že ta moje známost, veliká láska,
138
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
se oženil mezitím, což jsem byla ráda, protože já bych si ho byla nikdy nevzala a byla
jsem rozhodnutá, že si můžu vzít pouze Žida, že nemůžu s nikým jiným žít, protože
nikdo jiný nemůže pochopit, co jsem prožila ajenom ten, kdo prožil totéž. A byt jsem
neměla, protože jsem se pozdě vrátila, byty už byly plné, rozdělené a moje přítelkyně z
Tábora se pak vrátila taky, taky sama, takže jsme hledaly byt a řekly jsme... mohly jsme
ho dostat, uplácely jsme tenkrát cigaretama kdekoho a nešlo to, buď jsme byly málo
šikovný nebo... nevím, takže jsem já se rozhodla, že si vezmu prvního mužskýho, kterej
bude mít byt, toho, že si vezmu. No a čirou náhodou jsme se seznámily s židovskejma
mládencema, můj manžel, tedy budoucí, ženatej už byl, měl dítě, dvouletého syna,
kterej šel do plynu s jeho manželkou, takže byl taky sám, byl o 11 let starší, a když jsme
se poznali, tak jsme si řekli, že se vezmeme bez veškeré lásky. Nic jsme o sobě nevěděli
než to, co jsme si vyprávěli, mohlo to špatně dopadnout, ale naštěstí to dopadlo dobře.
Ten měl garsoniéra v Praze ve Veverkovy ulici, kde nebylo nic, ani lustry, jenom
žárovka od stropu a špinavěj koberec a jedna postel železná a skříň. Takže tam jsme... já
jsem se k němu nastěhovala potom. Moje přítelkyně, té se vrátila teta, ta bydlela u tety,
ale potom si taky toho druhýho zase mládence vzala, no mládence..., už to byli starší
chlapi. No a moje jediná touha byla mít rodinu, mít dítě. Byla jsem na gynekologické
prohlídce, kde mi pan profesor řekl, že se musím smířit s tím, že děti nebudu moct mít,
já byla nešťastná, probrečela jsem kolik dnů a nocí a když jsem k němu přišla po druhé,
tak jsem řekla: Pane profesore, já jsem v jiném stavu. A on říkal: No to neříkejte,
nemůžete děti mít, vždyť jsem Vám to říkal, nesmíte se tou myšlenkou zabývat, to je
špatný, musíte se s tím smířit, eventulné dítě adoptovat. No a když mě prohlídl, tak
říkal, že jsem skutečně v jiném stavu, jak jsem to věděla. Já jsem mu řekla, že jsem si to
tolik přála, že si myslím, že jsem si to vyprala. Nechci říct vymodlila. A... takže se můj
syn narodil, jeden z mála, co vůbec šlo nejdřív. Bylo to asi trochu sobecký, protože
jsme vůbec si nedomýšleli nebo nemysleli na to, že to může mít taky nějaké následky,
že to dítě nemusí být zdravé, dneska nevím, že bysme bývali se tou myšlenkou zabývali.
Prostě chtěli jsme žít, chtěli jsme rodinu. Vzhledem k tomu, že můj manžel už ženatý
byl a tenkrát muselo být tzv. prohlášení za mrtvé, to dělaly soudy, to muselo viset tři
měsíce u soudu, jestli se někdo nepřihlásí, že toho dotyčného viděl živého. Můj manžel
to předal nějakému advokátovi, advokát to dal k blbýmu soudu, kam jsme nepatřili,
takže se to zase o tři měsíce protáhlo. A když konečně přišly ty papíry a ještě manželovi
další papíry, já jsem tak dalece měla, protože jsem byla svobodná, když byly papíry
pohromadě, tak byl květen. Já jsem byla v osmém měsíci a prohlásila jsem, že se vdávat
nebudu, až po porodu, protože jsem pověrčivá a česky se říká v máji na máry. Víš, co je
máry? To jsou ty, co se dává ta rakev na takový, co se nosí dřevěný, to se jmenuje máry.
Nevím, jak se to jmenuje německy. A já jsem říkala, ne já jsem... potom, co jsem
všechno přežila, teď neumřu, to ne. A až když mě moje přítelkyně nadávaly, že jsem
bláznivá, abych si uvědomila, že to dítě bude mít celej život v papírech, ze je
nemanželský a že mi budou ty sestry v nemocnici, který jsou většinou zlomyslný, nosit
dítě a budou říkat: Slečno, přinesly jsme Vám dítě k pití a takovýhle voloviny, takže
teprve potom jsem si dala říct a měli jsme ještě v tom květnu svatbu. Hrozně smutnou,
nikomu jsem to neřekla, šla jsem i bez kytky, tu jsem nechala doma, abych na tom
velkým břichu nenosila ještě kytku. Jako svědek mi byla moje sestřenice a manželovi
byl jeho kolega z práce. A byla to svatba nepěkná, smutná. 21. května jsme měli svatbu
a 5. června se narodil můj syn, 14 dní po svatbě. Takže to tenkrát ani jinak prostě nešlo.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
139
Helena: Je to Vaše jediné dítě? Marta: Ne. Potom dva roky nato jsem byla v jiném
stavu, protože jsem si přála mít tři děti. A přála jsem si, abych měla dvojčata, aby to
bylo jedním vrzem. A byla jsem v jiném stavu, a to jsem si zavinila svou hloupostí,
nesla jsem na mandl košík prádla, ve třetím měsíci jsem byla a začala jsem krvácet,
nějak jsem si ublížila, takže jsem musela mít potrat a dva roky potom... řekl po dvou
letech, že můžu přijít do jiného stavu, takže mám ještě dceru Věru, ta je rozená v roce
50, tedy 4 roky po mém synovi.... Tak to byl můj prožitek za šest let válečných. Když
jsme se vrátili, dostali jsme 500 korun a na takovou repatriační kartičku, tu jsem
bohužel vyhodila, jako doklad už to nemám a to bylo všechno, to znamenalo jako
podporu. Já jsem neměla být z čeho živá a měla jsem po rodičích chatu na Lužnici u
Tábora v Sezimově Ústí a tu jsem prodala. Dostala jsem za ní 20 tisíc. Moje přítelkyně
neměla vůbec nic, takže jsme tu chatu spolu projedly až do komína, což šlo rychle.
Mezitím byla měnová reforma , takže bylo dobře, že jsme jí projedly a mezitím jsem
tedy se vdala. Nedostali jsme až do loňského roku vůbec nic od nikoho. Helena: A teď
jste dostala z toho Fondu budoucnosti? Marta: To z toho Fondu budoucnosti jsem
dostala, ano, 37 400. Je to urážlivý všechno, šíleně urážlivý a nestoudný, ale co dělat.
Žili jsme do teďka, měli si to nechat a strčit někam, protože je to ostuda všech ostud
Helena: Byla jste někdy v Německu? Marta: Ano, byla jsem v Německu několikrát.
Byla jsem v Německu několikrát, když bylo mojí dceři asi 14 let tak poprvné, to ještě
byla na mém pasu napsaná, tzn., že asi v 64. roce poprvně. A sice já mám tři sestřenice,
pravé, míšenky, žijící v Bavorsku, asi 17 km předHofem, jmenuje se to Helmbrechz. A
ty tam žijou, takže jsem u nich byla, několikrát samozřejmě... Helena: A jaký to bylo
přijet do Německa? Marta: No pro mne pro nás to bylo pochopitelně... jsme kulily
jenom oči... Helena: Nějako myslím... Marta: Ale musím říct, že jsem v každém Němci
viděla... si představovala, že jsem ho někde potkala a že vím, že když pro mne a pro
dceru přijely do Schierdinku s autem moje sestřenice, oni auto neměly, to jsou tři staré
panny, ale jejich známej je přivezl a takovej chlap velikej a mojí dceři bylo po cestě
špatně, to byl takovej velkej..., jmenoval se, myslím, Kapitán, ten auťák, a chtěla
zvracet, tak když zastavil a ona se vyblinkala, tak řekl: No vidíš, teď jsi vyblinkala ten
komunismus, tak Ti bude dobře. A já, jak jsem seděla vzadu a viděla ho v tom zrcátku,
takovej fešák velikej, mluvil tak jako velice rázně, tak jsem najednou si namluvila, že
jsem vlastně toho chlapa někde potkala v lágru, a nebyla to pravda samozřejmě,
namluvila jsem si to, a získala jsem z něj takovou hrůzu a potom se z něj... jako byl
velice... co dělal nevím... oni všichni nedělali nic, všichni byli vojáci, já jsem s
Němcema přicházela do styku v pozdějších letech velice mnoho, protože když jsem šla
do důchodu, tak od té doby jsem 26 let dělala průvodce, vodila jsem jenom zapadni
Němce Helena: Po Praze? Marta: Po Praze a.... od cestovní kanceláře, takže jsem přišla
s mnoha a mnoha do styku. Zažila jsem mnoho různých episod, mohla bych napsat o
tom velikou knížku. Jinak chci říct, škoda, že Ti to nemůžu ukázat, má to vnučka u sebe
teďko, jsem napsala vzpomínky z mého dětství, pokud jsem si vzpomněla a nebo z
vyprávění mojí maminky a celej můj život až do teďka. A vzhledem k tomu, že jsem
měla tady tu arisch lásku, tak mi zůstala moje výbava u něj, kterou mi pochopitelně
vrátil, a i fotografie, který jsou pro mne strašně... byly důležitý a který mi moji všichni
známí závidí a mají proč, protože málokdo má fotografie ze svého dětství a mládí a ze
svých rodin. Já jsem taky jako druhý sešit napsala, to mě inspiroval, nevím, jestli jsi
četla knížku od Viktora Fischla, četlas od něj něco? Helena: Nevím, nevím přesně, jak
140
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
se ta knížka jmenuje? Marta: Tahleta se jmenuje "Moji milí strýčkové", je to rozkošný...
a všechny jeho knížky jsou překrásný, a to je doktor filosofie, který pochází z Hradce
Králové, dělal Janu Masarykovi..., něco u něj, sekretáře nebo co v Londýně, žije v
Israeli, vydává tam knížky, píše česky a mluví tak báječně česky, sám prohlašuje, že
psát může romány pouze česky, tudíž jako z češtiny do všech jazyků jsou překládané,
ale v Israeli. A ten napsal takovou krásnou knížku, jednu z posledních, právě tu "Moji
milí strýčkové", což mě inspirovalo, napsala jsem, ne tak krásně samozřejmě, taky
vzpomínky na svoje strýčky a tety, kteří si všichni zasluhují mou vzpomínku a tím, že
jsem měla ty fotografie, tak jsem to proložila fotografiema až na jednu rodinu, kde
nemám nic, takže víc už udělat nemůžu, aby děti věděly z čeho pocházejí. Helena: To je
pěkný... Marta: A moje děti jsou vychovávaný asi tak jako já jsem byla, vyplatila se mi
moje výchova, protože myslím, že můžu prohlásit, že mají dobrou Kinderstube a pocit
sounáležitosti k rodině. A to jsem v nich vypěstovala já, protože jsem, ono to nepřijde
samo od sebe, musí pro to člověk něco udělat a něco obětovat. Já si pamatuju, když bylo
mé nejmladší vnučce asi osm nebo devět let nebo deset let, tak řekla své mámě: Mami,
až budu u babičky, tak se jí musím zeptat, jak to dělá, že jsme vždycky takhle rodina
pohromadě a že je to vždycky tak hezký. A mně tohleto dalo víc než co jiného, protože
jsem pochopila, že jsem udělala asi dost, když to ta malá holka si uvědomuje, že na to
přišla, že je to hezký... jo a řekla: Vždyť já budu taky asi jednou babičkou, tak abych
věděla, jak se to dělá,.., tenkrát, což mi jako udělalo velikou radost. Helena: A kdy se
Vaše děti začaly zajímat o Vaše zážitky. Marta: Ty já jsem dětem, když byly malé,
celkem neříkala, protože je nesmysl zatěžovat dítě vším možným, tu skutečnost jsem
jim chtěla ušetřit, tenkrát byla taky jiná tendence, já jsem se taky jinak jmenovala, když
jsem se provdala, my jsme se... můj manžel se jmenoval Neuner, ale jelikož byla tenkrát
tendence, kdo má německý jméno...a po válce jako jsme měli Němců plný zuby všichni,
a chtěli jsme se co nejvíc od Němců oddálit a co nejméně s nima mít, což může
pochopit jen ten, kdo tohle prožil. To nebyla nenávist, jako že jsou to Němci nebo že...,
to ne, ale potom, po tom všem, co jsme... Tak přišel jednou manžel domů s tím z práce,
když byl... ještě nebyla Věra na světě, že jeho kolega, který se jmenuje Picka, Picka
česky, a nebyl Žid, ale všichni mu říkali: Pane Piek Jeho to hrozně rozčilovalo, takže
měl příležitost teď si změnit jméno, aby už neměl tedy to Picka a neříkali mu Piek.
Takže si změnil jméno a nahecoval mého manžela, že když tu chceme zůstat a máme
dítě, tak na co má mít německý jméno atd. atd A já jsem řekla: Já si nebudu měnit
jméno, já nikde nebudu za ničím lítat a vyplňovat, nechci. No ale druhej den přinesl
manžel už od Edy formulář, že mi vzkazuje, že nemusím nikam lítat, že stačí, když to
vyplníme a podepíšeme, a že on až tam půjde se svým, že vezme tohle naše sebou.
Takže mi nic jiného nezbylo, abych měla pokoj, tak jenom si vymyslet jméno. No a
jelikož mělo zůstat ten... první Buchstabe N, že jo, takže jsme..., jsem si vymyslela jako
symbolicky, že jsme se navrátili do života, jméno Navrátil. No takže, když se mě lidi
ptají: Nejste příbuzná... tak říkám, že nejsem. Je to skutečně vymyšlené jméno a moje
vnučka nejmladší se předměsícem nechala přejmenovat, mešugge, naNeunerová.
Helena: Kolik jí je? Marta: 23. Helena: Jako mně. Takže ona se zase o to zajímá víc... o
to židovství? Marta: Jo, vstoupila i do obce, přestože je míšenka , tedy po mámě, ale
vstoupila do obce. Helena: A je věřící? Marta: Není věřící, žila půl roku v Israeli, dělala
tam ulpan , mluví hebrejsky a anglicky, pohybuje se teď víceméně víc mezi Židama a
říká, když si někdy někoho vezme, tak že si vezme jenom Žida Helena: To je zajímavý.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
141
Marta: Ale to sejí asi tak jednoduše nepovede, chtěla tam zůstat, ona vlastně odjela do
Israele na aliyah, víš co je aliyah, na vystěhování a byla tam půl roku, chtěla dělat ještě
další ulpan a chtěla tam studovat, ovšem to by byla v kibucu na první ulpan, ten druhý
chtěla dělat v Haifě, ale ten se jí nějak, ten rok nejel, nemohla dostat byt, to není tak
jednoduchý, že. No prostě přijela domů jako na dovolenou na měsíc, ale doma zůstala a
my jsme velice šťastní, že je doma. Momentálně dělá na švýcarském konsulátě a začala
studovat ve třiadvaceti letech na universitě. Protože třikrát... tři roky dělala zkoušku,
dvě udělala... nevzali jí a tu jednu neudělala. A tak se zbláznila a říkala, že ještě se o to
pokusí a oni ji vzali letos. Helena: Na co? Marta: Na filosofii, na obor..., se mé neptej...,
chtěla dělat, vlasně už vím, angličtinu a hebrejštinu, ale oni nedělají... letos neběží, v
tomto školním roce, hebrejština, že mají málo přihlášek, přej snad až příští rok, takže
angličtinu snad studuje, nevím. Já tím zásadně nejsem moc nadšená, protože si říkám,
že už je trochu stará na to, aby... Moje dcera je šťastná, že začala, protože na to přej má,
což věřím, že má, ovšem bude to makanda, protože musí při tom aspoň na půl úvazku
dělat, aby se... /konec kazety/
142
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Dokument 2: L.R.
Helena: Chtěla bych Vás poprosit, abyste mi vyprávěla svůj život... L.: Tak narodila
jsem se v Praze, žila jsem celý čas v Praze... Helena: V kterém roce? L.: Ve dvacátém...
Tak nejdřív jsem začla chodit na venkově do školy, protože jsem byla velmi slabé dítě.
Doktor nedoporučoval, abych chodila do školy, tak máma mě radši poslala na venkov.
No na venkově to bylo... to byl takový městys, tam byla jen pětitřídka samozřejmě a
tam jsem nemohla chodit na náboženství, protože tam jsem byla sama ve škole, tak jsem
chodila na katolické. No a já byla výborná žákyně, já jsem všechno uměla hned, chodila
jsem i do kostela, tam zpívat s dětma, a když jsem potom dostala... spálu jsem
přechodila a dostala jsem těžký zánět ledvin a kloubů, tak máma měla přece jen strach,
tak mě vzali do Prahy domů. Helena: A u koho jste tam bydlela? L.: U tátovy sestry.
Táta tam měl sestru a bratrance a u těch jsem žila. Teta neměla děti samozřejmě a měla
hospodářství a já tam byla šťastná, já tu tetu milovala, i strýčka, tak jsem byla šťastná.
No a ve třetí třídě jsem začla chodit v Praze do školy a tady jsem začla teprve chodit na
židovské náboženství. No a chodila jsem do Sokola, protože jsem cvičení milovala...
Helena: Doma jste mluvili česky, to byla česká rodina? L.: Ano, my jsme měli obchod,
já chodila, jako úplně malé dítě, než jsem jela na venkov, tak jsem chodila do mateřské
školky, německé, tam jsem mluvila samozřejmě německy, jako malé dítě jsem uměla
německy. Jenže to bylo těsně po válce, tak v roce 24 a já jsem zpívala doma, když jsem
přišla ze školky, německé písničky jako Haenschen klein a tak a to jako tátovi by
nedělalo v obchodě dobře, abych já mu tam zpívala německé písničky po válce. No tak..
a taky ve školce řekli, že do školky můžu chodit s tou podmínkou, že budu chodit do
německé školy. To táta samozřejmě odmítl a proto jsem tam přestala chodit a německy
jsem zapomněla. A potom jsem chodila hodně bruslit, protože jsme měli naproti Vltavu,
jsme žili vedle Vltavy, tak jsem hodně bruslila, prostě provozovala jsem všechny
sporty, za Sokol jsem plavala závodně. Do roku 38, to jsem cvičila dokonce v té době
na třech sokolských sletech: jako malá žákyně, jako větší žákyně a jako dorostenka.
Poslední slet byl v roce 38, to bylo naposledy, kdy jsem cvičila. No pak přišel rok 39 a
to už přišli Němci a byly veškeré zákazy. Helena: A můžu se zeptat ještě, v té rodině,
Vy jste říkala, že jste pak chodila na to židovské náboženství. A jak se to u Vás doma
projevovalo?Chodili jste do synagogy, slavili jste ty svátky? L.: Můj táta na Nový rok, a
Dlouhý den, to byly snad jediné svátky, které jsme slavili, to se neprodávalo, to se
zavřel krám a to táta chodil do kostela. My jako děti jsme třeba chodily taky, ale moc se
u nás nábožensky nežilo, protože jsme slavili i vánoce i sédr, všechno. No v roce 39,
když přišli Němci, tak byly veškeré zákazy, to víte, co se všechno nesmělo, to Vám ani
nemusím povídat: Helena: Jako můžete, ale já to znám: L.: To znáte. Já jsem tenkrát
chodila s jedním klukem, který chtěl, že pojedeme do Kanady. Ale kdybychom byli
chtěli do Kanady jet, tak já musela být pokřtěná. Jinak bych byla nesměla ujet. Už jsme
byli na nějaké prohlídce, nevím, co všechno jsme už absolvovali...Helena: A on byl
křesťan? L.: Ano..., a taky jsme hledali, kdo by mě pokřtil. Bylo to těsně před vstupem
Němců k nám. Tak jsme byli v různých kostelích se ptát a řekli nám třeba, že už mají
zákaz někoho takového křtít. Potom jsme byli dokonce v tom kostele, jak tam zastřelili
ty parašutisty, u toho faráře. Ten řekl, že bezevšeho by mě pokřtil, ale bohužel taky má
zákaz a tak se hledaly různé cestičky, až se našla cestička na faru, jmenovalo se to tam
Nižebory u Budyně, a tam byl nějaký farář Culík, který byl ochotný mě pokřtít. Jenže
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
143
řekl, že napřed musím umět všechno, katolické náboženství, že se to musím naučit.
Aposlal mě na..., bylo to na Hradčanech, diecéze nebo kam, tam jsem musela jít a to byl
zase přítel toho faráře Culíka, ten na mně chtěl, abych se naučila katechismus a dal mi
knížku a až se to naučím, tak abych přišla. No a já jsem se do toho podívala, už tam, a
povídám, no ale já tohle všecko umím. On říká: Jakto? a já povídám: Já chodila dva
roky na katolické náboženství, když jsem byla malá. On řekl: Tak já Vás vyzkouším
rovnou. Tak mě vyzkoušel a řekl: No Vy to umíte báječně, to by bylo úplně zbytečné,
abyste se to učila, takže Vás může rovnou pokřtít. Tak jsem jela do té Budyně a byla
jsem křtěná, přesně nevím, kdy to bylo, ale bylo to těsně po vstupu, to mohlo být kolem
19. března nebo tak nějak Jenže já jsem se pak s tím mládencem rozešla, takže mi to
bylo vlastně na houby. A pak holt jsme dostali předvolání do Terezína, můj otec musel
zlikvidovat samozřejmě obchod, taky jsme se museli vystěhovat a bydleli jsme v jedné
místnosti všichni, kdo žili. Helena: Měla jste sourozence? L.: Ano, měla jsem bratra.
Můj bratr, ten jel jako AK do Terezína a já jsem se s ním sešla tam, my jsme měli, můj
otec hlavně měl strach, protože věděl, že se v Terezíně popravovalo, dvakrát tam věšeli
kluky... Helena: Já vím, to už mi někdo vyprávěl. L.: Pro hloupost, že řreba napsali
mámě domů, tajně, že žijí, nic to nebylo, A tam byl taky nějaký Weiner mezi tím a táta
měl strach o Pepíka našeho, tak pátral, ale naštěstí tam Pepík nebyl. A my jsme..., já
jsem dřív byla zaměstnaná jako úřednice, ale za Němců jsem nesměla být zaměstnaná
jako úřednice, tak jsem..., nejdříve jsme se sestřenicí šly do jedné kartonáže, tam jsme
dělaly krabice, nic to nebylo, byla to taková..., no lepily se krabice. A ten pán, ten
majitel, nejdříve s námi byl velice spokojený, že jsme šikovné a kdesi cosi a potom jsme
chodily s těma děvčatama, které tam byly, to byly takový patnáctiletý děvčata a
dozvěděly jsme se, že ten majitel je nepojištuje. Ani nemocensky ani jinak. Tak jsme
jim řekly, děvčata, musíte chtít, aby vás pojistil, protozž za prvé vám to jde dole..., kde
jako dostanete výbavné, jak se dávalo tenkrát no a oni mu to řekly, on se rozčílil a řek,
kdo vám to řekl? A děvčata řekly, ta jedna řekla, že to řekla Inga, ta moje sestřenice, že
nás musi pojistit no a on řekl, teď nám začal tykat, předtím byl lé nám slušnej, že nás
chytí, já nevím, za co a vyhodí, no a okamžitě nás vyhodil. Tak jsme šly... Helena: To
byl Cech? L.: Jo..., a našly jsme si místo v Knize, kde vázali knihy u Hunky v
Podskalské ulici. Ten pan Hunka, to byl velice sympatický, solidní člověk, ten nám
říkal, děvčata, tady u mne nemusíte nosit hvězdu, vždyť nám je to úplně fuk, jestli máte
hvězdu nebo ne. A my jsme říkaly,no jo, ale kdyby sem někdo přišel, tak spíš bysme to
odskákaly my než Vy. A tam jsme byly až do odjezdu do Terezína u toho Hunky, ten
byl výbornej. My jsme přijely,.., já jsem jela dřív, sesřrenice jela až za půl roku za
mnou. Když jsme přijeli do Terezína... nejdříve jsme šli samozřejmé do Veletržního
paláce, tam byla tzv. šlojska, to byl obrovský sál a leželo se tam na matracích jenom, na
mně to strašné působilo, to bylo strašný, to bylo něco neuvěřitelnýho tam, za prvé
spousta lidí, zavazadla, všechno možný, teďka jsme se neměli kde umýt vůbec, až
potom nám dali trošku vody do nějakého umyvadla, co tam bylo, v takové komůrce
jsme se namačkaní, napresovaní myli, třeba deset najednou a ani jsme se pomalu
nemohli otočit. Teďka dostávali jsme samozřejmé ráno to černý kafe, no zkrátka něco
málo, protože za prvé jsme ještě měli sebou něco k jídlu, takže nám to tak zlé
nepřipadalo. K nám chodila do krámu nějaká paní Weinerová, stejně se jmenovala jako
my a byla tedy ve stejném transportu jaký my. Tatínek si chodil sám pražit kafe, aby
bylo dořre vypražený a nabízel, že je to dobrý kafe a dost jsme jako měli úspěch s ním a
144
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
nabízel ho taky téhle pani Weinerové a ona říkala, kdepak, já jenom k Meinlovi, jiné
kafe nepijem než od Meinla. A teďka jsme tam stáli v té frontě na to kafe s ešusem, ta
Weinerová taky a můj táta si neodpustil a říkal: Paní Weinerová, k Meinlovi? Tak jsme
jeli..., to jsme jeli ještě osobákem do Terezína...Helena: Kdy to bylo, ten transport? L.:
To bylo v dubnu 42. No to jsme přijeli osobákem a teďka tam už čekali ti kluci, kteří
byli v tom Hundertschaftu, co byli u zavazadel a co brali zavazadla. Když jsme tam
přijeli, já měla na hlavě šatek a my jsme si byli s bratrem dost podobní, že mě ti kluci
poznali, co bydleli s bratrem a už na mě křičeli a věděli, že existuju prostě říkali, co mi
můžou pomoct, já jsem nepotřebovala nějakou pomoc, ty kufry nám vzali stejně a kufry
jsme nedostali, my jsme přijeli úplně bez kufrů, jenom to, co jsme měli v ruce. A dostali
jsme lůžkoviny. To bylo všechno, co jsme měli. Já neměla ani noční košili, prostě vůbec
nic, to všechno jsem si pak teprve v Terezíně sháněla. Já nevím proč, to jsme byli
nějaký trestný transport, proč to nevím, asi dva byly takové transporty, že přijeli bez
zavazadel. Taky samozřejmé jsme měli v těch kufrech nějaké jídlo z domu, dělali jsme
si sebou jíšku, dělali jsme si suchary, prostě to, co vydrží. Nedostali jsme vůbec nic, nic
jsme neměli. Akorát táta dostal takový kufr, to nebyl ani kufr, takový proutěný koš s
nářadím. To dostal, ale jinak jsme nedostali vůbec nic. No a hned nás rozdělili,
přirozeně táta zůstal v jiných kasárnách, my jsme přišly do Hamburských, to ještě
tenkrát ghetto nebylo otevřené, to tam ještě bydleli civilní obyvatelé, takže my jsme se
nedostali mimo kasárna ven. Já jsem ale okamžitě, co jsme tam přijeli, tak jsem začla
pracovat, protože jsem si myslela, když budu chodit dělat, aspoň to uvidím, jak to
kolem vypadá, aspoň se někam dostanu. A začala jsem pracovat v zemědělství, hned.
Nejdříve jsme bydlely dole v přízemí, pak nás přestěhovali do 1. patra a tam, když jsme
přišly do toho 1. patra, tak máma tam dělala Zimmeraelteste, tzn., že se starala o tu
jednu místnost, co nás tam bydlelo, já nevím kolik, jestli padesát, šedesát, v jedné té
místnosti, hrozný... Byly to třípatrové kavalce. Teď tam byl kousíček, blízko
Waschraum a toalety a tam jsme se chodily mýt. To byly, já nevím, jestli jste tam byla...
Helena: Jo, byla. L.: Tam byly takový koryta a kohoutky, samozřejmě se studenou
vodou. A to jsme si vždycky vlezly na to koryto, abychom se mohly lépe umýt, svlékly
jsme se a myly se, a jednou, jak tam stojím, tak vedle mne nějaká pani se taky myje a
povídá mi: Nejste Vy L. W.? Já povídám: Jsem... a ona povídá: Vy mě nepoznáváte? Já
se na ni podívám, nahá paní, tak říkám: No nevím...Vždyť jsem vedle Vás bydlela
několik roků. Ona to byla bývalá žena ministra Čecha, on to sice byl Němec, ale
jmenoval se Čech, ministra sociálních věcí. Já jsem potom, když jsem dělala v tom
zemědělství, ona říkala, že její muž je nemocný, to už byli starší lidi, tak jsem jí občas
přinesla třeba lebedu, co jsem natrhala venku, no. něco zelenýho prostě, aby měla pro
toho muže. Z lebedy jsme tam tenkrát dělali špenát a z kopřiv taky, to je docela dobrý.
No nejdříve jsem chodívala s partou, jsme chodili různě dělat, až potom, když se začlo
opravdu v tom zemědělství, tak jsem začala chodit na Krétu, kde se pěstovaly rajčata,
mrkev, okopávaly se kedlubny, všechno možný, že přece jen člověk, když byl v tom
Landwirtschaftu..., tamhle jsem si mohla vytáhnout mrkev třeba, nebo petržel a sníst to
venku, otřít o kalhoty, žádné praní nebylo přirozeně, no a nebo i to rajské jsme mohli...,
ale ti, co byli vevnitř neměli nic, vůbec nic samozřejmě. Jinak to, co jsme dostali, to za
moc nestálo, to bylo černý kafe, potom v poledne nějaká polévka, buď brambory, černý,
ošklivý, nebo turín, nevím, co všechno. No a pak se rozdělil chleba asi na pět dílů jeden,
taková šiška, prostě nestačilo to. Ale nám, že jsme dělali v tom Landwirtschaftu, tak
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
145
přece jen jsme mohli vždycky něco ukořistit a sníst, že jsme měli trošku těch vitaminů v
sobě. Ne sice moc, ale trošku. A bratr, ten dělal v tom Hundertschaftu, jak nosili ty
kufry a tak a pak přešel pracovat k Heinlovi. Heinl byl esesák, velice zlej, z toho měl
každý hrozný strach. A on si, nevím proč...Pepík byl šikovný a on si ho celkem dost
oblíbil, ale to nemohl Pepík na to spoléhat, protože jednou byl milý a po druhé by ho
mohl třeba zavřít, že jo. Tak protože tam se ty kufry nakradený.. .všechny kufry, co nám
vzali, ty se tam rozbalovaly a třídilo se to tam. Třídilo se to tam na potraviny, na ty věci
různé..., že třeba tam byly štětky na holení. No a Pepík jednou náhodou tu štětku
rozšrouboval a v té štětce na holení našel složené papírové marky. No jenže, co s tím, že
jo, v Terezíně. A tak když to Heinl viděl, že Pepík je šikovný, že to všechno najde, tak
proto ho dost tak protěžoval, ale Pepík se nesnažil to hledat pro něj, to by musel být
blázen. No a v Terezíně jsem chodila zpívat k Rafaelovi Schaechtrovi, to jsme zpívali
napřed Kouzelnou flétnu, potom Prodanku, Hubičku, Rekviem... Helena: Vy jste
zpívala ve sboru? L.: Ve sboru, od začátku u Rafika... Helena: Do kdy jste byla v
Terezíně? L.: V Terezíně jsem byla do června, do května roku 44. Jo a nakonec jsem v
Terezíně chodila česat ovoce. Nás chodilo... 4 děvčata z celého ghetta, máma začala
taky, tak jsem tam ze začátku taky chodila. A pár mužských s námi chodilo, a chodili s
námi Němci. Protože jsme chodili... za prvé to bylo ovoce, které potřebovali pro
německé vojáky, tam byl lazaret na Krétě, německý a veškeré to ovoce právě chodilo k
těm vojákům do toho lazaretu. A chodili s námi tři Němci, to se střídalo, jaký klíč k
tomu byl, nevím, Hahn, Ulrich a Altmann. Ten Ulrich byl tak nevyzpytatelný, toho
nikdo neměl rád, protože se nikdy nevědělo, co on udělá. Altmann, ten taky nebyl
zrovna nejlepší, ale nám, co jsme s ním chodily, můžu říct, že neškodili a ten Hahn ke
konci potom, když už jsme si na něj zvykly a on na nás, nám dokonce nosil svačinu. A
vždycky řekl: Děvčata, dneska se rozdělíte vy dvě a příště zase dvě. Ten byl... potom
celkem byl k nám docela normální, ovšem běda, kdyby někdo jiný sáhnul po ovoci a
aby to on viděl. Tak okamžitě ho chytil a odvedl na komandaturu, což se stalo. Taky
jsme chodívaly do okolních vesnic trhat listy bource morušového, protože se tam
pěstoval bourec morušový, to se trhalo listy do pytlů a nosilo těm housenkám a v zimě
se potom pletly matný, když nebylo ovoce a my jsme chodívaly, ti kluci, co s námi
pracovali, prořezávali stromy a my jsme chodily ty prořezané stromy klestit a z toho se
dělaly otýpky a to se vozilo do družstva, kde si to pracovníci rozebírali a mohli se aspoň
trošku s tím doma zavlažit. To jsme chodívali... všechno jsme chodívali samozřejmě za
Terezín, měli jsme všichni propustky, někdy jsme chodili, jak jsem Vám říkala, s tím
Němcem, ale tyhle práce, jak jsme dělali to dřevo, to už s námi chodili jenom naši. Naši
vedoucí a tak. No a v roce 44, v květnu jsme dostali transport, napřed rodiče, potom...
můj táta pracoval jako Hausaeltester, měl na starosti jeden domek, v jedné ulici a
nakonec jsme se tam přestěhovaly s mámou a bydleli jsme v jedné místnosti, jako my
tři, bratr si udělal dole ze sklepa takový pokojík, ještě s kamarádera. Takže máma, když
měla po práci, se vždycky snažila něco udělat, aby jsme se něčím zasytili. Dokonce tam
byli jakýsi Buschovi, to byli rodiče té naší herečky, té Heleny Buschové, to byli krásný
lidi, oba, a ten pan Busch hlídal esesákům psy. A paní Buschová tu a tam dala mámě
hrst rýže, kterou měla pro ty psy, takže máma to třeba doma dělala. Když jsme v 44.
odjížděli, tak můj bratr, když nastupoval do vlaku, tak tam přišel Heinl. Jenže Heinl ten
čas, co byly ty transporty, tam nebyl. Ten byl já nevím kde. A když nastupoval bratr do
vlaku a on ho tam viděl, tak mu řekl: Kam to jedete? a Pepík řekl: Musím s transportem
146
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
a on: To jste nemohl něco říct? Pepík řekl, že za prvé on tam nebyl a za druhé, že v
prvním transportu odjížděli rodiče a že on jede za rodiči. A on mu něco řekl, že by jako
neměl nebo tak... A bratr řekl, že sestra jede a on že jede taky. Atak jsme jeli do
Osvětimi, jeli jsme asi tři nebo dvě noci. Helena: Ale nevěděli jste kam? L.: Ne, neměli
jsme tušeni, samozřejmě. A teď... to bylo... to jsme jeli v jednom dobytčáku,
samozřejně, byli jsme... bylo nás snad padesát v tom jednom vagóně, byly tam dva
kýble, jeden na potřebu, druhý s vodou, byli tam rodiny s dětmi, děvčata, kluci, všechno
dohromady, bylo to strašný, to nikdo si nedovede představit, co to bylo za hrůzu, když
jste musela jít a teď... Tak potom ten jeden pán ještě s jedním se snažili z dek udělat
jako paravan, abychom mohli... jsme tam měli na tu chvilku kousek toho soukromí. No
ale bylo to opravdu něco strašnýho. No a já jsem... když jsem nastupovala do toho
vagónu, tak tam přišla jedna moje známá, která mi říkala: Hele, jedou s Tebou sirotci,
tak kdybys Ty a ještě tam byla. ještě dvě kamarádky jsme jely náhodou společně, tak
kdybyste si vzaly každá na starost nějakého toho sirotka. Takže jsme tam měly několik
dětí a teď jsme měly samozřejmě zavazadla, co jsme měly, a já jsem měla na sobě,
nevím, jestli dvoje nebo troje šaty, protože se vědělo, co člověk má na sobě, o to
nepřijde, to už jsme byli poučeni z toho, že jsme přišli bez zavazadel a bez všeho. Já
jsem jela s jednou, ta se jmenovala... já si teď nevzpomenu, jak se jmenovala, s jedním
děvčetem, která byla z Pardubic a její rodiče byli smíšené manželství a teď najednou
ona vidí v Pardubicích na nádraží toho svého tátu. A teď začala na něho samozřejmě
křičet: táti, táti, no ten ji neslyšel, to je jasný, no ale to bylo hrozný taky. No a asi tři
noce, myslím, já nevím přesně, člověku už to splývá, jsme jeli, až jsme přijeli na místo.
A teď jsme slyšeli jenom řvaní samozřejmě, a teď mužský, který měli na sobě
pruhovaný šaty a v ruce měli biče a řvali: Los, los a vystoupit všichni a všechno tam
nechat, to všechno dostanete, až vystoupíte, tak se vám to odveze,... no jenom řvaní.
Tak jsme byli samozřejmě všichni úplně zděšení, vylezli jsme a tam bylo brečení a
křiku... oni řekli: Seřaďte se do pětistupů, tak jsme se začali řadit do pětistupů, a že se
jde. A ten, co nás vedl říkal: Když umíte dobře psát, tak se Vám tady povede dobře. A
viděli jsme dráty, to jsme viděli jen osvětlené dráty, nic jiného... a nějaké boudy, to si
člověk pomalu nedovedl představit, co to je, kam jdeme, až jsme viděli bránu a tam
bylo napsáno Arbeit macht frei, no a šli jsme a najednou přijdeme do takového...do
takového prostranství, z obou stran baráky, prostředkem cesta, no a nikde nikdo, ani
noha, tam všude ticho, no a teď najednou já vidím tu mojí sestřenici, co jsem s ní
chodila pracovat tenkrát, ta odjela transportem přede mnou, ta jela v prosinci a my jsme
jeli v květnu, jak na mě křičela: Jestli něco máš, tak mi to hoď! Já jsem nevěděla, co jí
mám hodit, já jsem povídala: Co chceš, abych Ti hodila?... Všechno, co máš, mi hoď!
No tak já jsem měla v ruce třeba baterku, tu blikavou, tak jsem jí hodila baterku, měla
jsem krabičku, co jsme si schovávali, co jsme dostali na horší časy, olejovek, tak jsem jí
hodila tu krabičku olejovek, no já neměla nic, co bych jí ještě jiného mohla dát. A teď
jsem měla... jo a měla jsem nějaké marky taky. Ty marky jsem našla, když jsem na poli
dělala, okopávala mrkev. No a teď jsem říkala, no tak tadyhle je barák a tadyhle tráva,
já ty marky... tam jsme zůstali stát, já je zahrabu tadyhle do ty trávy a ráno si to vezmu.
No v životě jsem to nenašla, protože byl jeden barák jak druhej, všude byl barák, tráva,
tak jsem to nenašla. No a nahnali nás do nějakého baráku, řekli... to je jedno, kam si
vlezem, že si mužem kamkoli, tak jsem si vlezla někam nahoru. Co jsem měla v ruce,
byla nějaká taška, nebo ani to ne, já si už nepamatuju, neměla jsem... jenom to, co jsem
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
147
měla na sobě. No a tam jsme si lehly a ráno nás brzy, samozřejmě hodně brzy, vzbudili
a řekli nám, že máme jít ven, všichni, a že tam všechno máme nechat. A já jsem si
říkala, no tak já to tu nechám a zas nebudu mít nic, protože zas nám to všechno vezmou.
No tak jsem si to chtěla vzít a už skoro jsem tam byla poslední. A teď vidím, že ta, co
na nás řvala, ta bloková, že mluví s nějakým děvčetem a to byla Dina Gottliebová, s
kterou jsem chodila pracovat, když jsem dělala v Landwirtschaftu. A s Dinou jsme se
dobře znaly, tak já hned k ní šla a říkám: Heleď, Dino, poraď mi, tady ta na nás řve, že
tam máme všechno nechat, co mi radíš? A ona říkala: Vem si všechno sebou! A ta si mě
nevšimla.. .a pak jsem se dozvěděla, že Dina byla milenkou toho Lageraeltestra tam,
toho Němce, takže prostě měla tam taková privilegia a co řekla, to holt platilo. No a
potom nás nahnali, že musíme sejít nechat tetovat. A tam nás tetovali a já jsem pořád
říkala, když jsem jela do Terezína, součet čísel mi dělal třináct, tak jsem měla celkem...
jakžtakž se to dalo přežít, prostě vždycky součet mých transportních čísel dělal třináct.
Tak jsem říkala, já musím to nějak udělat, aby to moje tetovací číslo bylo taky součet
třináct. Tak jsme stáli v té frontě a byla tam moje kamarádka, potom moje nastávající
švagrová, to jsem nevěděla, že jednou bude mou švagrovou, no a teď byla čísla 4, 6, 0,
1... tak já jsem čekala až bude 03, aby ten součet dělal 13, tak jsem měla tetovací číslo
4603. No a teď najednou jsem zaslechla něco o plynu. No já si to nedovedla srovnat v
hlavě, co je to, že lidi dávají do plynu. Protože to říkali... ten transport prosincový, co
tam byl, říkali: No, Vy jste přišli a teď my půjdem do plynu. Já jsem říkala: Do jakého
plynu? A oni říkali: No, ten zářijový už šel v březnu, po půl roce, teďka prosincový...
Vy jste přišli... to půjdeme zase my, v tom červnu, když vyprší toho půl roku. Já jsem
řekla: To je přece nesmysl. Tak jsem šla za tátou a říkala jsem to tátovi. A říkám: Táti,
oni říkají, že půjdeme do plynu. Táta říkal: Prosím Tebe, přece bys nevěřila nějakým
povídačkám, to je blbost, to je nesmysl, nevěr tomu. No a tak jsem se trochu uklidnila,
ale potom jsem potkala Dinu zase. A říkám: Poslouchej, Dino, jak je to tady s tím
plynem? Co se tu vypráví, pověz mi to. A Dina mi všechno řekla. Úplně všechno,
protože ona to věděla, ona dokonce i malovala snad někde tam, protože byla malířka a
tak mi řekla, jak to s tím plynem vypadá. Tak mi řekla: Podívej, když se podíváš, v noci
je to vidět nejlíp, jak šlehají plameny, víc jak dva metry vysoké z komína, to je
krematorium a to je plyn. To se naženou všichni lidi do toho plynu, zaplynují. Já jsem
říkala: To snad není pravda, to snad nemůže existovat. A ona říkala: Je to tak. No já
jsem potom snad tři dni probrečela zoufalstvím, že vlastně bezmocná musím jít do
plynu. No a teď jsem tam měla samozřejmě bratra, rodiče, tetičku...a tím pádemjsem
zjistila, že moje nejmilejší sestřenice, které tam byly v zářijovém transportu už vlastně
nežijí. A teď jsem tam začala pracovat u dětí. Můj bratr jezdil s tzv. rollwagnem, tzn.,
že vozil z lágru, vím já, snad mrtvoly nebo co, na jednom valníku a nazpátek vozil
chleba a to jich jezdilo asi šest, to byli zapražení tihle kluci místo pohonu u toho
rollwagnu. A já jsem začala dělat u dětí, měla jsem na starost asi patnáct dětí ve věku
tak od tří do pěti let. Krásné děti, opravdu nádherné děti, roztomilé, chytré, no z nich
nikdo není už na živu. No a my jsme je tam učili zpívat písničky, básničky, nic jiného se
nedalo dělat. Dostávali jsme pro ně tzv. šmuncesy, tzn., že lidi, který posílali jim tam
balíky, tak ty se všechny otevřely a rozdělily a dávalo se to hlavně těm dětem. To
většinou byly třeba kostky cukru nebo nějaké tvrdé pečivo, které někdo poslal, nic
jiného to nebylo. A děti dostávaly bílou polévku, dostávaly tu a tam mléko, to jsme jim
my jako rozdělovali a bydlely se svými matkami v jednom baráku. Tam bydlely čistě
148
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
matky s těmi malými dětmi. Já tam měla jednoho chlapečka, Otík se jmenoval, ten když
viděl esesáka, tak začal křičet: Ten mi zabil mého tatínka! Já měla vždycky strach, aby
si nikdo toho nevšimnul, aby se něco nestalo, naštěstí se nestalo nic. Pak jsem tam měla
holčičku, ta zase si hrozně ráda hrála na blokovou. Ta, když jako bylo po školce, ta je
odvedla k rodičům, potom byl obyčejně ve čtyři hodiny apel a po apelu ta holčička měla
na sobě jenom botičky a chodila po lágru a měla malinkou hůlku a dělala blokovou. No,
chodili jsme si s dětmi před ten blok taky někdy hrát a já měla strach, protože ty děti,
některé už to znaly, že jim někdo z vedlejšího lágru třeba někdo házel salám nebo tak.
Jenže ty dráty tam byly nabitý elektřinou, takže já měla vždycky strach, aby to ty děti
nepodlezly, ty jedny dráty a nešly tam, aby se něco nestalo. No, tam to bylo dost krutý,
v Osvětimi. To jsme měli každý den samozřejmě apel, ráno i večer, to se stálo, dokud
nás nepřišel Buntrock spočítat, lítaly facky, kopance a ležely jsme v kójích, myslím,
šest vedle sebe, už si to přesně nepamatuju, ale byly to, já nevím, jestli tři patra nebo
dvě patra, to už nevím, a bylo to dost strašný. Já jsem tam spala s mojí kamarádkou, s
kterou jsem už kamarádila od začátku, my jsme spolu přijely stejným transportem do
Terezína a s tou jsem kamarádila od začátku Terezína. Byla to moc milá holka, a když
jsme spolu spaly, tak ona říkala: Mně tak strašně škrundá v břiše, to je z ty.. ./druhá
strana/ Helena: S těma dětma, jak jste se o ně starali... L.: V Osvětimi jsme dostávali
ráno tu černou žbrundu, potom jsme dostávali v poledne nějakou polévku a večer jsme
dostali zase jen tak kouší cek chleba a někdy jsme dostali takovou tuřínovou marmeládu
a to bylo snad všechno, co jsme tam kdy jedli. My jsme... tam byl strašnej hlad, tam
neměl člověk už nic, kde by přišel k nějakému jídlu. No a ty apely věčný, to bylo taky
dost úmorný, protože, jestli člověku bylo zle nebo nebylo, musel vydržet stát ten apel,
dvakrát denně. Po tom po apelu jsme mohli chodit volně po lágru samozřejmě a v osm
hodin, myslím, už se muselo být na posteli. Helena: A Vy jste tam nepracovala? L.: Jo,
pracovala, já jsem dělala u těch dětí. A já se nepamatuju, co máma moje dělala. Táta už
samozřejmě ne, táta byl 65 let, tak ten už nedělal. A potom najednou se rozkřiklo, že se
jde na práci. A to nikdo nevěřil, to nikdo nevěřil, protože to nebylo obvyklé. Nejdříve
vzali muže, všechny muže, mladé samozřejmě, já nevím, jestli do padesáti nebo do
pětačtyřiceti let, prostě muži nastoupili, samozřejmě byl tam Mengele, který dělal
selekci a potom jsme byli zvědavi, jestli ti muži opravdu pojedou na práci, tak jsme
všichni stáli narvaný tam dole u plotu, abysme viděli... odtamtud bylo vidět koleje,
dráha a tam jsme viděli kluky, jak na nás ukazovali, že jedou. No tak kluci odjeli, to byl
červen, myslím, a potom, že pojedou ženy taky. Řekli, že musí nastoupit všechny ženy
do pětačtyřiceti let. No tak jsme nastoupily do jednoho bloku, kde jsme musely nahé..
.tam v tom bloku byl vždycky komín, to byl takovej, asi takhle... tak metr širokej pruh,
to byl skutečně... tamtudy se nějak topilo a po tom komíně se šlo, vepředu stáli asi tři
esesáci, mezi nimi Mengele, a já nevím, jak se tamti jmenovali a ti buď ukázali napravo
nebo nalevo. Buď jako, že jsme schopné nebo, že nejsme schopné. Tak samozřejmě, že
každá z nás chtěla, aby byla vybraná coby schopná. Někdo, kdo byl od toho prosince v
tom Osvětimi, tak byl tak strašně hubenej, že holt ho nevzali. Potom, když bylo po té
selekci, tak nás mělo být asi dva tisíce, já nevím přesně kolik, něco scházelo do toho
počtu, tak řekli, že se ještě musí přihlásit všechny ženy do čtyřicetiosmi let. To
znamenalo, že moje máma, které bylo 48 tenkrát, taky musela jít na tu selekci a byla
uznaná jako práceschopná, což bylo pro mne i pro ni veliké štěstí, že jsme byly spolu.
No a tak...já jsem samozřejmě brečela, šla jsem za tátou a táta říkal: Heleď, já jsem
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
149
šťastnej, že jdeš s maminkou, že budete spolu, já už mám život za sebou, já už jsem si
svůj život prožil. A budu šťastnej, když vím, že jste spolu venku. A tak jsme... zůstaly
tam jenom ty matky s dětma, mohly se přihlásit, samozřejmě, že se mohly přihlásit,
všechny matky, které měly ty děti a mohly to dítě tam nechat někomu, ale která máma
by to udělala. Tak jsme přišly do toho... tam jsme se seřadily zase do pětistupů a šly
jsme do FKL, to byl Freies Konzentrationslager, tam jsme odešly z toho našeho
familienlágru. Když jsme tam přišly, tak nejdříve nás zase všechny nahnali do nějakých
sprch, potom nám všechno vzali, dali nové věci a oholili nás, kde jen to šlo a ještě jsme
šly zase na selekci, zase přes Mengeleho, potom jsme šly ještě na prohlídku, na
gynekologickou prohlídku a ta kamarádka, co spala se mnou, jak jsem o ní mluvila, ta
Lotka, jak říkala, že jí škrundá v břiše, tak ta doktorka, když ji viděla, tak říkala:
Poslouchej, nejseš Ty v jiným stavu? A ona říkala: To by mi tak ještě scházelo. No ale
nic se nedělo, šly jsme. Šly jsme, dali nám každé kousek chleba, dali nám kus salámu,
kousek nějakého margarínu a dali nám všem jiné šaty. To, co jsme si tam nechaly, co
jsme měly, to nám zase sebrali, zase jsme měly něco jinýho, já jsem třeba měla boty na
kramfleku na práci, bylo to děsný. Dostaly jsme nějaké hadry, teď jsme... jak jsme šly
do té sauny na tu prohlídku, tak já jsem ještě měla... nic jsme nesměly mít, já jsem ještě
měla moje hodinky Omega, já jsem si říkala, tady je fůra uhlí, tak já si to tudle strčím do
toho uhlí, až půjdu z té prohlídky, tak si je zase vezmu. No samozřejmé, že jsme šly
úplně jinudy ven, takže jsem ani nevěděla, kde uhlí je, tak zase jsem o hodinky přišla. A
pak jsme šly... šly jsme k těm kolejím a nahnali nás do vlaku a bylo nás v jednom
vagónu, no taky kolem padesáti, ale neměly jsme zavazadla, neměly jsme vůbec nic,
absolutně nic. A tam jsme nevěděly, kam jedem, co bude, no a moje maminka, ta
vždycky všechno schovávala, myslela si, kdybych já třeba měla hlad, aby mi mohla
ještě něco z toho svého, co má, dát, a nějak, protože bylo horko, to byl červen, tak asi
ten salám, jestli potom nějak nebyl čerstvý, a snědla ho, tak jí bylo strašně zle. Teď
měla horečku a vůbec nemohla ani ležet ani sedět, my jsme nemohly všechny si lehnout
v noci, musely jsme vždycky polovina sedět a polovina ležet. Takže jsme se střídaly na
tu noc, jednou jsme seděly a jednou jsme ležely do půlnoci. Já jsem viděla, že mámě je
zle, tak jsem říkala: Hele, mami, já budu sedět, mně to nevadí a Ty si lehni a lež. Teď
samozřejmě holky začaly, některý, štěkat, jako, že máma celou noc leží. Já jsem říkala:
Je jí špatně, já sedím místo ní. A potom, že musí na záchod. Já jsem říkala: Já půjdu s
Tebou... Ne, já půjdu sama... Já jsem říkala: Já tě přidržím... Ne já... Samozřejmě šla na
ten kýbl, zdrhla. Dovedete si představit v tom vagóně, když celej ten kýbl... Teď holky
začaly ječet, křičet, no se stalo. Teprve potom viděly jak... mama omdlela. Tak jsem jí
dotáhla a máma si tam lehla, naštěstí jsme zůstali stát. Tak ten post, co nás hlídal, tak
jsem mu to říkala, co se stalo, jestli bych někde nemohla sehnat vodu, že bych to chtěla
vyčistit, a byl nějakej solidní, tak šel a tam byla suchá tráva a tak mi udělal z té trávy
takové jako pometlo a přines té trávy hodně a přines několikrát kýble vody, že já jsem
to vždycky spláchla a tou trávou jsem to drhla ven. A tak jsem to celkem zdolala,
vydrhla, vůbec to nebylo cítit, to sluníčko to rychle vysušilo, vypařilo, že to bylo pak
suché. Nikdo mi nepomohl, ta moje sestřenice, která s námi jela ve vagóně, tu to ani
nenapadlo, akorát jedna, nějaká Věra, s kterou jsem pracovala v zahradě, ta mi
pomohla, ta jediná, to vyčistit. Teď jsme jery dál, máma... už viděly, že je jí zle, tak ji
nechaly ležet, a teď jsme přijely, samozřejmě jsme neměly tušení, kam to jedem, a
přijely jsme do Hamburku, a sice do takového starého špejcharu, z jedné strany byly
150
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
koleje a rampa, asi jak tam nakládali mouku do vagónů a byla to budova dvoupatrová.
No a tam nám řekli, že máme vystoupit. Já jsem prosila tu sestřenici, jestli by mi
nepomohla s mámou, protože ona byla ještě... nebyla schopná jít. Nejdřív mela plno
řečí, ale potom se přece jenom snad svědomí v ní hnulo a pomohla mi. No a tak jsme
dolezly do toho prvního patra, tam byly kavalce, máma si lehla a tím, že si tam lehla a
měla možnost se vyspat, tak jí bylo za dva dny dobře. Sice to byl... jmenovalo se to tam
Freihafen. Samozřejmě nálety, spoustu náletů, v noci spoustu náletů, ve dne... chodili...
první dva dny, myslím, nás nechali, to jsme zatím nic nedělaly a pak nás budili strašně
brzy, já nevím, jestli ve čtyři ráno nebo kdy a hnali nás do tamějších fabrik, kde jsme
dělaly různé odklizovací práce. Nejdříve jsme třeba taky jezdily parníkem, po nějakém
slepém rameni toho Labe, dělaly jsme v Renanii, v Europarku, Schindler, to já už
nevím, jak se všechny ty fabriky jmenovaly, kam jsme jezdily. Tam jsme obyčejně
dostaly v poledne nějaký Eintopf, no a večer, když jsme přišly domů, jsme dostaly ten
kousek chleba. Ráno tu černou žbrundu a nic jinýho. Tam se... tam... byl tam strašnej
hlad Dělali tam taky různí Francouzi, zajatci francouzský, dělali tam ruský zajatci a
děvčata se jako dostáno na dálku, přirozeně, seznamovaly s těma Francouzema a ti
Francouzi dostávali balíčky od Červeného kříže. A když jako nějaká ta... to děvče se s
ním seznámilo, tak se snažili občas tomu děvčeti pomoct. Třeba nějaké sušenky, co
dostali, a nebo cigarety. Já třeba měla už boty děravé, přirozeně, hrozný, já neměla
punčochy, mně byla šílená zima, tak jednou mi jeden dal takové nějaké vlněné
punčochy. Já jsem nevěděla, jestli je mam spíš dát mámě nebo ši je nechat, ale máma
tvrdila, ze jí zima není. Některý děvčata šíleně mrzly, když jsme ráno chodily... jezdily
po tom parníku do té práce. My jsme měly deky, tak nějaká holka si tu deku vzala pod
ty šaty, zabalila se do ní pod šatama, a když na to přišel esesák vedoucí, tak jí tak
zkopal a zmrskal, že to nestálo za to, aby si člověk tu deku vzal. Řval, když jsme šly, to
bylo samé Los a Saubande a Saujuden, no jenom nadávky pršely. Potom, když byl
nálet, tak jsme musely chodit, musely jsme, to neexistovalo, že bysme nešly, dolů do
sklepa, před tím náletem se jako schovat. Z jedné strany byly takový jako otevřený vrata
do toho slepého ramene Labe a z druhé strany byla holt ta rampa, ale tam jsme
nemohly. Teď tam jsme musely třeba v noci, v jednu, ve dvě, ve tri, kdy ten nálet byl,
jsme musely slézt dolů a musely jsme do toho sklepa. Teď tam bylo šíleně krys, my
jsme se bály... já jsem se strašně bála, že si sednu na krysu a ty krysy při tom náletu... ty
brečely jak malé děti, úplně hrozně brečely. No a byla tma, nikdo neměl samozřejmě ani
svíčku ani baterku, tak jsme tam byly za tmy, a když bylo po tom alarmu, tak jsme
směly nahoru. Když jsme byly v těch fabrikách, tam taky samozřejmě byl nálet. Někdy
nás odvedli do nějakého bunkru, ale směly jsme jenom do určité části toho bunkru,
nesměly jsme tam, co chodili civilní obyvatelé. A potom jsme... jednou byly v nějaké
fabrice, už si nepamatuju, co to bylo zač, a byl nálet, nejdříve byl Vollalarm a potom
teprve byl ten...A teď když byl ten alarm jako, tak jsem viděla, jak děvčata někam
utíkaly, no a já jsem nějak... jestli jsem si myslela, ze je dost času nebo co, tak jsem
nešla a najednou jsem byla v mlze. Oni pustili tu nějakou... mlhu, nebylo nic vidět a já v
té mlze byla a nevěděla jsem čí jsem, kde jsem a odkud a kam mám jít, no to jsem byla
tak zoufalá, protože jsem nevěděla, co se se mnou stane. No a tak jsem tam přečkala ten
nálet a potom jsem se z toho tedy dostala, ale bylo to hrůza. Tam jsme byli v tomhletom
Freihafenu asi... já nevím kolik měsíců. Pak jsme se najednou stěhovaly, a sice..
.myslím, že jsme tady byly v tom Freihafenu přes zimu, protože jsme potom chodily do
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
151
Hamburku, to jsme jezdily vlakem na odklizovací práce, a sice... taky jsme... jak byly ty
vybombardované domy, tak jsme měly kladívka a musely jsme ty cihly oklepávat a
dávat na kraj chodníku, stavět je, protože ty odváželi na stavbu nových domků. No a
tam část domů stála a ostatní bylo všechno dole a tam jsme pracovaly, a ten, co s námi
pracoval, ten esesák, co s námi byl, já nevím to byl... ten nosil hnědou uniformu, já
nevím, co to bylo, jestli to byl SA-Mann nebo co to bylo, nevím, co to bylo za šarži, no
a ten viděl, že třeba já mám boty s kramflekem a musím lézt..., a vůbec děvčata měly
špatné boty, tak jednou z ničeho nic řekl naší mámě, aby s ním šla. Samozřejmě, že
nevěděla kam, nevěděla co. No ale poručil, tak se šlo. A máma potom přišla a táhla
vozík, takový jak se dává vzadu za motorku. A v tom vozíku byly různé boty. On to
přines, ábysme si rozdělily ty boty, abysme si vzaly, které nám budou sedět a vyhodily
ty naše staré. Takže jsem dostala trošku jako normální, na zavázání boty, ne nové,
přirozeně, že starý křápy, ale lepší než ty moje s podpatkem. No a teď já..., jak byl ten
dům vybombardováný, tak zůstala stát jedna stěna a ta stěna to byly záchody a špajzky.
Takže my chodily do těch záchodů, nebylo to splachovací, ani to neodtékalo, ale
pohodlný. A teď jsme přišly na to, že v té jedné špajzce zůstala pětilitrová láhev
naložená vejci. Jenže ty vejce, že to bylo po náletu, hořelo, tak ty vejce v tom vodním
skle byly uvařený. No a někdo se to bál jíst, protože se nevědělo, co to způsobí, že jo, ty
uvařený vejce ve vodním skle, no ale snědly se. Potom jedna kamarádka, jak brala ty
cihly, tak najednou se udělala veliká díra. A ona říká: Holky, já se jdu podívat, co to je
v té díře. No samozřejmě byla to odvaha někam lézt, dolů do díry, když člověk neví,
kde je dno a co tam je... tma. Ale ona to udělala. Vlezla tam a křičela: Holky, tady jsou
brambory! Byl to nějaký sklep s bramborama. Tak jsme podávaly baťohy, co jsme
nosily, takové baťůžky a ona vždycky do každého dala tak 4 nebo 5 brambor, ne moc,
jen tak 4,5, abysme další den třeba měly zase. No až jsme to vybraly. Jednou šel okolo
nějaký pán starej a povídal: Děvčata, až to tady vyklidíte, já tady mám sklep, mám tam
brambory, tak Vám potom taky nějaké dám. No samozřejmě, že jsme mlčely, protože
jsme věděly, že už tam žádné brambory nemá, že jsme je snědly. No tak tam třeba
jednou, když už nápad sníh, tak jsme chodily zametat sníh na ulice. Jednou jsem
zametala sníh, samozřejmě, že jsme byly strašně chatrně oblečené, jsme nic neměly, já
jsem jednou, když jsem si šla odskočit, tak jsem našla na šňůře nějaký černý hadry, tak
jsem ši je vzala a zjistila jsem, že to jsou černé punčochy, jenže ty jsem dala mámě k
vánocům, byly dobrý. No a tam, jak jsme hrabaly... metly ten sníh, přišla ke mně nějaká
paní, okolo mne šla a říkala: Pojď za mnou do domu! No tak jsem šla. A ona mi v tom
domě dala celý bochník chleba a říkala: Na a rozdělte si to. To bylo nádherný, to jsme
byly blažený. No a moje máma, když někdy jako jsme... tam byly odpadky, tak třeba
našla navrch v té haldě odpadků... jednou rybí hlavy, to bylo okolo vánoc, tak které
mohla, tak vzala, bylo to v zimě, tak když je někdo vyhodil a hned zmrzly, tak jim nic
nebylo. Tak jsme udělaly doma z toho polévku. A jaká byla... výborná. Jednou našla
takhle na té haldě husí hlavu, ty nohy a peroutku, taky jsme udělaly polévku. I slupky
od brambor jsme našly, a to bylo výborný, protože jsme měly něco navíc. No tak
najednou zase, že se stěhujem jinam. Tak jsme se stěhovaly, a sice se to tam jmenovalo
Freihafen. Helena: To jste říkala, že se to tak jmenovalo předtím. L.: Jo, pardon,
Neugráben se to jmenovalo. Tohle byl Freihafen a teď jsme šly do toho Neugrábenu. A
v tom Neugrabenu jsme jezdily... tam jsme dělaly v lese, měly jsme vždycky nějakého
parťáka, tam jsme dělaly taky odklizovací práce, tam jsme třeba vyhazovaly z vagónu
152
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
suť nebo zase do vagónu se něco nahazovalo a tam okolo byly zahrady. Teď když za ten
plot spadlo nějaké spadlé jabko, tak samozřejmě to bylo pro nás veliké štěstí. Byla tam
nějaká stará paní, která na nás koukala, jak sbíráme ty padanky, co spadnou za ten plot,
tak jednou přišla a přinesla nám košík jablek. No a ten parťák, co s námi byl.. .tam
rostlo strážně hub, ten nám řekl, které houby máme sbírat, a že v té boudě, co jsme byly,
co jsme si odkládaly věci, tak v té boudě byly kamna a na těch kamnech nám ten děda
uvařil z těch hub polévku a někdy nám tam hodil nějakou bramboru. No to bylo taky
navíc vlastně. No a tam jsme byly až...já přesně už se nepamatuju dokdy, ale pak jsme
se opět stěhovaly, a sice do Tiefstacku, to bylo hrozný, protože tam se... jedna parta
tedy chodila ven z lágru, ale většinou jsme zůstávaly v lágru, protože... Helena: Jak se
to jmenovalo? L.: Tiefstack. Tam byla cementárna a my chodily do té cementárny
pracovat. A sice jsme dělaly ty tvárnice, co se z toho stavěly domy, ty tuplované
tvárnice a nebo takové desky betonové, no a to se muselo do formy upěchovat, pak se to
sušilo a pak, já nevím, co s tím dělali. Ale záleželo na tom, jak se to upěchovalo a jak to
bylo, ale celkem..., opravdu jsme neměly mimo toho, co jsme měly v lágru, to kafe ráno
a ta polévka a kousek toho chleba, absolutně nic, žádný jiný přínos nebyl, takže tam byl
príšernej hlad Potom, když byl nálet, tak tam byl takový..., kam se chodilo jenom před
těma..., já nevím, tak tam jsme chodívaly se schovávat a to jsme musely taky, jenže já
jsem nerada chodila do toho, protože jsem se tam cítila šíleně zavřená. No a jednoho
krásného dne najednou byl nálet, no a my jsme byly v té cementárně a s námi tam byl
esesák..., vlastně ti esesáci, co s námi dělali tady, to byli většinou pohraniční... celníci,
tak ti tam s námi byli a ti nebyli tak zlí, ne všichni, někteří byli celkem mírní. My jsme
měly nějakého, tomu jsme říkaly, samozřejmě mezi sebou, Otík, a ten Otík, když slyšel,
že je nálet, tak říkal: Děvčata, honem,honem, musíme odtud A tam vedly koleje a my
jsme musely přes ty koleje do lágru. No a utíkaly jsme do toho lágru a teď jedna z těch
děvčat, co jsme tam dělaly, říkala: Já půjdu na pokoj, já si jdu pro vodu, já si půjdu pro
teplou vodu, tam se chodilo, myslím, do kuchyně, půjdu se umýt, já na ten nálet kašlu.
No ale máma, ta mě hnala, říkala: Jen pojď, jen pojď, hezky pojď se mnou. Tak já jsem
šla, a teď, jak jsme procházely, my musely projít tou boudou, kde jsme měly stoly, kde
jsme jedly, a kde byla z jedné strany kuchyně. Tam byly police a v těch policích byly
mísy, co jsme měly na polévku. A nejednou, jak to začalo padat a bouchat, tak se to
třáslo, ty police, začaly se chvět, ty mísy začaly z toho skákat ven, padat a rozbíjet se, a
teď jsme byly akorát u té kuchyně, když jsme přišly do té kuchyně, tak já říkám: Mami,
kde jsi? Máma vlezla do kotle, přikryla se tam tím víkem před tím náletem, a já jsem si
tam někde vlezla, já už si nepamatuju kde, a teď to lítalo všude, a potom, když to
chvilku přestalo, tak jsme utíkaly do toho ještě grabnu tam. No a teď jsme tam vletěly,
no to bylo strašný, jak to lítalo. No a když bylo po tom, tak jsme viděly, co se stalo. Tak
ten barák, kde jsme spaly, kde byl revír, nemocnice a kde jsme spaly, tak ten byl úplně
srovnanej se zemí. Byly tam díry samozřejmě. Teď několik děvčat, co byly na tom
reviru nemocné, ty to zabilo, zranilo to strašně tu naši doktorku Goldovou, potom ta
Zuzka, co si šla pro tu teplou vodu, to byla nějaká Zuzka Glásrová, té nějaký ten trám
snad vlítnul tady do břicha, ta byla v agónii, ta už se nepřebrala, ta byla, já nevím, asi
den nebo jak v agónii, prostě, já nevím, kolik děvčat to tam zabilo. No a teď jsme měly
pouze jeden barák, který stál, jinak nic. No a tam jsme se všechny samozřejmě nemohly
nikdy vejít. No ale začalo se místo kuchyně stavět palandy, abysme měly kde spát. A
teď jsme tam měly takové... takové..., jak se tomu..., byly to takové domky, kde
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
153
vždycky byl nějaký esesák, který hlídal. No a v tom jednom, co byl ten esesák, toho to
taky zabilo, no a vedle byl nějaký lágr mužský, jestli to byli Italové nebo kdo, já nevím.
Já jsem třeba šla a najednou koukám, co to tam leží, no leželo tam nějaký... jako kus
masa, jestli to byla páteř nebo co, to bylo prostě příšerný. Samozřejmě neměli jsme už
žádný plot, protože to bylo všechno zničené a taky okolo tekla nějaká voda, jestli to byl
ještě nějaký kousek toho Labe nebo co. Takže jsem, co jsem mohla, vždycky šla se
umýt do té vody tam. Teď... nebyly jsme tam dlouho, byly jsme tam krátký čas, ale za
ten krátký čas už se chytly vši, už některý děvčata měly vši, že nás hned prohlíželi
všechny, nějací ti, kteři byli ošetřovatelé, jako sestry, tak ty nás prohlíželi, jestli
nemáme... stříhalo se tam... No a pak se rozkřiklo, že se jede dál. No tak nás odvezli,
naložili do vagónů a jelo se... nevědělo se zase kam. Taky se jelo asi dva dny, protože
jsme strašně stáli všude, protože když byl nálet, tak jsme zůstali stát. To už se nikam
nechodilo, musely jsme být v tom vlaku a potom jedině jsme směly ven, když jsme
potřebovaly někam si odskočit, když vlak stál, tak nám řekli, že můžeme tam okolo
někam si dojít. No až jsme přijely na místo určení, to byla tma večer, nevěděly jsme,
kde jsme. No a máma říkala... tam jsme... to byl... taky nějaká rampa tam byla, taky
vlaky, a když jsme tam byly, tak máma říkala: Heleď já potřebuju... pojď se mnou. Tak
jsme šly, a protože byla tma a neviděly jsme, tak já najednou koukám, co se děje...
Máma spadla a spadla do toho kolejiště a nevěděla, kde je, co je, protože byla tma.
Prostě byly rampy a dole koleje. Já jsem tam spadla za ní, ale naštěstí jsem si moc
nepotloukla, máma přece jen trošku, ale říkala, že nic, že to bude dobrý. No a pak, když
bylo ráno, tak že se musíme seřadit do pětistupů a jít. No tak jsme šly. Šly jsme a viděly
jsme cestou, jak támhle někdo leží, támhle někdo leží, jestli byli živí nebo mrtví, to
jsem nezaznamenala, až jsme přišly zase před bránu, kde bylo Arbeit macht frei a tak
jsme viděly, ze je to zas nějaký koncentrák. No a to byl Bergen-Belsen. Teď nás hnali
po té Lagerstrasse a já vidím tam obrovskou horu, tak si říkám, co to tu je, a to byla
hora bot. To byly samý bory naházený na haldě. A šly jsme a zahnali nás do jednoho
baráku, tam jsme ležely na zemi, ležela nás tam strašná spousta a tam jsme se sešly s
děvčatama, který byly v Christianstadtu, jak ta moje kamarádka, ta tam byla taky. Ty
tam ale byly už od února. My jsme tam přišly, myslím, 15. března. A říkaly, že to tam je
strašný. Že za prvé se nic nedělá, že jsou tam vši, že je tam hlad Teď já jsem se snažila
vždycky dostat někam, kde se dělá, protože jsem věděla, když někde budu něco dělat,
že třeba k něčemu přijdu. A jednou taky říkali, kdo se chce přihlásit na nějakou práci,
tak jsem se přihlásila. A sice jsme šly, to ještě jsme nebyli osvobození, šly jsme do
nějakého domu, kde jsme vyndávaly boty, ponožky a takové věci, co se nakládaly na
auta. Teď já koukám, co to je za průvod, co to je, po té silnici, po té Lagerstrasse
najednou vidím, že jde vždycky nějaký chlap a má něco přivázaného. Tak si říkám, co
to je? A oni to táhli... buď byly přivázané ty mrtvoly za ruce nebo za nohy, nahé, a
takhle oni to táhli za sebou. A to táhli až někam k nějaké jámě, kde byl společný hrob a
to tam naházeli. To bylo něco příšernýho, když to člověk zjistil, že je to vlastně člověk.
No a teď tam byla taková halda, tam byl písek hodně a tam jsme si mohly dojít, když
jsme potřebovaly, když jsme tam dělaly. Já jsem tam šla, jak jsem takhle hrabala v tom
písku, najednou jsem našla krabičku. Co to je? Takjsem to otevřela a zjistila jsem, že
tam je injekční stříkačka, jehly a byly tam ampulky a to byl Sympatol. Ten se dával
tenkrát, myslím, na srdce, ten Sympatol. Tak jsem to tam nechala, protože jsem se bála
to vzít a vzala jsem si jenom ty ampulky toho Sympatolu. Potom jsme se zase stěhovaly
154
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
odtamtud a šly jsme do takového baráku, to bylo vedle revíru. Ale nejdřív jsme spaly v
takovém baráku, že jsme byly naskládaný jak sardinky, jedna vedle druhé, když se
jedna chtěla otočit, musela celá řada. Když jsme potřebovaly jít v noci ven, no to bylo
řvaní, protože většinou se na někoho šláplo. To nebylo možné jinak než, že se člověk
někoho dotknul náhodou. No a odtamtad právě jsme se stěhovaly zase, jenže tam byla
příšerná nouze o vodu. Tam nebyla vůbec voda, to bylo strašný. No a 15. dubna... tam
jsme vegetovaly tedy ten měsíc a 15. dubna nás osvobodili Angličani. Asi dva nebo tři
dny před tím, než nás Angličani osvobodili, tak jsme viděly, že je nějaký zmatek mezi
esesákama, že většina... jo a pak nás tam hlídali nějaký maďarský vojáci a všichni měli
na rukou bílé pásky. A nesměly jsme z baráku vystrčit ani nos. Jakmile někdo šel ven z
baráku, tak stříleli. Tak nevěděly jsme, co se bude dít a najednou jsme slyšely tlampač a
z tlampače se ozývalo asi ve čtyřech řečech, že jsme osvobození, že jsme volni, že
přijeli Angličani nás osvobodit, ale že se nesmíme vzdálit ze svého místa, kde jsme, že
budeme dostávat pravidelné jíst, že jídla bude dost, ale že nejdříve nás musí odvšivit a
bude určitá doba karantény než nás rozvezou, kam patříme. No tak, když přišli ti
Angličani, tak první, co bylo, viděli, jak jsme šíleně hubení a tam jsem se dověděla, že
nějaká moje kamarádka, Rutky švagrová, Nelka, že mě sháněla, já jsem kdysi vedle ní
spala, a že je na revíru v té nemocnici. No tak ještě s jednou kamarádkou, která věděla,
že má na revíru sestru, jsme se tam vydaly. To byl obraz hrůzy, to byly takové tmavé
místnosti, kde leželi ty lidi namačkaný na zemi, bez ošetření, bez vody, bez ničeho. Teď
samozřejmě všichni na nás, když jsme šli kolem, křičeli: Potřebujeme vodu, přineste
nám vodu. No tak jsme hledaly, kde najdem vodu. Tak jsme přišly až... našly jsme
nějaké plechovky, až jsme přišly k bazénu, kde jsme myslely, že tam bysme mohly
nabrat vodu a teď jsme viděly, že v tom bazénu třeba plavou mrtvoly, nebo jedna
mrtvola je... část jí je ve vodě a část jí je nahoře, tak jsme si netroufly tu vodu vzít,
abysme neublížily ještě víc než bylo. No prostě vodu jsme nenašly, Nelku jsme nenašly,
ale Hanka, ta našla tu svoji sestru, která jí říkala: Hanko, hele, já stejně, jestli dnes nebo
zítra, stejně umřu, protože to cítím, že je mi strašné zle... No umřela. No a tam potom ti
Angličani nám nejdřív dali konzervy, protože to byli řadoví vojáci, normální řadoví
vojáci, mysleli si, že kdoví co nám nedaj, když nám dali vepřovou konzervu. Jenže kdo
sněd vepřovou konzervu, okamžitě dostal průjem a byl možná dřív pryč, jak po tyfusu.
Máma mi to zakázala jíst, my jsme tu konzervu schovaly, a dostávaly jsme mléko,
sušené mléko, ráno. No to jsem docela ráda pila a potom nám dávali takové psí suchary,
to máma dovolila, že to můžeme jíst. Tak jsem to jedla a máma celý den nic jiného
nedělala, než se ráno svlékla, hledala vši, jestli nemá, máma nedostala skvrnitý tyfus
tím pádem. Celý den se prohlížela, jestli jí někde nemá. Já zase naopak, já jsem hledala
tuhle Reginu, kterou jsem pak zase našla, potom ti vojáci nás začli odvšivovat, to
znamenalo, že nám nafoukali do hlavy DDT a vůbec po celém těle nás nastříkali DDT,
vykoupaly jsme se, dali nám tam nějaké prádlo a tím to zvadlo. Já jsem... tam byly
takový různý kamry, který jsme potom mohly otevřít a chodily jsme se dívat, co tam je.
Tak třeba byla... jeden barák, který byl plný protéz. Tam byly jen protézy, ruce, nohy,
dál byly samé brýle a v jednom zase baráku byly samé... prádlo, prádlo dané do balíků.
Tak to jsme si rozebíraly, já jsem třeba odnesla spoustu toho prádla Regině, aby se
mohla převlíct, aby si mohla brát, kdy potřebovala, čisté, mámě jsem donesla. Potom
jsem zase našla někde nějaké ponožky a boty, no to jsem všechno natahala, a potom
jsme šly... jsem šla do takových bunkrů až na kraj toho lágru. Tam byly takové bunkry,
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
155
malé, takové místnůstky bez oken, beze všeho, jenom dveře a díra, kam asi dávali
vězně. Našla jsem tam, ještě taky v jiných místnostech, spoustu peněz. Tam byly
všelijaké peníze, německé, dánské, všeho možnýho, mne to vůbec nezajímalo, co bych
dělala tam s penězma, k čemu by mi byly dobrý. Já jsem spíš hledala, kde najdu nějaké
ošacení, no až jsem přišla, kde byly složené sukně, halenky, svetry. Tak toho jsem
nabrala plno, abych to odnesla mámě a té kamarádce. Jenže potom nám řekli, že
všechno, co v tom lágru máme, že tam musíme nechat. Vzít si jen to, až projdem tím,
jak nás odvšivili, že nastoupíme do autobusu a že nás odvezou do jiného lágru. A
odvezli nás zase do jiného lágru, to byly zděné domky, kde asi dříve byli vojáci, byly
tam sice kavalce, ale dvoupatrové. Tam nás bydlelo v takové jedné místnosti tak kolem
patnácti, dvaceti, a tam jsme potom byly. Tam bylo v okolí spousta domků, všechno
bylo opuštěné Němcema. No a s jednou kamarádkou jsme se snažily prošmejdit, co
jsme mohly. Protože jsme, říkám, hlavně hledaly jídlo a hledaly jsme něco na sebe.,
taky jsme přišly do nějaké vily, kde byty zřejmě /konec 1. kazety/ My jsme mohly
chodit, kam jsme chtěly a my jsme hlavně chodily do lesa, tam bylo strašně borůvek,
tak jsme chodily s děvčatama na borůvky, a já ty borůvky prodávala za cigarety, které
jsme dostávaly od Červeného kříže, schovávala jsem je, protože jsme dostaly do
Belsenu dopis od mého bratra, že žije. Tak jsme byly s mámou strašně šťastné, že
brácha žije. Brácha rád kouřil, tak jsme sbíraly cigarety, abysme mu mohly něco donést.
No tam bylo opravdu strážně borůvek a jednou jsem přišla k nějaké chalupě a tam v té
chalupě zřejmě byl nějaký hodinář, protože jsem tam našla strašně rozebraných hodinek
a tam byla studna a u té studny byly dokonce i celé hodinky. Tak jsem si jedny vzala a
šla jsem... šly jsme s mámou a najednou jsme potkaly Rusa, který nesl slepici. A my mu
říkaly, jestli nechce časy. A on říkal: Chci. Tak jsme říkaly, že mu dáme časy a tabák,
když nám dá tu slepici. No tak jsme udělaly měnný obchod a přišly jsme domů, jenže já
jsem... to už jsem cítila, že mi není dobře a bylo mi tak zle, že jsem hned dostala
čtyřicítku horečku a měla jsem skvrnitý tyfus. To tam přišel... to už tam chodil doktor,
to byl nějaký Němec ze Sudet, který zjistil, že tedy mám skvrnitý tyfus. Ležela jsem
tam ale asi, já nevím, jestli několik dní se čtyřicítkama. To bylo strašný, já horečkou ani
nemohla spát, to byly hrozné sny, co jsem měla a tak nás zas odvezly, tedy jenom mne,
děvčata, co měly skvrnitý tyfus... někam, kde byly baráky s nemocnými a tam jsme
ležely nejdříve na zemi, potom teprve nám dali matrace, potom teprve nám dali za
nějaký čas postele. Léky nebyly, ten Sympatol jsem tam dala v tom revíru, já už ani
nevím komu, protože všechny byly ubohé a všechny to potřebovaly. A ten doktor, když
tam přišel a zjistil jako, že jsme z Čech, tak se nás ptal, jestli nevíme, kdo je v
Karlových Varech, jestli jsou tam Rusáci nebo Angličani. No my samozřejmě to
nevěděly. No a on byl asi ze Sudet. Tak tam jsem ležela skoro měsíc v té nemocnici. To
už tady byla revoluce, to už tady byl konec, ale já jsem ještě byla v Belsenu. My jsme
přijely až začátkem července do Prahy. No a přijely jsme do Prahy na Smíchovské
nádraží a my jsme žili..., táta žil odjakživa na Moráni, nás tam všichni znali, tak máma
se pokusila zavolat sousedovi, cukrář, který tam byl, to byl náš soused, že jsme tam a
jestli by nemohl pro nás přijet. Protože jsme dostaly od Červeného kříže balíky a přece
jsme nějaké věci měly, měly jsme pytel psích sucharů, no a tak pro nás přijel a neměly
jsme ovšem kde bydlet, protože ten byt, co jsme měli, byl obsazený, sice jsme mohly
chtít, aby je vyhodili, jenže to jsme zase nechtěly a ani jsme nechtěly... máma nechtěla
krám, tak jsme bydlely napřed u jedné známé jako v podnájmu, ta nám byla dlužná
156
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
spoustu peněz, tak říkala: Aspoň si to u mne odbydlíte. U ní jsme bydlely a pak se
máma dozvěděla, že naproti v domě tam bydlel starý pán, který byl v nemocnici a měl
velký třípokojový byt. A někdo mámě řekl, aby si za ním došla do nemocnice, jestli by
nám jednu místnost nepronajal. No tak máma tam za ním šla, ale to já už jsem ale byla v
Kytlici, kde jsem dělala v té továrně na lišty a rámy s kamarádkou jednou. Ten profesor
Kynsl řekl mámě, že beze všeho, že si jako může vzít tu jednu půlku bytu, tu, kde je ta
kuchyň a jedna místnost, to byly jako do dvora a ty dva pokoje do ulice, že si jako
nechá. No a máma mu jako zase řekla, že mu uvaří, když přijde z nemocnice, že se o něj
jako postará, ono mu bylo skoro... přes osmdesát, já přesně nevím. Jeho sestra byla
ředitelka a já jsem chodila do školy, kde ona právě byla ředitelka. No a máma jako
psala, abysme přijeli na vánoce, no tak jsme přijeli na vánoce, že tam bude ten profesor
Kynsl, jenže on mezi tou dobou zemřel. A ten byt nám tedy zůstal celý. Co tam bylo...
oni byli oba malé postavy, všechno si odvezl Červený kříž. Bylo tam spousta knih,
francouzských, německých, všeho, to si všechno odvezl Červený kříž, i když se ptali,
jestli z toho máma něco nechce. Máma říkala, že ne, že nic nepotřebujem, že si všechno
opatříme. No já jsem potom na jaře, když bratr mi furt psal, že co blázním být někde v
pohraničí a že to nemá smysl, abych tam byla, abych přijela do Prahy, že máma si to
přeje, no tak já jsem potom, protože se to stejně likvidovalo to pohraničí, tak jsem
potom přijela někdy v březnu do Prahy. Našla jsem si místo, pracovala jsem u Autogén
Mareš, tam se prodávaly plynové a kyslíkové bomby, tak jsem dělala tu evidenci těch
láhví, no a seznámila jsem se s Karlem, seznámili jsme se někdy koncem dubna,
začátkem května a Karel ten se snažil, abych užuž byla pod čepcem, tak chtěl, že na
moje narozeniny uděláme zasnoubení. Tak na moje narozeniny, 31. května jsme měli
zasnoubení, no a Karel byl tenkrát na vojně a končila mu vojna v srpnu a říkal, že jako
bysme mohli v tom srpnu se rovnou vzít. No tak jsme se v srpnu vzali a protože tady v
tom bytě žila jeho matka, ten byt dostal zpátky, Když musela jeho matka odejít z toho
bytu, tak sem přišel nějaký Němec. A ten Němec se v kuchyni otrávil a ta jeho žena,
dcera a syn odešli do Německa. Tím pádem teda ten byt dostal, no a tady..., když jsme
se vzali, tak jsme bydleli tady od té doby. No a pak se narodila napřed dcera, potom syn
a Karel dělal napřed ve Svazu pro mléko a tuky, potom přešel na ministerstvo, z
ministerstva přešel do Čokoládoven. Já jsem nebyla zaměstnaná, dokud byly děti malé,
až později, nejdřív jsem chodila brigádu dělat do Sazky, což bylo jen třikrát týdně a
zatěžovalo nás to, protože Karel si nepřál, abych dělala, říkal, že to nebudeme mít žádný
rodinný život, jenže potom jsme měli málo peněz samozřejmě, vždyť jsme žili jenom z
jednoho platu. No a tak jsem šla dělat do Čedoku. Dělala jsem v Čedoku až do důchodu.
No to už je... Helena: Já Vám moc děkuju.... L.: Já jsem to vzala teď hopem... Helena:
Váš manžel taky byl...? L.: Můj manžel, ano, byl napřed v Terezíně, potom ve
Wulkově, jenže se vrátil z toho Wulkova zpátky do Terezína. No a když byl konec,
když bylo po revoluci, tak všechny věci, co měl v Terezíně si mohl přivézt sem, já
neměla nic. Já jsem přijela, já měla námořnické kalhoty, když jsem přijela, měla jsem
jedny dřevěné boty, já neměla vůbec nic. To jsem měla tady kamarádky, tak jedna
kamarádka mi dala třeba šaty, druhá mi dala něco... každá mi něco dala, že jsem...
Potom jsem měla kamarádku, která..., její otec pracoval v nějakém sociálním... kde
rozdávali šaty pro ty repatrianty. Tak říkala: Pojď, půjdeš se mnou a podíváš se, jestli
tam něco bude. Jenže to pěkné, to už si dávno všichni vybrali a zůstalo tam jenom to, co
už pomalu ani nebylo na nošení. No ale přece jen něco si mohl člověk z toho aspoň
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
157
udělat. No ze začátku to byla strašná bída. Za prvé Karel měl malý plat, protože platy
tenkrát nebyly žádný veliký. Jedna třetina platu šla na činži tady, no a z dvou třetin jsme
žili potom všichni čtyři. No tak proto jsem šla do toho Čedoku, sice ze začátku taky
jsem neměla žádný skvělý plat, ale časem se to přece jen vylepšilo. Taky jsem jezdila
jako průvodce se skupinama, takže přece jen to bylo navíc. No a děti začly chodit do
školy, potom se Karel, samozřejmě, když Pepíkovi bylo asi 16, tak se Karel rozstonal, a
protože on byl v tom Wulkově a tam byl nějaký esesák Stužka, který taky byl
nevypočitatemý, co udělá, tak jednoho krásného dne v zimě, já nevím, co se stalo
přesně, vyhnal Karla ven, protože byl jako parťák tesařů, a v noci při mrazu, já nevím
kolikastupňovém, ho poléval studenou vodou nahého, kopal do něj a mlátil ho a prorazil
mu ušní bubínek, takže Karel potom měl invalidní důchod, protože na jedno ucho
neslyšel. A z toho Wulkova..., já nevím, jak dlouho tam byli, přesně nevím, sice mám
tady někde ten časopis o tom Wulkově... No a když jsme se z toho nejhoršího dostali,
tak Karel dostal polycyténu, nějakou krevní nemoc, měl moc červených krvinek a
dostával nějaké injekce, jedna injekce mu poprvé vydržela asi dva roky, to druhý už jen
půl roku a ošetřoval ho nějaký docent Doner, no a pak jsme jezdili hodně na lyže, Karel
tam dostal chřipku, začal krvácet z nosu třeba hodinu... ještě déle krvácel z nosu.
Nejdřív na to nepřišli a pak přišli na to, že tou chřipkou ta jeho nemoc vzala zvrat, že
místo moc červených krvinek má málo, prostě se to zvrátilo do leukemie, ta
polycytemie. Během roku Karel zemřel. Helena: Kolik mu bylo? L.: Karlovi 49. No a já
zůstala s dětma, to Pepíkovi bylo tenkrát 17, Ivě 19, Iva akorát maturovala, když měl
Karel pohřeb, no a Pepík ještě chodil na gymnázium, a můžu Vám říct, že jsem to
prožívala dost těžce, protože jsem za prvé ještě neměla žádnej... nic moc plat, ten
důchod jsem dostala asi až za dva za tři měsíce, že jsme jen tak tak existovali. No Iva
maturovala na umělecko-průmyslové škole a chtěla jít dál na vejšku. Jenže to, když
byly přihlášky, to byl únor, to Karel byl nemocný samozřejmě, a měl třeba čtyři
měsíce... byl žlutý, měl těžkou žloutenku, to bylo z těch transfuzí, protože dostal asi 25
transfuzí. Tak říkal: Hele, Ivo, počkej, až uvidíme, jak to bude dál, jestli bych to
zvládnul finančně, protože budu mít invalidní důchod, no tak nevím, jestli bysme to
mohli risknout, abys šla na vejšku... Jenže Iva potom šla do zaměstnání, a když šla do
zaměstnání, tak přece jenom zjistila, že ty peníze nejsou marný, tak už potom nechtěla
ani na tu vejšku jít. No a Pepík, ten dělal to gymnasium a taky chtěl jít na vejšku, jenže
se nedostal, protože měl nějaké spory tam s panem profesorem jedním, který mu dost
škodil, no a ale nic. A protože já měla strach, přišel rok 68 a já měla strach, aby Pepík
nešel na vojnu. Tak jsem nevěděla, co mám dělat, tak Franta mi poradil, že má
známého, a že by Pepík mohl jít se učit automechanikem. No a tak šel se Pepík učit
automechanikem, a protože měl maturitu, tak se učil jen rok a půl. Tam zjistili, že Pepík
to, co se ti kluci tam učí třeba dva roky, takže Pepík už to všechno umí, že hrozně..., já
tam musela chodit, i když už byl vlastně plnoletý, abych vyslechla chválu na Pepíka.
Tak ho hned doporučili na průmyslovku, takže Pepík si udělal při tom učení ještě strojní
průmyslovku, takže ještě měl jednu maturitu ze strojní průmyslovky. Pak zase chtěli,
aby šel aspoň na tři semestry na pedagogickou, že by dělal učňům mistra. Jenže to už
Pepík zase se oženil a jel bydlet do Plzně, do toho jejich baráčku, takže už z toho taky
sešlo, no a dcera se vdala, syn se oženil, byly čtyři vnoučata, teď je poslední pravnouče
a život jde dál. A teďka, když jsme na sklonku života, když mně pomalu bude osmdesát,
tak začly nám přece jen kynout nějaké dary z Německa, což bylo... jak bych... já Vám
158
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
řeknu, že to bylo dost sprostý od těch Němců, že všichni dostali za to... vždyť nám
sebrali všechno, vždyť nám sebrali veškerý majetek, co jsme měli, sebrali nám životy
všech příbuzných, sebrali nám kolik let života, vždyť jsme byli... Já byla přes tři roky v
koncentráku. No a teďka, ke sklonku života nám milostivě budou něco dávat. Helena:
Už jste něco dostali? L.: Od naší vlády jsme dostali za každý měsíc v koncentráku
vlastně asi 2.300 korun. A pak jsme dostali teď z toho švýcarského fondu asi 12.000, to
je asi 400 dolarů, což ještě něco má přijít. A teď jsme dávali nějaké přihlášky, že Němci
budou dávat asi 250 marek měsíčně. Helena: Tak to by bylo aspoň..., aspoň něco... L.:
Ale teď, co už z toho člověk může... jedině, že má zajištěné, že nebude mít hlad a bídu
na starý kolena. Helena: Jo a měla jste nějaký styk s Němcema někdy po válce? L.: Ne.
Helena: Vůbec... a v Německu jste někdy byla? L.: Jo, v Německu jsem byla několikrát,
víckrát, když jsem jezdila... když jsem byla v Čedoku, tak jsme tam byli každou
chvilku. Různě, nejdříve v NDR, potom v Západním Německu, než to bylo spojené...
Helena: A jako byl to divný pocit tam mezi nima? L.: No, nemůžu říct. Víte, když jsme
jeli vlakem, když jsme jeli vlakem z toho Belsenu, tam jsme taky byli v dobytčáku, ale
bylo nás míň, daleko míň a jel s námi nějaký...jmenoval se Strulovič, a když jsme přijeli
na jedno nádraží, nevím přesně kam, tak najednou Strulovič zmiznul a vrátil se s kolem.
Prostě ho sebral nějakému klukovi a ten začal tam přej křičet, že mu ukrad kolo a on
říkal: Vy jste nám vzali víc. A tím to zvadlo. Nebo jsme jeli a zastavili jsme a tam byla
zahrada. No a ti kluci, co s námi jeli říkali: Děvčata, chcete rybíz? My jsme řekly, že jo.
Přirozeně, rybíz jsme neviděly kolik let. No tak oni.. .on šel, nenamáhal se s trháním
rybízu, nýbrž vytrhnul celý stromek, keřík, ne keřík, stromek rybízový a přinesl nám ho.
Ti majitelé samozřejmě taky asi křičeli, že jim to bere, a oni taky řekli: Vy jste nám
vzali víc. Prostě... z toho si jako hlavu nedělali. Jinak dříve samozřejmě, že jsme
nenáviděli Němce, to je jasný. Ale... já můžu říct, že ten vedoucí toho Landwirtschaftu,
ten Němec, nějaký Kursawe a jeho manželka, ti se vždycky chovali k nám, dá se říct,
slušně. No a ti, jak jsem Vám říkala, že s námi chodili česat Hahn, Altmann a Ulrich,
taky nám nijak neublížili. Kdo ublížil, to byli esesáci. To byli Heinl a ti vedoucí esesáci,
jenže naštěstí já s nima nepřišla do styku.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
159
Dokument: 3 Eva R.
Helena: Nun würde ich Sie bitten, mir Ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Eva: Ich bin
im Jahre 21 geboren, in einem kleinen Ort im ehemaligen Sudetengebiet. Bis zum Jahre
38 habe ich ganz normal gelebt, ein einziges Kind, und war ein bißchen verwöhnt von
beiden Großmüttern. Wir haben ein ganz angenehmes Leben gehabt, in einem hübschen
Haus gewohnt, und ich hatte viele Freunde, jüdische und deutsche Freunde und
Schulkameraden und so, dann, im Mai 38, hat sich die Situation ein bißchen geändert,
so langsam. Der Hitler hat ja hie und da ein paar Reden gehabt, nach diesen Reden sind
die Leute durch die Straßen gegangen und haben gebrüllt: "Juden raus", so
antisemetische Ansichten. Wir haben geglaubt, das wird wieder vorübergehen, ja, aber
das hat sich dann so gesteigert, wie, ja, 38 nach den Ferien bin ich wieder in die Schule
gekommen, auf einmal haben die Freundinnen, mit denen ich in der Bank gesessen bin,
haben sich nicht mehr mit uns unterhalten oder wir mußten ganz separat sitzen, wir
waren auf einmal wie Aussätzige. Niemand hat mit uns gesprochen, alle haben uns als
Feinde betrachtet, sie waren, das war die Propaganda, ich glaube, das war nicht aus
ihrem Kopf. Aber die haben so, uns als Feinde behandelt. Ich bin jeden Tag aus der
Schule gekommen, hab geweint, ich geh nicht mehr in die Schule, die Freun... alle
Freunde hab ich eigentlich verloren. Wir waren eine kleine Gruppe, nur noch fünf Juden
in der Klasse, wir waren ganz vollkommen separiert. Eines Tages bin ich nach Hause
gekommen, wieder weinend, es war schrecklich, die Professoren haben sich zu uns sehr
unangenehm benommen, und so, ich will nicht mehr in die Schule. Aber die Eltern
wollten ständig, daß ich noch in die Schule..., mein Vater hat auch auf diesem
Gymnasium unterrichtet, und hatte deshalb auch Unannehmlichkeiten, er war der
einzige Jude unter den Professoren, hat auch sehr zu leiden gehabt. Ja, und eines Tages
ist meine Großmutter, mit der wir gelebt haben, und meine Mutter sind nach Prag
gefahren und haben in Prag ein Zimmer in der Untermiete genommen, nur wenn die
Situation sich verschlechtern sollte, daß wir für ein paar Tage nach Prag fahren, also,
eines Tages war es so weit, wie sie uns die Fenster eingeschlagen haben, es war
wirklich lebensgefährlich damals, auf der Straße zu gehen. Helena: Nach 38? Eva: Im
Herbst 38, vor München. Aber, also, eines Tages bin ich aus der Schule gekommen mit
meiner Aktentasche, die Mutter hat gesagt, schau, pack dir ein paar Sachen in die
Aktentasche, wie ich aus der Schule gekommen bin, wir gehen für ein paar Tage nach
Prag. Es wird sich vielleicht wieder beruhigen, es wird alles wieder normal. Wir waren
so, so, die Emotionen waren damals schrecklich. Aber, no, ich war glücklich, ich war
zufrieden, ich muß nicht mehr in die Schule gehen, also sind wir nach Prag, nur wir
drei, die Großmutter, die Mutter und ich sind nach Prag gefahren für ein paar Tage. Und
Mutter hat auch ein kleines Köfferchen gehabt, die notwendigsten Sachen, die
Großmutter auch. Wir sind nie mehr zurückgekommen, das war alles, was wir gehabt
haben, was ich in der Schultasche hatte und so. Wir haben hier in Untermiete in einem
kleinen Zimmer in einem alten Haus in den Weinbergen eine Zeitlang gelebt, also es
war sehr unangenehm, wir konnten dort nicht kochen, konnten nicht waschen, nicht
unsere Wäsche waschen, also nichts, es war nicht für längere Zeit, es war nur für ein
paar Tage. No und nach und nach ist noch mein Onkel gekommen, der Bruder meiner
Mutter, der konnte es dort auch nicht mehr, der hatte ein Geschäft und das Geschäft
wurde ihm genommen. Mein Vater ist aus der Schule gekommen, der wurde
160
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
herausgeworfen, in die Pension gegeben. Also, fünf in einem kleinen Zimmer konnten
wir nicht mehr leben, also haben wir dann eine Wohnung gesucht, das war schon nach
München. Inzwischen war München, wir waren eigentlich die ersten Vertriebenen,
sogenannte Vertriebene, so spricht man jetzt davon. Aber, es war furchtbar, die
Situation. Wir haben den Boden unter den Füßen verloren. Wir wußten nicht, wohin wir
gehören. Hier war die Situation so, hier waren viele Flüchtlinge, die Tschechen waren
auch nicht sehr begeistert von uns, von den Flüchtlingen. Jetzt waren wir ohne Geld,
mein Vater hat eine ganz kleine Pension bekommen, wir hatten 5 Leute von dieser
Pension zu leben, war sehr unangenehm, wir hatten keine Möbel, wir hatten kein, kein
Kochgeschirr, wir hatten keine Teller, no, nichts. Wir sind nur immer ins Cafe gegangen
Mittag essen, wir konnten dort nicht einmal Kaffee kochen in diesem Zimmer in der
Untermiete. Also, dann haben wir eine Wohnung, eine kleine Wohnung, ein Zimmer
mit Küche gemietet und haben dort recht und schlecht, die Mutter, der Vater und ich in
dem Zimmer, die Großmutter mit dem Onkel, ihrem Sohn, in der Küche gewohnt, also
ganz... , Freunde und Bekannte haben uns verschiedene Möbel und Geschirr geborgt,
nur das Notwendigste, also haben wir so gelebt sehr betrübt und deprimiert, und wir
wußten nicht, was mit unseren Sachen geschehen muß, die sind alle dort geblieben, also
die Situation war sehr unangenehm, mein Onkel, der ist gekommen mit einem Zug, der
wurde, die Tschechen haben ihn nicht angenommen, das war schon damals die
faschistische Republik, zweite Republik, die Deutschen haben ihn, den Zug nicht
herausge...., wollten ihn über die Grenze bringen, die Tschechen sind, ich weiß nicht,
eine Woche waren sie an der Grenze im Niemandsland gestanden. Er war nur mit dem,
was er an sich hatte, hatte überhaupt nichts mitnehmen können, also die Situation war
sehr, sehr erdrückend. No, und dann endlich haben, also nach einigen, nach dem
Münchener Abkommen, also haben die Tschechen diese Züge übernommen mit den
Flüchtlingen, da waren ja tausende Flüchtlinge da, die sind dann nach, teilweise nach
Prag gekommen. In Prag wußte man auch nicht, was mit ihnen zu machen, also wir
haben ziemlich, wir hatten wenig Freunde hier, aber einmal auf der Straße, das war
dann schon November oder so, habe ich einen jungen Mann getroffen, mit dem ich im
Sommer Tennis gespielt habe, und wir waren beide so froh uns wiederzusehen nach
dem Sommer und was alles passiert ist, ich hatte keine Freunde, also haben wir uns
mehr und mehr befreundet und haben uns dann verlobt. Es war so, jeder wollte damals
auswandern, das war so, hier war keine Möglichkeit weiter zu leben es war so
aussichtslos für uns. Mein Vater hatte keine Stelle, und ich wurde aus dem, ich bin hier
noch eine Zeitlang ins Gymnasium gegangen, da wurde ich auch herausgeworfen, da
konnten wir eben nicht mehr in die Schulen gehen, also hab ich angefangen zu lernen,
Hüte zu machen, also das war so eine unangenehm ..., und der Freund, den ich damals
vom Sommer gekannt hatte, der war Prager, der hatte die Eltern hier in Prag, wir haben
uns dann mehr und mehr befreundet, also, sein, also, ich weiß nicht, wie kann man das
Heiratsantrag nennen, (lacht) hat er gesagt Fräulein, möchten sie mit mir nicht
auswandern (lacht), das war so, (lacht) das hat bedeutet, daß er sich vorstellt, daß wir
zusammen auswandern. Wir haben uns sehr bemüht, jeder hat sich damals bemüht,
auszuwandern, aber das war ganz, fast unmöglich, niemand wollte uns, keiner aus dem
Ausland, in England, in Amerika, das war damals schrecklich schwer auszuwandern,
aber er hat sich sehr bemüht, und es ist ihm leider nicht gelungen, dann war die
Besetzung im März 39, also dann war das ganz ausgeschlossen, und ihm ist es noch
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
161
gelungen, eine Woche nach der Besetzung durch die Deutschen nach England zu
kommen. Er hatte dort einen Freund, der hat ihn auf einer Universität angemeldet, er
war schon fertiger Rechtsanwalt, aber hat ihn nur so proforma auf einer Universität
angemeldet, und mit dieser Bestätigung ist es ihm nach vielen Komplikationen
gelungen, nach England zu kommen. Er sagte, ich kann euch von hier nicht helfen,
vielleicht in England wird es mir möglich sein. Seine Eltern haben sich auch zu uns sehr
schön benommen, die haben uns geholfen, wo sie konnten, aber seine Schwester mit
zwei Kindern, er hat sich bemüht, auch sie nach England zu bringen, und es ist ihnen
fast gelungen, die Kinder sollten mit diesem Kindertransport nach England fahren, und
der Transport sollte am 1. September nach England fahren. Am 1. September ist der
Krieg ausgebrochen, sie hatten alles schon gepackt, und sind nicht über die Grenze
gekommen und sind hier in Auschwitz ums Leben gekommen, wie unsere ganzen
Familien, beide Familien. No, also dann, er war in England, wir hatten noch einige, hier
und da noch einige Verbindungen über die Schweiz, aber das war auch damals schon
schwierig, also man hat es, dann ist es vollkommen abgebrochen, wir hatten
voneinander keine Nachricht, mehr als sechs Jahre. Helena: Und Sie waren verlobt?
Eva: Wir waren verlobt, ja, das war sozusagen verlobt, unter diesen abnormalen
Bedingungen. Aber die Eltern haben sich, haben mich als Tochter betrachtet und haben
sich um mich gekümmert, und haben uns sehr viel damals geholfen, meine Großmutter,
die hat das alles schwer getragen, sie ist, einen Tag nach der Abfahrt meines Verlobten
hat sie Selbstmord begangen. Sie konnte hier nicht mehr leben. Hat sie sich Gaspulver
genommen, ist sie gestorben, weil für sie war das, das Leben hatte eigentlich den Sinn
verloren. Sie hatte noch, außerdem hatte sie Angst, sie würde uns im Weg sein, jeder
wollte auswandern, hat sie gesagt, meine Mutter würde vielleicht nicht auswandern
ohne sie, sie würde für uns eine Komplikation bedeuten, also sie wollte uns nicht im
Weg sein, also das sie würde für uns eine Komplikation bedeuten, also sie wollte uns
nicht im Weg sein, also das war hier. Wenn man heute daran denkt, hat sie sich viel
erspart, ja. Sie hätte, sie hätte das nicht überlebt, sie hätte noch Schreckliches
mitgemacht, also damals war es für uns eine Katastrophe, aber wenn man heute daran
denkt, ist es ihr eigentlich gelungen, sich vieles zu ersparen. No, also wir haben noch
weiter hier gelebt, recht und schlecht, und dann hat mein Vater Tuberkulose bekommen.
Hatte eine Grippe, eine schwere Grippe, und dann wurde festgestellt, daß er in der
Jugend vielleicht einmal schon Tuberkulose hatte, das hat sich wieder geöffnet, also er
mußte ins Krankenhaus, und er ist dort geblieben bis zum Jahre 42. Und wir, wie die
ersten Transporte gegangen sind, die ersten fünf Transporte sind nach Lodz gegangen,
nach Polen, aber dann wurde das Ghetto in Theresienstadt gebaut, und wir waren, die
Mutti und ich, in einem der ersten Transporte, wir waren die ersten Bewohner in
Theresienstadt. Der Onkel hat sich mit uns freiwillig gemeldet, weil er wollte nicht, daß
zwei Frauen allein gehen, er hat uns sowieso nicht helfen können. Wir waren dort, am
Anfang waren wir in Kasernen mehr oder weniger eingesperrt, wir konnten nicht aus
den Kasernen heraus, es wurde erst später das Ghetto geöffnet, aber die ersten Monate...
Drei Monate nach unserer Ankunft war er in einem der ersten Polentransporte und ist
nach Polen gekommen. Wir haben uns von ihm nicht einmal verabschiedet. Helena: Der
Onkel? Eva: Der Onkel, ja. Die Mutti und ich sind in Theresienstadt geblieben, also im
Sommer wurde das Ghetto geöffnet, und ich hatte dort einige Bekannte schon unter
jungen Leuten, die haben mir gesagt, ob ich nicht in der Landwirtschaft arbeiten
162
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
möchte. Das war damals eigentlich das Beste, was man in Theresienstadt machen
konnte. Man war nicht mehr so eingesperrt, man hat sich nicht so abgeschlossen
gefühlt, und das war angenehm. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, etwas Gemüse
zu stehlen, und so haben wir davon gelebt, und ich habe auch die Eltern, wie dann der
Vater gekommen ist, ihnen Gemüse, ihnen etwas geben können. Und dann sind auch die
Mutter von meinem Verlobten und die Schwester und die Kinder alle nach und nach
nach Theresienstadt gekommen, es ist uns gelungen, mit einigem Gemüse und so, daß
wir zusammen leben konnten, da muß man jemandem immer etwas geben, und dann
konnten wir... In der Kaserne hatten wir die Betten über- und untereinander, das war,
das war, dann haben wir so ein bißchen wieder gelebt wie eine Familie. Wir hatten
Hunger selbstverständlich, das hatte dort jeder. Aber, irgendwie war man jung und man
hat geglaubt, irgendwie wird man das überleben. Damals hat man von Polentransporten
keine Ahnung, wohin die gehen und wie die Leute dort leben, das wußten wir nicht.
Aber, man war so optimistisch, hat irgendwie von Tag zu Tag gelebt. Helena: Wann
haben Sie angefangen mit dem Tagebuch? Eva: Mit dem Tagebuch? Ja, da hab ich
schon damals vom ersten Tag, da waren wir noch im Messepalast, bevor wir nach
Theresienstadt abtransportiert wurden, hab ich angefangen zu schreiben. Ich mußte
diese Erlebnisse jemandem anvertrauen. Ich hatte niemanden. Mit meiner Mutter waren
wir sehr, sehr gut, aber es gab Sachen die ich auch ihr nicht erzählen wollte. Also mein
Tagebuch war der. beste Freund, mit dem ich, dem ich alles mitteilen konnte. Ja, dann,
im Sommer 42, wie Lidice damals verbrannt wurde und die Leute wurden getötet, sind
die Tiere zu uns gekommen aus Lidice, also, sie haben mich dann gerufen, ob ich die
Ziege und Schafe übernehmen möchte. Das war ein guter Job, also haben wir uns
damals, eine kleine Gruppe von jungen Leuten und von jungen Mädchen, um die Ziegen
und Schafe gekümmert, sind mit ihnen außerhalb von Theresienstadt gegangen, das war
auch ein Privileg. Und einmal wie ich dort die Schafe gehütet habe, hat von weitem ein
Mann in Eisenbahnunifonn nur gewinkt, und hat mir so gezeigt, er legt ein Päckchen für
mich dort unter einen Baum oder Strauch. No, er konnte mit mir nicht sprechen, das war
streng verboten, also, wie er weggegangen ist, habe ich mir dann das Päckchen geholt,
da war ein Stück Brot mit Fett und ein Stück Salami und eine Zwiebel dort, das war
damals ein, ein Vermögen, wir waren doch hungrig ständig, also ich hab mir das in den
Brotsack gegeben und wollte das mitbringen ins Ghetto. Unterwegs haben mir die
Gendarmen, damals, es war noch nicht üblich, später war das dann ganz normal, gesagt,
was haben Sie da in dem Brotsack? Woher haben Sie das. Das war ja klar, daß ich das
nicht aus Theresienstadt hatte, sondern daß mir das jemand gegeben hatte. Also ich hab,
selbstverständlich war es auch für mich weitaus besser, nicht die Wahrheit zu sagen. Ja,
ein Päckchen Zigaretten war noch drin, das war ganz verboten. Dafür sind Leute nach
Polen geschickt worden zur Strafe, wurden eingesperrt zur Strafe, also konnte ich auf
keinen Fall sagen, ich wußte auch gar nicht, wer mir das gegeben hat, also habe ich
gesagt, ja, das habe ich vom Transport, da sind ständig Transporte gekommen, jemand
hat mir das gegeben. Und unsere Jungen, die konnten, denen hat der Chef von der
Landwirtschaft, das war ein Deutscher, der hat ihnen damals mehr oder weniger
offiziell bewilligt, sie konnten sich auf einigen Beeten dort etwas pflanzen. Da hab ich
gesagt, die Zwiebel hab ich von den Jungen bekommen. Das war ein großer Fehler, weil
der Deutsche von der Landwirtschaft das dann geleugnet hat, und der Junge ist nach
Polen gegangen. Wegen einer Zwiebel, das war unglaublich, das war für mich eine
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
163
Tragödie. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, also, ich war damals eingesperrt,
war in einer Einzelzelle, einen Monat haben sie mich dort gelassen wegen dem Brot, die
Zigaretten hab ich unterwegs, wie mich der Gendarm geführt hat, die hab ich zum
Glück weggeworfen. Die hab ich verloren, also, das wäre ja schlimm, da war ich gleich
nach Polen transportiert worden. Aber, so hatte ich eigentlich nur das Brot und die
Zwiebel, das war alles, trotzdem war ich eingesperrt und sollte nach Polen gehen. Der
Junge, der hatte damals eigentlich keine Ahnung davon, war ja nicht von ihm, die
Zwiebel, aber er wurde nach Polen geschickt. Mein Vater hatte damals, der war schon
in Theresienstadt, das war im Herbst 42, die größte österreichische Auszeichnung vom
ersten Weltkrieg, und die waren damals geschützt, sogenannt geschützt, ja, vor
Polentransporten, also der ist zu dem deutschen Kommandanten gegangen und er hat
ihm gesagt, er hat diese goldene Medaille, und ich bin seine eigene Tochter, hat
geweint, und der hat gesagt, also, sie muß nicht nach Polen. Ich war damals gar nicht
glücklich, ich wäre vielleicht lieber nach Polen gegangen. Das war so schreckliche Zeit,
diese Erlebnisse, und damals ist ein Transport nach dem anderen gegangen, meist alte
Leute, ich glaube, von diesen ist niemand zurückgekommen. Der Junge, der damals
nach Polen geschickt wurde, ist auch nicht wiedergekommen. Das ist auch so ein
Erlebnis, das eigentlich, das ich nie ganz, ganz (sucht nach Worten) vergessen hab, und
damit kann ich mich nie mehr abfinden, also das war dieses Erlebnis, dann wurde ich
entlassen, habe wieder in der Landwirtschaft gearbeitet. Und dieser Mann in der
Eisenbahnunifonn war mir damals schrecklich dankbar, daß ich ihn nicht verraten habe.
Also, ich hatte keine Möglichkeit, ihn zu verraten, no, und hat mich dann sehr
unterstützt, hat mir dann regelmäßig Päckchen geschickt durch, über Leute, nicht
persönlich, dann, viel später, hab ich ihn auch persönlich kennengelernt. Das war ein
seltsamer Mensch. Er hat vielen Leuten ungemein geholfen, ganz, ohne jemals etwas
dafür zu bekommen. Aber gleichzeitig hatte er Leute, er war, er hat an der Bahnstation
gearbeitet und hat natürlich auch Verbindungen mit Juden gehabt, die dort gearbeitet
haben, und hat so nach und nach erfahren, wie eigentlich die Situation aussieht, und ist
dann in so eine Gruppe von Schmugglern gekommen, die damals viel geschmuggelt
haben, Zigaretten und so. Leute waren bereit, für Zigaretten alles zu geben, das war für
sie mehr als Brot und so. Zigaretten waren schrecklich verboten. Und Zigaretten in
Theresienstadt zu bekommen, das war ein Vermögen, ja und (räuspert sich) so, dieser
Mann hat Zigaretten in großen Mengen gekauft, hat sie dann geschmuggelt, hat dafür
Geld bekommen, und für das Geld hat er wieder Lebensmittel eingekauft, und so war
das so ein, halb hat er viele Leute unterstützt, mich zum Beispiel vollkommen, ohne
jemals was davon zu bekommen, aber er mußte sich das Geld irgendwie besorgen, hat
auch Schweine gekauft, schwarz, auf dem Schwarzmarkt, hat das Fleisch und so
eingekocht und nach Theresienstadt geschickt, das waren damals Sachen, die niemand
dort hatte, also ich hatte jeden Monat von ihm ein Päckchen bekommen, das war für uns
wunderbar, mein Vater war doch tuberkulosekrank, und der brauchte auch, etwas zum
Essen, also, ich war glücklich, daß ich die Möglichkeit hatte, ihm irgendwie zu helfen.
Aber das wußte ja auch niemand, auch meine Mutter, mehr oder weniger, wußte davon
nichts. Ich wollte nicht, daß jemand, das wußte nur mein Tagebuch. Das konnte ich
niemandem anvertrauen. No, das war so mehr oder weniger alles, das Leben in
Theresienstadt ist in dem Tagebuch für jeden Tag, was geschehen ist, auch manchmal
ist nichts geschehen. Also, das Leben hat sich so irgendwie normalisiert. Das heißt, das
164
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
war auch so typisch, ja, wir lebten und wir haben uns schon so daran gewöhnt an das
Leben, wir konnten uns das schon langsam nicht mehr anders vorstellen. Man hat hier
und da auch gelacht, und sich unterhalten, man war ja jung. Na und dann, also, gegen
Ende des Krieges, im Herbst 44, im Oktober 44, sind meine Eltern auch, alle die
sogenannten Geschützten und die Invaliden und der Ältestenrat, alle wurden nach Polen
geschickt. Das Ghetto wurde eigentlich mehr oder weniger liquidiert. Dort sind nur
ganz wenige Leute geblieben. Also ich wollte unbedingt mit meinen Eltern auch gehen,
ich bin damals zu dem Kommandanten gesagt, ich will mit meinen Eltern gehn, man
hatte so den Eindruck, daß ich ihnen helfen kann. Ich wußte nicht, daß ich ihnen nicht
helfen konnte. Der hat es abgelehnt. Der hat es abgelehnt, nein kommt nicht in Frage.
Damit hat er mir eigentlich das Leben gerettet. Aber ich wußte das nicht. Ich habe
immer noch die Hoffnung gehabt, ich werde die Eltern wieder nach dem Krieg sehen.
Daß sie damals gleich ins, in die Gaskammern geschickt wurden, das, davon hab ich
keine Ahnung gehabt. Also, ich war damals todunglücklich, bin allein in Theresienstadt
geblieben, alle meine Freunde, alle sind weggegangen, ich war weiter in der
Landwirtschaft. Die haben behauptet, daß sie mich dort brauchen, also habe ich
gearbeitet, ohne überhaupt Lust zum Weiterleben. No, und dann hat sich der Krieg dem
Ende genähert, und da sind langsam aus den verschiedenen Konzentrationslagern Leute
auf diesen Todesmärschen wieder einige nach Theresienstadt zurückgekommen in
schrecklichem Zustand, verlaust, mit Flecktyphus, also Leute, die wir gekannt haben.
Das waren die ersten Nachrichten aus Polen, aus Auschwitz, die sind, tagelang waren
sie unterwegs, von, ich weiß nicht, hundert Leuten haben es ganze zehn Leute vielleicht
überlebt. Und wie wir diese... Das waren Leute, die wir gekannt haben aus
Theresienstadt, die waren abgemagert, ganz Haut und Knochen, alle verlaust und alle
krank, mit hohem Fieber, also haben wir uns alle freiwillig gemeldet, die wir noch dort
waren, wir wollen sie pflegen, vor der Arbeit sind wir hingegangen ins Krankenhaus,
haben sie gewaschen, gefüttert, und selbstverständlich uns angesteckt, ja, also, dann
war, da war schon fast Ende des Krieges, da ist einmal dieser Eisenbahnarbeiter
gekommen, hat gesagt, ich nehme dich mit zu uns, jetzt ist es hier gefährlich in
Theresienstadt, sie haben, damals waren verschiedene Gerüchte, daß Theresienstadt
vergast werden soll, hat mich auf sein Rad gesetzt und hat mich zu ihnen, damals war
das schon mehr oder weniger offen, das war schon im Mai, gegen Ende des Krieges, da
war die Grenze schon nicht mehr so abgeschlossen. Also hat mich in seine Familie
gebracht, er hatte drei kleine Kinder und eine Frau. Also, mir war das damals ganz egal,
aber ich war da die erste Nacht und habe hohes Fieber bekommen, ich habe geglaubt,
ich werde nicht mehr den Morgen überleben, und mir war schrecklich schlecht, also ist
mir eingefallen, das wird wahrscheinlich der Flecktyphus sein, dann am nächsten
Morgen hab ich gesagt, du mußt mich wieder nach Theresienstadt bringen, dort sind
Ärzte, die werden sich um mich kümmern, also hat er mich wieder aufs Rad gesetzt, hat
mich wieder nach Theresienstadt zurückgebracht, und dort bin ich noch im
Krankenhaus sechs Wochen gelegen in hohem Fieber, ich kann mich eigentlich an
nichts mehr erinnern. Meine Sachen, weiß ich nicht, ich glaube, meine Koffer, die ich
gehabt hatte, sind gestohlen worden, und wo ich mein Tagebuch damals aufbewahrt
hatte, ich hatte vielleicht eine Tasche im Krankenhaus, das weiß ich nicht. Wie ich das
damals überlebt habe, das weiß ich nicht, ich wußte mehr oder weniger nichts, was mit
mir geschehen ist, also nach sechs Wochen wurde ich entlassen aus dem Krankenhaus,
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
165
jetzt wußte ich nicht wohin ich gehen soll, ich hoffte, daß ich meine Eltern in Prag
wieder treffen werde, aber ich wußte nicht wohin. Da war eine alte Frau, um die ich
mich damals die letzte Zeit gekümmert habe, wie meine Eltern weggegangen sind, die
hat sich auch etwas um mich gekümmert im Krankenhaus, die hatte vier Kinder, die
sind alle nach, in die Konzentrationslager, ein Sohn ist zurückgekommen, ist nach Prag
gekommen. Hat ihr geschrieben, ich komme nach Prag, wir sind unter der und der
Adresse, wir sind einige Freunde von uns hier, also komme nach Prag so bald wie
möglich, also hat sie mich gepackt, und wir sind zusammen nach Prag gekommen in
diese Wohnung hier, das war in der Rybná. Aber da ist dieser, Ebzen Kellner hat er
geheißen, der ist damals mit seinem Freund, nach schrecklichen, auch nach diesem
Todesmarsch, sind sie nach Prag zurückgekommen, der hatte hier ein Haus in der
Rybná, die Wohnung, wo er vor dem Krieg gewohnt hat, hat er wieder
zurückbekommen, dort hat, das war eine hübsche Dreizimmerwohnung, und wer aus
dem Konzentrationslager gekommen ist und hat keine Wohnung gehabt, der hat sich
dort einquartiert, also dort waren ständig ungefähr fünfzehn bis zwanzig Leute in dieser
Dreizimmerwohnung, aber uns war es egal, wir haben dort irgendwie gewohnt, wir
hatten kein Geld, ich hatte nur das, was ich an mir hatte, Schuhe nicht. Wir haben auf
der Kultusgemeinde jeden Tag etwas zum Mittagessen bekommen, dann haben wir, ich
kann mich gar nicht erinnern, ich glaub, etwas Geld haben wir auch bekommen, weil
wir mußten, wir haben damals solche Karten bekommen, wo man sich Lebensmittel
dafür kaufen kann, also etwas, und dann haben wir auch diese Karten für Schuhe und
Kleidung und etwas bekommen, aber etwas Geld mußten wir haben, ich weiß nicht,
aber wenig, es war wenig, wir hatten keine Wohnung, wir haben alle in dieser einen
Wohnung gelebt. Und ich habe jetzt darüber nachgedacht, vor dem Krieg, mein
Verlobter hatte hier arische Verwandte, ich konnte mich nicht mehr an den Namen
erinnern, das war für mich alles schon wieder vergessen, das war... Und dann habe ich,
bin eine Woche hier herumgegangen und hab gesagt, wie haben die geheißen, also wir
haben geglaubt, dort vielleicht bei diesen Verwandten werden wir uns wieder treffen.
Die sind hier den ganzen Krieg geblieben. Dann hab ich das Telefonbuch genommen
und hab von A gesucht, ob ich mich wieder an den Namen erinnere, habe mich dann
erinnert, sie heißen Šindelář, haben sie geheißen, also bevor ich bis zu š gekommen bin,
hat lange Zeit gedauert (lacht), dann hab ich mich erinnert, und habe eben sie
angerufen, und sie waren so lieb und waren glücklich, daß sie von mir hörten, haben mir
gesagt, ja, der Richard war schon hier, er war, er ist aus England mit der tschechischen
Armee gekommen, war in Prag, hat die ganze Familie gesucht, hat niemanden
gefunden, und hat auch dich gesucht, hat nach Theresienstadt geschrieben, dort haben
sie ihm geantwortet, die ganze Familie ist nach Polen gegangen, auch inklusive mir,
also, die hatten keine Evidenz, und die waren so glücklich und haben mir gleich seine
Adresse gegeben. Er war damals noch im Militär, die konnten hier nicht bleiben, die
mußten nach Westen in den Böhmerwald er war dort mit seiner Truppe im Böhmerwald
also ich habe ihm gleich geschrieben an diese Adresse. Aber sehr vorsichtig, weil ich
wußte nicht, vielleicht ist er schon verheiratet, er war ja viel älter als ich, und nach
sechseinhalb Jahren, da kann verschiedenes passiert sein, konnte er nicht mehr damit
rechnen, daß wir noch am Leben sind Also, den nächsten Tag war er in Prag. Wir haben
uns getroffen nach über sechs Jahren, wir haben uns nicht mehr gekannt. Wir waren
vollkommen fremd. Also mußten, er hatte drei Tage Urlaub, in diesen drei Tagen sind
166
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
wir ständig herumgegangen in Prag, weil in der Wohnung dort war nicht möglich, dort
konnte man nicht zusammen sprechen. Die war ja so voll. Also sind wir drei Tage
ständig spazierengegangen und haben wieder uns langsam kennengelernt und haben
gesagt, also wir werden wieder ein neues Leben beginnen. Und das war eigentlich das
Happy End. Drei Wochen nach seiner Demobilisierung, das war im September, haben
wir geheiratet, dann haben wir eine Wohnung gesucht, dann haben wir diese Wohnung
hier genommen. Das war damals ziemlich schwer, damals, alles war schon besetzt. Ja,
alle Wohnungen, die die Deutschen verlassen haben, die waren schon inzwischen von
Leuten, die gekommen sind, oder von Leuten, die hier gelebt haben, auch schon alle
besetzt. Er hatte damals ziemliche Schwierigkeiten, überhaupt eine Wohnung noch zu
bekommen. Aber diese Wohnung war noch besetzt mit Österreichern, die haben hier
gewohnt, und die sind dann nach Österreich zurückgegangen, und dann war die
Wohnung leer. Also dann haben wir diese Wohnung bekommen, haben wir dann eine
Tochter bekommen nach einem Jahr, und nach vier Jahren einen Sohn, und haben
wieder ganz angefangen, mehr oder weniger normal zu leben, es war ja auch nicht
einfach, er hatte ziemliche Handicaps unter den Kommunisten, er war aus England, er
war kein, sein Vater war Advokat, das war auch kein guter Ursprung, also er war kein,
kein..., keine Arbeiterklasse, aber er hatte immer das Glück, irgendwo eine Stellung zu
bekommen, dann war er, zwei Jahre war er in Kladno, mußte er manuell arbeiten, weil
er keine andere Arbeit finden konnte, mit zwei kleinen Kindern war das auch ziemlich
schwierig, aber irgendwie haben wir das überwältigt. Helena: Und Sie haben auch
gearbeitet? Eva: No, wie die Kinder klein waren, da konnte ich nicht arbeiten, damals
waren noch keine Kindergärten und so, es war sehr schwierig, und er war ja, er hatte
immer, immer behauptet, also ich, ich bin doch Rechtsanwalt, ich muß doch imstande
sein, die Familie zu ernähren, also manchmal ist es ihm gelungen, manchmal besser
manchmal weniger gut, aber es ist immer irgendwie, und wie dann der Junge in die erste
Klasse gegangen ist, dann bin ich auch arbeiten gegangen. (Schweigepause) No, und er
hat noch das Jahr 89 erlebt, also damals war er beinahe 80, ja, 79 Jahre, er ist im Jahre
1910 geboren, also damals war er noch glücklich, daß wir wieder normale Zeiten
erleben werden, und dann hat er noch vier Jahre gelebt, dann ist er plötzlich gestorben.
Inzwischen die Tochter, im Jahr 68, hat auch studiert, wollte auch Recht studieren, im
letzten Jahr war sie im Rechtsstudium, dann war die Besetzung durch die Russen, da
war damals so eine Panik, und wir wußten nicht. Sie hat sich entschlossen nach
Amerika zu gehen, wir hatten dort Verwandte, die haben ihr geholfen. Der Sohn hat
Nuklear-Physik studiert, hat es beendet, hat dann geheiratet, seine Frau ist Ärztin, die
hat Primariat auf der Bulovka, also es geht ihnen recht gut. Meiner Tochter geht es auch
gut, sie hat Psychologie studiert, mit dem Rechtsstudium konnte sie nichts anfangen, in
Amerika ist das sehr schwierig, erstens hat sie die Sprache nicht so gekonnt, also hat sie
dann gearbeitet, und wie sie dann imstande war, dann hat sie noch versucht, wieder zu
studieren, aber hat sich dann auf Psychologie spezialisiert. No, und jetzt lebe ich
ziemlich ruhig hier, hab Enkelkinder, ich glaube, mein Mann hätte Freude, wenn er uns
hier sehen würde. Helena: Kann ich Sie zur Kindheit fragen, also, es war eine deutsche
Familie? Eva: Ja, ja, wir haben in diesem deutschen Gebiet gelebt, ich bin eigentlich,
das war eigentlich meine Muttersprache. Helena: Und wann haben Sie tschechisch...?
Eva: Tschechisch habe ich erst während des Krieges, oder ab, ja 38, mein Verlobter hat
mich damals, wir haben ziemlich, man hat sich gar nicht vorstellen können, daß es
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
167
einmal anders sein wird, wir waren, wir haben, zwei oder drei Generationen in diesem
deutschen Gebiet gelebt, meine Großmutter wurde dort geb..., beide meine Großmütter
wurden dort geboren, also von meinem Vater die Mutter, die hat in einem kleinen Ort
bei Komotau gewohnt, wir haben in Saatz gelebt, Zatec ist das in Tschechisch, und ich
habe vergeblich versucht, festzustellen, was mit meiner anderen Großmutter geschehen
ist, die ist verschwunden, die war in keinem Transport, die ist dort geblieben, die war
schon ziemlich alt, ist in diesem kleinen Ort geblieben, ob sie sie erschlagen haben, das
weiß ich n..., mit der Schwester von meinem Vater, die zwei Frauen, die sind in diesem
Ort geblieben, ich habe, ich war in Washington im Holocaust Museum, dort haben sie
eine Evidenz von allen, ich konnte nicht feststellen, was mit ihnen passiert ist. Im
Transport waren sie nicht, die mußten, während des Krieges, bevor wir weggegangen
sind, haben sie noch gelebt. Also ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Das war
nicht festzustellen. Helena: Aber in der Kindheit haben Sie keine Erfahrung mit
Antisemitismus gemacht, also erst dann...? Eva: Also bis zu... Helena: Bis achtund...?
Eva: sechzehn Jahren, bis ich sechzehn Jahre war, hatte ich, nein, hatte ich eine Menge
Freunde, ich habe da auch sind dort Fotographien von Freunden mit denen ich von klein
auf befreundet war. Wir sind Ski gefahren und in der Tanzstunde waren wir, also alles
war ganz normal, erst im Jahr 37 waren eigentlich die ersten, nach der Besetzung von
Österreich, waren die ersten antisemitischen Begegnungen, und es hat die Leute
geändert, von Tag zu Tag. Helena: Und zu Zeiten des Kommunismus, hatten Sie da
persönliche Erfahrungen noch einmal? Eva: Daß Antisemitismus hier war, das wußten
wir, der ist ja überall, der ist in Amerika und überall, aber persönlich hat mich niemand,
man hat es nicht gezeigt, vielleicht haben die Leute hinter unserem Rücken darüber
gesprochen, aber ich hatte eine kleine Stellung im Außenhandel, also niemand hat mich
um die Stelle beneidet, also ich war nie, nie irgendwie politisch tätig, wir waren nie in
der kommunistischen Partei, wir hatten keine Vorteile, nur Nachteile, aber persönlich
haben wir nichts gespürt, vielleicht haben wir, mein Mann auch als Jude, bestimmt hatte
er mehr Schwierigkeiten als die anderen Leute, aber nicht, nichts Schreckliches. Das
haben halt andere auch mitgemacht. Helena: Ach so, ja, und dann wollte ich noch
fragen, inwieweit war Ihre Familie religiös, oder gar nicht mehr? Eva: Meine
Großmutter war noch religiös, ja, da hab ich jetzt grade daran gedacht, wie wir immer
bei ihr an Jom Kippur waren, da war die ganze Familie, und sie hat gefastet, mein Onkel
hat auch gefastet, meine Mutter hat nicht gefastet, weil die hat Orgel im Tempel
gespielt, also die hat gearbeitet, und wir sind sie immer im Tempel besuchen
gekommen, als sie da Orgel gespielt hat, das war ziemlich interessant. Bei uns hat man
viel musiziert, mein Vater hat auch, er war Professor von Latein und Griechisch und
dann auch, auch Musik hat er unterrichtet auf dem Gymnasium. Ich selbst habe auch
angefangen, bei meiner Mutter Klavier zu lernen, aber nicht mit großem Erfolg. Bei der
Mutter soll man nicht lernen. Helena: Und jetzt? Ist vielleicht irgendwer in Ihrer
Familie wieder zur Religion zurückgekehrt? Eva: Ich war nie aus der Religion
ausgetreten, war ständig Jüdin. Helena: Aber nicht praktiziert, oder gehen Sie in die
Synagoge? Eva: Selten, selten, und auch die Kinder haben wir nicht als Juden erzogen,
wir wollten, nach all diesen Erfahrungen, daß sie ganz normal aufwachsen ohne
irgendwelche Hemmungen und ohne irgend etwas zu spüren, daß sie etwas anderes
sind, weil wir das doch so zu spüren bekommen haben. Also, das ist, mein Leben.
Helena: Gut, vielen Dank. Eva: Bin gesund, freue mich mit den Enkelkindern. Sagen
168
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
wir, ein verhältnismäßig gutes Alter. Helena: Ich habe hier noch irgendwo... Fragen im
allgemeinen notiert, jetzt schaue ich noch, ob ich da... Eva: Etwas möchten Sie noch?
Helena: Ob mir noch irgendwas einfällt. Ach so, ja wie war zu Deutschland, zu
Deutschen, hat sich da Ihre.. Unterbrechung, Eva stellt mir ihre soeben eingetroffene
Bekannte vor. Helena: Sie sagten, Sie haben dann angefangen, Tschechisch zu lernen
im Krieg, oder zu sprechen, Eva: No, noch vom Jahr 38, ja, damals wie ich mit meinem
Mann, haben wir uns mehr und mehr befreundet. Helena: Ihr Mann ist Tscheche? Eva:
Ja, ja er ist in Prag geboren und die Familie und in tschechischen Schulen, also er hat
sich sehr bemüht nur tschechisch zu sprechen. Helena: Und zu Deutschland, haben Sie
da irgendwie dann, weiß ich nicht, einen anderen Bezug gehabt, nach dem Krieg, weil,
wollten Sie damit nichts mehr zutun haben? Eva: No, das hat eigentlich, ja, das ist uns
allen passiert, daß was deutsch war, uns schrecklich, äh, das war ein rotes Tuch. Das
war am Anfang. Aber ich kann nicht behaupten, daß ich das wirklich hasse. Ich könnte
jemanden hassen, der mir persönlich etwas gemacht hat, aber ich kann nicht eine Nation
hassen. Das ist einmal, die Nation existiert, die kann man nicht ausradieren, also, das
ist, das sind ja Leute, wie wir sind Ich möchte nicht gern jemanden hassen, der mir
nichts gemacht hat. Das war, darunter haben wir zu leiden gehabt, aber ich möchte nicht
dasselbe machen. Die Leute haben uns gehaßt, weil wir Juden waren, aber ich möchte
nicht dasselbe wieder auf die Deutschen übertragen. Helena: Und haben Sie jetzt
Entschädigung bekommen? Eva: Ja, etwas haben wir bekommen, (klingt erfreut) ja, wir
haben für jeden Monat, ich habe 47000 Kronen bekommen, das ist, das sind
zweieinhalbtausend Mark. Helena Aus dem, war das dieser Zukunftsfonds Eva: Ja, ja,
von den Deutschen, wir haben auch etwas von unserer Regierung bekommen. Helena:
Stimmt, ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube das, das war's dann. Eva: Das ist
alles? Helena: Ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Eva: Nichts zu danken, ja, also,
wenn Sie das irgendwie benützen können.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
169
Dokument 4: Jirka K.
Helena: Heute ist der 30. September 1998 und ich führe ein Gespräch mit Herrn K., und
ich würde Sie einfach bitten, zu beginnen, mir Ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Jirka
: Ja also, gerade 2 Tage vor meinem Geburtstag sind Sie auf mich zugekommen, ich
werde 77 am 2.Oktober, ich bin im Jahr 1921 geboren als Sohn eines... in Deutschland
heißt es Oberstudienrats am Prager Deutschen Gymnasium, das hieß in Prag nach
altösterreichischem Muster Mittelschulprofessor und meine Mutter war aus einer
wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie. Und die Eltern haben sich auf die Weise
kennengelernt, daß mein Vater Hauslehrer in dieser wohlhabenden Familie war, und sie
haben sich dann verliebt ineinander und haben 1920 geheiratet. Ich war der erste Sohn,
und vielleicht zur Charakteristik.. Kurzcharakteristik meiner Eltern und des Milieus, in
dem wir aufgewachsen waren, mein Vater kam aus einer Kleinstadt in Ostböhmen, wo
eine starke jüdische Gemeinde war. Seine Eltern waren streng jüdisch-religiös und die
Großmutter kam aus einer angesehenen Familie, der Großvater kam aus Südmähren aus
einer Rabbinerfamilie, war aber anscheinend kaufmännisch nicht sehr erfolgreich und
ist dann mit der Großmutter nach Ostböhmen mitgezogen, wo es tschechischsprachig
war. Der Großvater selbst, der Kohn hieß, also der Vater meines Vaters, der aus
Südmähren kam, der war nur deutschsprachig. Das war immer dieses Problem der
böhmischen und mährischen Juden, diese zweifache Identität, die, sagen wir, im
vorangehenden Jahrhunderten doch sehr viel stärker deutsch war und eben erst in
diesem Jahrhundert allmählich sich das Judentum mehr zu der tschechischen
Nationalität bekannt hat und auch mehr tschechisch kommuniziert hat. Meine
Großeltern väterlicherseits waren schon zweisprachig, wie gesagt, sozial eben zu den
Mittelschichten gehörend, aber doch etwas weniger erfolgreich und dadurch hatten sie
Schwierigkeiten meinem Vater, ihrem einzigen Sohn, die Schwester ist früh gestorben,
als Kind, sein Studium zu finanzieren. Der Vater war wohl begabt, hat selber
verschiedene Nachhilfestunden geleistet und hatte früh angefangen, auch zu
publizieren. Er war ein fähiger, glaube ich, guter Germanist und Romanist, er hat sich
mit der Kulturgeschichte und Kunstgeschichte befaßt, hat auch übersetzt, und hat es
gebracht zu einem angesehenen Intellektuellen. Er hat verkehrt mit Leuten um das
Prager Tagblatt herum, ist dort vielleicht auch irgendwann auf Franz Kafka gestoßen,
hat Max Brod gut gekannt und eine Reihe andere deutschsprachige Autoren. Sehr enger
Freund war der Lyriker und Übersetzer Rudolf Fuchs, andere waren Otto Pick, auch ein
deutschsprachiger Publizist in Prag, er hat Ludwig Winter gekannt und dann vor allem
auch die deutsche Emigration später in den 30-er Jahren. Also mein Vater war jemand,
der intellektuell sehr vielseitig, sehr anregend war, sehr beliebt bei Schülern und
Studenten, die ihn immer besuchten. Er ist auch so bißchen mein Idol gewesen, so bis
zu meinem 18. Lebensjahr, dann wird man etwas kritischer, sieht die Dinge ein bißchen
differenzierter, aber mein Vater hat eigentlich immer den größten Einfluß gehabt, als
ich aufwuchs. Jetzt noch zu meiner Mutter. Deren Eltern waren wieder anders, diese
wohlhabende Familie Lind in Prag, hat wohl auch angefangen unter nicht gerade
einfachen Verhältnissen. Der Großvater kam aus den Sudeten, hat wohl eine Lehre, eine
kaufmännische Lehre in Wien erst machen müssen, er war eines von vielen Kindern, ich
glaube, das 12. oder 13. Kind einer eben sudetendeutsch-jüdischen Familie und der
Großvater hat es erst in Laufe der 20er Jahre zu einem Vermögen gebracht. Er wurde
170
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
dann der größte sogenannte Kunstfabrikant, das ist etwas übertrieben, es ging um
Kunstgewerbe, also der größte Hersteller von Kunstblumen in der
Tschechoslowakischen Republik, später dann und hat dann ein Haus am Wenzelsplatz
gebaut, eben aus den Ersparnissen. Die Großmutter war aus einer armen Prager
jüdischen Familie, eher tschechischsprachig, also das war etwas Ähnliches bei beiden
Großeltern, immer die Großmutter eher tschechischsprachig, der Großvater
deutschsprachig... Helena: Aber hebräisch oder jiddisch wurde nirgends gesprochen?
Jirka : Nein, ich hörte einmal, daß vielleicht die Eltern oder eher noch die Großeltern
meiner Großeltern, vor allem väterlicherseits wohl, teilweise jiddisch sprachen. Und
auch das Deutsch meiner Großmutter, die immer tschechischsprachig war, war
durchsetzt mit so einzelnen jiddischen Ausdrücken, also so Ausdrücke, die allen
bekannt sind, wie etwa Chuzpe oder Mazl-tov für Glück oder... Helena: Reibach? Jirka :
Reibach, ja oder Bezieher für ein gutes Geschäft, solche Ausdrücke wurden von der
Großmutter immer gebraucht, auch von der anderen Großmutter, von der
mütterlicherseits. Und meine Mutter, die war ganz anderer Typ als mein Vater, eine in
Prag bekannte Schönheit als Mädchen, so hörte ich es, aber ich glaube, die Fotos, die
ich kenne aus ihrer Jugend, bezeugen das, sie war aber auch eben später sehr
umschwärmt, das hab ich sogar noch miterlebt, da hatte man sich dann scheiden lassen
wie ich 14 Jahre alt war, ich ging mit dem Väter, mein Bruder mit der Mutter und es
waren immer Männer, die sich um sie kümmerten und sich für sie interessierten, aber
sie war auch eine sehr tüchtige Geschäftsfrau. Sie war sehr praktisch eingestellt, sie
hatte dann einen deutschen Lebensgefährten, einen Nichtjuden, der in Prag als
Journalist und Schriftsteller tätig war, der nämlich zu ihr zog, nachdem sie ihn mal in
den Ferien in Italien kennengelernt hatte. Und sie war auch eine Frau, die also
intellektuell eigentlich auch sehr interessiert war. Das hat sicher auch die Ehe mit sich
gebracht mit meinem Vater. Aber von ihrem Naturell her war sie doch mehr
lebensbejahend, mein Vater war oft träumerisch, meine Mutter war praktisch, mein
Vater war depressiv, er hat dann in der Zeit, wo die Verfolgung kam und er sehr schnell
dann emigrieren konnte, sehr gelitten und zwar hat er sich dann... irgendwie
psychiatrisch kurieren lassen, also das lief bei ihm alles sehr schwierig immer. Nun gut.
Also ich war... vielleicht meine wichtigsten Jahre, die so mein ganzes späteres... meine
künftige Laufbahn auch vielleicht intellektuell und wissenschaftlich beeinflußt haben,
war die Zeit, wo ich mit meinem Vater zusammenlebte, von meinem 14. bis zu meinem
18. Lebensjahr. Das ist man ja besonders aufnahmefähig und das hat mich also geprägt.
Wir waren, wie gesagt, was das Jüdische betrifft, gerade zu dieser Zeit, sehr... nicht
antijüdisch, das wäre falsch verstanden, mein Vater blieb formell Mitglied der
Jüdischen Gemeinde, aber wir haben überhaupt nichts von jüdischen Riten, Feiertagen,
jüdischer Küche etc. bei uns praktiziert, das alles war uns fremd, wir hatten sowohl
jüdische... gut, das war in Prag so... das Judentum auch in diesen Kreisen...
untereinander waren sie bekannt, also da hat es genauso viele nichtjüdische Bekannte
und Freunde und mein Vater war bewußt... vielleicht in seiner Jugend war er ein
bißchen zionistisch geprägt, aber das muß nur eine kurze Zeit gewesen sein, er hat dann
so eine kosmopolitische, für sich eine eigene Ideologie geschaffen, die, mit heutigen
Worten umschrieben, so eine Art Vision einer multikulturellen Gesellschaft schon war
für die Zeit, das hat man damals nicht so genannt, aber das ist genau das, wie ich das
heute empfinde, wo es auch um die Diskussion heute geht. Das betraf die religiöse
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
171
Frage, das betraf die nationale Frage, Klassen, soweit überhaupt das in Frage kommt, da
war mein Vater also sehr aufgeschlossen, er war sehr aufgebracht, wenn irgendjemand
solche Vorurteile irgendwie äußerte. Und er hatte einen linken Tatsch, das war auch so
in den 30-er Jahren... war das eigentlich eine Sache, die irgendwie uns ganz natürlich
vorkam, ich glaube es hatte historische Wurzeln. Erstens ist... mein Vater, der aus eben
so einer... ja fast orthodoxen Familie kam, dieser Freiheitsdrang, dieser Drang nach
liberaler Offenheit hat ihn eben auch dazu geführt, daß er glaubte eben in seiner linken
bis hin Richtung marxistischen Ideologie, das zu finden, die Werte zu finden, die ihm
vorschwebten. Das waren eigentlich freiheitliche Werte. Das war eigentlich... das, wie
sich der Marxismus dann entwickelt hat in seiner institutionalisierten Form im
Ostblock, das war nicht das, was er meinte. Aber er glaubte eben in seiner
humanistisch-marxistischen Version seiner eigenen Auffassungen irgendwo eine
Heimat finden zu können. Er hatte auch viele Freunde, die ihm in diesen Richtungen
nahe standen, Egon Erwin Kisch war sogar mit uns weitläufig verwandt, aber er war mit
ihm auch befreundet, vor allem kurz nach dem Krieg. Und das waren also die Leute, die
sozusagen das Milieu auch unseres Hauses prägten, mein Vater hatte ständig Gäste,
nach der Scheidung wie ich 14 Jahre alt war und in folgenden drei vier Jahren, und
gleichzeitig war er am Gymnasium eben tätig als Lehrer und mit der Jugend hatte er
starken Kontakt, und wie gesagt, das war eine schöne Zeit. Und das hat mich eben auch
geprägt. Ich gehörte nie zu den Musterschülern, aber habe relativ gut und leicht die
Schule bis Septima, das war eine Klasse vor dem Abitur in Prag am Deutschen
Gymnasium absolviert und dann kam das Münchener Abkommen. Genau gestern vor 60
Jahren und das hatte einen Rieseneinfluß auf unser ganzes Dasein, auf alles, was dann
später kam. Das war nämlich der Anfang des Endes, und zwar habe ich mich über Nacht
entschieden, mit vielen Freunden und auch mit der Familie, das Gymnasium zu
wechseln, vom Deutschen ins Tschechische zu gehen. Im Deutschen Gymnasium
breitete sich nämlich schon auch der Nationalsozialismus aus, wir hatten das eigentlich
einige Monate vorher gar nicht gespürt, zumindest in unserer Klasse nicht und unter den
Lehrern, wo eben die Hälfte jüdische Lehrer waren, auch nicht. Hinzu kam also die
Kündigung meines Vaters kurz nach dem Münchener Abkommen, und zwar gab es eine
Art deutsche Autonomie im Sinne einer Dominanz den nationalsozialistischen,
sozusagen, Führern, Politikern im Dritten Reich von der Sudetendeutschen Partei
gegeben, also die hatten eine Dominanz ausgeübt, auch was die deutschprachigen
Bewohner der Tschechoslowakei betrifft , vor allem in Ämtern, setzten durch, daß
jüdische Lehrer, das betraf dann später auch Ärzte, Juristen etc., langsam ihre Ämter
und Berufe nicht mehr ausüben konnten. Mein Vater wurde zwangspensioniert, er war
damals, es war 38, 50 Jahre alt. Die Frage der Emigration begann sich zu stellen, aber es
war noch in dieser Zweiten Republik, dieser verkleinerten Tschechoslowakei ohne die
Sudetengebiete, die dem Dritten Reich zugesprochen wurden, irgendwie möglich
überleben zu können. Das waren die einigen Monate bis zum 15. März 39, wo eben die
deutschen Truppen einmaschierten und diese Lander Böhmen und Mähren zu sg.
Protektorat ausgerufen wurden unter Hitlers Herrschaft, das betraf uns dann ganz
massiv. Dann kamen sukzessive die antijüdischen Gesetze, wir übersiedelten zu meiner
Mutter, wir lebten mit meiner Mutter, das Geschäft wurde arisiert, das Vermögen
beschlagnahmt, das war also eine, ja scheibchenweise, Einengung unserer materiellen,
aber vor allem auch psychischen, sozialen Lage, mentalen Lage in dieser Situation in
172
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Prag. Ich kann jetzt nicht alle Einzelheiten nachvollziehen, das würde zu weit führen,
übrigens habe ich darüber auch etwas veröffentlicht in den Theresienstädter Studien,
über diese Zeit, die Jahre 1940/41. Und Ende 1941 wurde ich dann als erster unserer
Familie mit einem Transport junger Juden nach... zunächst ins Unbekannte, angeblich
in ein Arbeitslager deportiert, d.h. wir konnten noch frei in den Zug einsteigen, unter
dem "Schutz" tschechischer Gendarmen und unterwegs stellte sich heraus, wir fahren
nach Theresienstadt. Dort wurden wir dann in Kasernen eingewiesen und unsere
Aufgabe bestand darin, vorzubereiten das sogenannte Ghetto. Wir ahnten noch nicht,
was das alles bedeuten würde. Dann kam nach einigen... nach zwei drei Wochen die
Nachricht in die Kaserne, daß einige Mithaftlinge, wir waren erst nicht alle, weil wir
doch tagsüber jeder woanders arbeiteten, in der Stadt oder am Bahnhof oder auch
wurden verschiedene Güter... andere Dinge, die hingeschafft wurden, also wir erfuhren
da, daß einige Mithäftlinge erhängt wurden, und zwar deswegen, weil sie aus der Stadt,
entgegen dem Verbot, das uns gleich vom Anbeginn verkündet wurde, Nachrichten,
Briefe etc. an ihre Verwandten nach Prag, oder wo immer sie waren in der Republik...
im Protektorat, geschickt haben. Und das wiederholte sich dann, also die Atmosphäre
wurde ziemlich unerträglich, weil man spürte, man wird von der Umwelt zunehmend
abgekapselt, und wir wollten irgendwie ausbrechen. Ich habe meinen engsten Freund
dann kennengelernt, mit dem ich dann spätere Monate erlebte, und wir entschieden uns,
als die erste Möglichkeit sich bot, aus Theresienstadt irgendwie herauszukommen. Und
zwar die Gelegenheit war die, es wurde an uns die Frage..., an alle die Juden, die wir
dort waren und halbwegs gesund waren, daß Transporte in die Bergwerke nach Kladno,
das ist ein Gebiet, wo Steinkohle gefördert wird, organisiert werden und daß man da
versuchen kann, sich freiwillig zu melden. Das taten wir, und wir wurden dann auch
dahintransportiert, und dort durchlebte ich l 1/4 Jahre etwa als Bergarbeiter, darüber
gibt es auch in diesen Theresienstädter Studien eine ausführliche Beschreibung unserer
Arbeit, unsere Lebens-und Häftlings-, würde ich sagen, -bedingungen, die wir dort
hatten, die waren viel besser als in Theresienstadt und nach 1 1/4 Jahren wieder zurück
nach Theresienstadt. Mittlerweile... mein Vater war in England in der Emigration, das
gelang kurz vor Kriegsausbruch, ihm dazu zu verhelfen über Freunde, meine Mutter,
mit der ich vorher noch kurz gelebt hatte, übrigens, die wurde mittlerweile nach
Theresienstadt transportiert... (Pause). Nach unserer Rückkehr von Kladno nach
Theresienstadt, wir waren eine Gruppe von 50 jungen Bergarbeitern, gleichzeitig
Ghettoinsassen, hieß es damals, wir kamen zurück nach Theresienstadt und fanden
unsere Mutter vor, ich also fand meine Mutter mit dem Bruder vor und es gelang dann
meinen Freunden, weil da immer verschiedene Arbeitsgruppen gebildet wurden, mich
einzugliedern in eine Gruppe, deren Aufgabe darin bestand, alten und kranken Leuten
das Essen, also das doch sehr dürftige Essen, das dort in Kantinen hergestellt wurde,
zubringen in ihre Ubikationen, das waren damals Kasernen. Damals war Theresienstadt
schon frei von Nichtjuden sozusagen, von der nichtjüdischen Bevölkerung und wir
unterlagen diesem Ghettoregime, das ja schon vielfach beschrieben wurde, das besser
sicher war als Konzentrationslager etwa in Auschwitz oder andere Konzentrationslager,
aber der Unterschied war natürlich nicht so eindeutig für Leute, die älter und krank
waren. Wir, die noch relativ jung und auch eine Gruppe von sehr solidarisch
zusammenhaltenden sozusagen "Ersteinwohnern" waren, unterstützten einander. Das
war dann auch infolgedessen, daß es mir gelang durch diese Arbeit, eine Schwerarbeit Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
173
das Wegschleppen der Kessel voller Essen, daß ich aber keinen Hunger leiden mußte,
denn man konnte natürlich hinreichend... den letzten Proviant erhalten, der zwar nicht
qualitativ besonders gut war, aber wir hatten keinen Hunger. Helena: In.welchem Jahr
war das, als Sie nach Theresienstadt kamen? Jirka: Also ich kam erst nach
Theresienstadt mit dem Transport aus Prag am 24. November, vom November 41 bis
Mitte März 42 war ich in Theresienstadt, und Mitte März 42 sind wir dann einige
Arbeitsgruppen nach Kladno, wie ich sagte, meine Gruppe, das waren 50 Kumpel, da
waren wir Bergleute und in einem naheliegenden Ort in einem alten Wirtshaussaal aus
Pritschen sozusagen eine Häftlingsübikation irgendwie eingerichtet wurde. Dort waren
wir untergebracht und gingen natürlich zur Schichtarbeit..,, und wir waren auch in 3
Schichten untergliedert. Und wir wurden bewacht von tschechischen pensionierten
Gendarmen..., daß man irgendwie etwas beschaffen konnte, ihnen etwas zustecken
konnte... Geld... von der Familie... besser bestechen konnte als andere, und so lief es
halt und wir waren... arbeiteten vor allem untertags, aber auch auf der Oberfläche im
Bergwerg, relativ frei..., das war also psychisch... Und dann... dort waren wir l 1/4
Jahre, von Mitte März 42 bis etwa Juni 43 und dann zurück nach Theresienstadt und,
wie gesagt, die Arbeit, die eigentlich schwer war, war relativ gut zu ertragen, ich hatte
Kontakt mit Bruder und Mutter, mein Bruder war später dann mit mir untergebracht, die
Mutter war woanders, es gab keine Familienwohnungen, das war alles
zusammengepfercht auf engstem Raum. Das schlimme, für mich, also für die alten
Leute, besonders aus Deutschland, die kranken, war, daß halt sie unter Hunger litten
und sehr leicht infizierten wurden durch Krankheiten und einfach auch dahinstarben....
Für uns, die wir halbwegs gesund waren, keinen Hunger direkt hatten und auch
irgendwie kulturell versuchten, uns zu betätigen, es gab "Freizeitgestaltung", wo man
doch das Beste herausholte, was man herausholen konnte, bißchen Musik, bißchen
Theater; Diskussionen, also das alles ist in einer Art Selbstorganisation dort gelaufen,
vor allem unter tschechischen Juden, die, wie gesagt, dort länger schon untergebracht
waren und die da auch widerstandsfähiger waren. Das war eigentlich das Positive unter
den gegebenen Bedingungen, das Negative bestand darin, daß man nie wußte, ob man
nicht in einen Transport in Richtung Osten weiterbefördert würde. Wir wußten zwar,
zumindest ist mir nicht bekannt, daß es da Ausnahmen gab, wir alle, also die ich kannte,
wußten nicht, was passierte, wenn man irgendwo weitertransportiert wird, aber es gab
eine sehr weitverbreitete Psychose, daß das nichts Gutes ist, man hörte das von den
anderen nicht mehr, man hatte keinen Kontakt, es tauchten verschiedene Gerüchte auf.
Es ist wohl so gewesen, daß im Laufe des Jahres 44 schon etliche Leute wußten, daß die
Leute dort irgendwie... liquidiert werden, daß sie das nicht überleben konnten. Aber
Gaskammern und Einzelheiten wie... wußte man nicht. Also wir, mein Bruder und ich,
blieben in Theresienstadt bis zum Herbst 44 und meine Mutter überlebte sogar da,
meine Mutter war Vorarbeiterin in einer Werkstatt, die hieß Glimmerspalterei, Glimmer
ist ein Material, das eben gespalten wird und das waren wohl dann Halbfabrikate, die
für die Flugzeuge irgendwie als Isolationsmaterial dienten und das schützte meine
Mutter vor einem Weitertransport. Und wir also wurden weitertransportiert, mein
Bruder früher als ich, das war im September und ich im Oktober, Ende Oktober 44, mit
dem letzten Transport nach Auschwitz, darüber gibt es hinreichend Zeugenaussagen... ,
das Einzige, was ich sagen will, wir waren der letzte Transport aus Theresienstadt. Die
Selektion, die bedeutete, daß man entweder vergast wird oder auf der anderen Seite, daß
174
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
man zum Arbeitseinsatz kommt, das war die letzte Selektion, die es gab wohl in
Auschwitz, das war Ende Oktober, am 30. , 31. Oktober 44, denn es war schon
irgendwo zu spüren, daß der Krieg irgendwie eine Wende genommen hat zu Ungunsten
der Deutschen, das war indirekt in der Politik gegenüber den Haftungen zu spüren. Wir
haben beide überlebt, mein Bruder und ich, wir sind also bei dieser Selektion nach der
Ankunft unter diejenigen geraten, die als Arbeitskommando weiter eingesetzt wurden
und dieses ist ins innere Deutschland gekommen, als Außenkommando eines der
größten Konzentrationslager, Sachsenhausen wohl war das. Ich bin noch sechs Wochen
in Auschwitz-Birkenau geblieben und habe bei der Verladung verschiedener
Materialien an der "Bahnstation" gearbeitet und bin dann in ein Außenkommando in
Lastwagen mit anderen abtransportiert worden nach Gleiwitz, Lager Gleiwitz. Unsere
Aufgabe war eigentlich schon Schützengräben vorzubereiten, als..., wie wir dort
indirekt erfuhren von polnischen Vorarbeitern, als Verteidigungslinie gegenüber der
vorrückenden sowjetischen Armee. So kam ich am 24. Dezember, also am Heiligabend
nach Gleiwitz. Dort waren katastrophale Bedingungen, vor allem was Nahrung betrifft,
aber auch Unterbringung, wir sahen, daß die Leute, die schon länger dort waren, die
Häftlinge, sogenannte Muselmänner waren, die also nicht mehr lange überleben
können. Das war also sehr schlimm, das war ein Wettlauf um die Zeit, wie wird es
weiter laufen, denn das war damals schon klar, uns klar, daß eben die Deutschen den
Krieg verloren haben, daß die Front sich uns nähert und wir ahnten auf der einen Seite
was Schreckliches, weil man sich nicht vorstellen konnte, daß sie uns einfach leben
lassen, wenn das Gebiet besetzt wird von den Russen, auf der anderen Seite ist man als
Mensch immer gehalten, doch daran zu glauben, daß man vielleicht durch ein Wunder
es doch schafft. Das Wunder geschah. Es kamen dann noch die berühmten
Todesmärsche kurz vor dem Einrücken der russischen Truppen, und wir wurden also
weiter nach Westen gejagt, aber am zweiten Tag... am dritten Morgen sind wir
unterwegs in ein Barackenlager gelangt, mir ist durch Zufall gelungen, in diesem
Barackenlager zu bleiben, mit vielen anderen und die SS gerieten schon langsam in
Panik, sind dann mit den anderen weitergezogen, wir waren in einer Baracke, die
anderen in anderen Baracken, waren wir plötzlich zwischen die Fronten geraten, wir
waren nicht mehr bewacht, aber auf der anderen Seite spürten wir, wir können jetzt hier
nicht ausbrechen, wir müssen abwarten. Wir warteten einige Tage ab, dann kamen die
russischen Truppen, und dann gelang es auf verschiedenen Umwegen in kleinen
Gruppen, wir waren sechs junge Tschechen, sich durchzuschlagen irgendwohin, in
irgendein Repatriierungszentrum... irgendwo hinter die Truppen, wo schon befreites
Gebiet war, polnisches oder slowakisches. Uns gelang es, in die Ostslowakei zu fliehen,
wo die sowjetische Armee war, da waren schon die Osttruppen, die unter Genaral
Svoboda in Rußland gebildet wurden, die als alliierte Truppen vorrückten, und so habe
ich dann in März, April 1945 eigentlich sozusagen die Grenzen überschritten, da war
schon Slowakei, auf slowakischen Boden. Zwei von uns meldeten sich noch in der
Armee, da lief aber nicht mehr viel, am 11. April wurde ich aufgenommen und dann
Anfang Mai war Kriegsende. So kam ich halt dann glücklich, aber ziemlich physisch
geschwächt und krank zurück, also vielleicht durch das Alter und andere psychisch
günstige Umstände bin ich relativ früh doch wieder sozusagen soweit fit gewesen, daß
ich mich zum Studium anmelden konnte. Ich wollte noch vielleicht eines sagen, weil im
Leben... durch den Einfluß meines Vaters und auch durch viele Freunde, mit denen uns
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
175
ähnliche Auffassungen verbanden, war ich eigentlich weit in den späten 30-er Jahren
damals jemand, der an Ideale glaubte, die irgendwie mit dem Wort Sozialismus
umschrieben wurden, und wir dachten eben und wir wurden in dieser Häftlingszeit
darin bestärkt, daß es doch gelingen müßte eine Gesellschaft zu schaffen, in der eben
Unterschiede der sozialen Herkunft, der Religion, der Nationalität, der Rasse keine
Rolle mehr spielen könnten. Wir glaubten, daß das gerade eben in dieser Bewegung, der
sozialistisch-kommunistischen Bewegung am ehesten gelingen könnte. Also das war
eigentlich der Grund, warum doch, nicht nur ich, sondern viele von uns zu dieser Zeit
zwanzig-, fünfundzwanzig-, dreißigjährige sich dieser Bewegung anschlössen aus
Überzeugung. Wir ahnten ja gar nicht, daß auch dies irgendwie verbunden sein könnte
mit irgendwelchen Privilegien, weil diese Bewegung mal die Macht ergreifen würde.
Das lief dann eben alles anders, wir schlössen uns also mit Begeisterung an, der
kommunistischen Partei, mein Bruder und ich, ... auch mein Vater. Früh erwies es sich
als total verkehrte Vorstellung, denn dieser Kommunismus, der ja eigentlich in der
Sowjetunion Wirklichkeit geworden war, führte ja dazu, gemeinsam mit der
tschechischen kommunistischen Bewegung, daß wir dann Opfer, nicht Täter, sondern
Opfer wurden, der eigenen Bewegung. Das hing wieder mit der jüdischen Herkunft,
unter anderem, zusammen. Denn unter dem Banner des Kommunismus oder der
kommunistischen Parteien breitete sich um das Jahr 47 eine wirklich terroristische
Welle aus, deren Opfer, nicht nur, aber doch zumindest in dem Umkreis, der uns
bekannt war, in dem wir lebten, viele Juden waren. Und das war eben die Zeit, in der
gerade in der Tschechoslowakei durch diese ganze historische Entwicklung, sich sehr
viele Juden der kommunistischen Bewegung angeschlossen hatten, und gerade die,
aufgrund des Einflusses der sowjetischen Machthaber aber auch der mit ihnen
verbündeten kommunistischen Führer in der Tschechoslowakei, eben die Juden
plötzlich diffamiert wurden als die Renegaten, die Verräter, die sich eingeschlichen
hätten in die Bewegung, und deren letztes Interesse nichts anderes sei, als eben zu
unterwandern die Bewegung, um ihre eigenen Macht- und vielleicht auch
Vermögensinteressen auf diese Weise durchzusetzen, gegen das Volk. Und alle diese
Phrasen, die dann gedroschen wurden und die ich hier nicht wiederholen möchte, waren
die Begleitmusik zu einer Terrorwelle ohnegleichen, und wir gehörten zu denjenigen,
die am härtesten betroffen waren. Meine beiden Eltern wurden in völlig
unterschiedlichen Zusammenhangen eingesperrt, erstmal inhaftiert, mein Vater im
Herbst Jahr 1949 mit der Welle, die bekannt ist in der Geschichte unter dem Stichwort
Slánsky-Prozesse, also politische, das war eine politische Gruppe, die verfolgt wurde,
wo vor allem Juden betroffen waren, an der Spitze dieser Gruppe, angeblich... das war
alles eine künstlich konstruierte Verschwörungstheorie in den Anklageschriften,
angeblich an der Spitze mit dem Generalsekretär der kommunistischen Partei namens
Slánsky,... ein tschechischer Jude..., den ich gar nicht kannte, aber der Bruder mit ihm...
im Ministerium arbeitete, also diese ganze Geschichte war... furchtbar kompliziert, das
würde eine eigene Studie erfordern. Aber ich will nur herausstellen, daß unter den
anderen Vorzeichen der Antisemitismus sich wieder ausbreitete, das waren
verschiedene Stories, die mit meinem Vater habe ich angedeutet, bei meiner Mutter war
es einfacher, einfacher gestrickt sozusagen, denn meine Mutter kam aus einer
wohlhabenden Familie und ihr zu unterstellen, daß sie als Klassenfeind absichtlich sich
eingeschlichen hätte in diese Bewegung, wobei eben ihre Geschwister im Ausland,
176
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
teilweise noch vor Hitler emigriert waren, teilweise 1945 zurückkamen oder 1948 im
Ausland blieben, das waren also die Geschwister, also das alles war natürlich sozusagen
ein gewünschtes Fressen, um das mal so salopp auszudrücken, für die Geheime
Staatspolizei, die tschechische STB, sie zu inhaftieren und zu verklagen, getrennt meine
Eltern, und wir waren natürlich alle beide betroffen, mein Bruder und ich. Wir waren
auch... ich hatte schon zu Ende studiert und war im Außenhandel tätig, mein Bruder auf
einem anderen Gebiet, und wir hatten dann Berufsverbot, wir sind gefeuert worden,
waren dann lange tätig in verschiedenen Berufen und erst sehr allmählich sind dann,
Mitte der 50-er Jahre,... kam wieder eine neue Politik ins Spiel. Unter dem Deckmantel,
würde ich sagen, der Kritik am Stalinismus ist eine gewisse Liberalisierung dann
doch..., hat Platz gegriffen, mit dem sogenannten 20. Parteitag im Jahre 56 von
Chruschtschov ist dann eben auch allmählich eine liberalere Kaderpolitik, also sprich
Personalpolitik, praktiziert worden, so daß wir wieder langsam in unsere Berufe, oder
zunächst teilweise, in intellektuelle Berufe wieder einsteigen konnten, meine Eltern
wurden freigelassen unterschiedlich, später rehabilitiert. Und all das hat natürlich dazu
geführt, daß meine politischen Überzeugungen sich langsam änderten. Der Anfang war
eigentlich der, daß man dachte: Ach, die haben sich wohl geirrt, da ist wohl irgendwas
schiefgelaufen, man hat diese Leute, die dafür verantwortlich waren, daß andere
angeklagt wurden, schlecht informiert, also irgendwo wollte man immer noch glauben,
daß sei ein Irrtum, ein Justizirrtum. Aber allmählich ist ja klar geworden, weil es unsere
Eltern betraf, und Prag ist eine Stadt, wo man sehr schnell Informationen, besonders
unter Intellektuellen, wechselseitig sammelt und Erfahrungen auch sammelt, und da
sind natürlich viele Zweifel gekommen, was eigentlich da schiefgelaufen war. Und was
dann auch sehr spannend für Außenstehende, für uns sehr, sehr schwierig war, das war
diese so langsame Chance, irgendwo etwas wieder besser zu machen. Also das betraf
einmal den eigenen Beruf, ich bin dann als Lehrer an eine Schule gegangen, die sich auf
Tschechisch "Střední ekonomická škola" nannte, ein Wirtschaftsgymnasium, wo ich als
Lehrer aufgenommen wurde für Volkswirtschaft und Politische Ökonomie und
Betriebswirtschaft, und allmählich war ich auch sehr erfolgreich und wurde von anderen
anerkannt,... na ja. Mein Bruder, der war nicht so sehr im wissenschaftlichen oder
pädagogischen Bereich tätig, sondern mehr im praktischen Bereich des Buchhandels,
aber das war die eine Seite der Sache, daß man sich selbst wieder irgendwie realisieren
konnte im Beruf, in der Arbeit und mit den Menschen, mit denen man da zu tun hatte,
mit jungen Menschen. Das zweite, was damit einherging, war die Frage: Lag man ganz
falsch politisch, sind schon die Fundamente dieser Idee des Sozialismus oder
Marxismus, sind die schon falsch angelegt oder könnte man nicht doch irgendwie was
davon noch hervorholen, um eine Variante, eine Alternative zu finden, denn vielleicht,
so dachte man, und das ist vielleicht auch heute nicht ganz falsch, ist nicht alles
indessen so erstrebenswert und wünschenswert? Und so auf diese Weise entstand bei
vielen kritischen Intellektuellen, man muß, glaube ich, sagen, das betrifft jetzt nicht
gerade nur und auch nicht in erster Linie die Intellektuellen, die tschechischen
Intellektuellen jüdischer Herkunft, sondern ist ein allgemeines Phänomen meiner
Generation und vielleicht einer Generation, die um zwanzig dreißig Jahre jünger ist als
ich, die damals eben auch schon voll im Berufsleben stand, in den späten fünfziger und
den sechziger Jahren. Es gibt eben unter diesen Menschen irgendwo... zumindest in der
Zeit gab es, so scheint es, daß es auch heute eine Chance gibt, daß es wieder neu
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
177
auflebt, ein Streben nach einer besseren Welt, nach irgendwie... nach solchen
Verhältnissen, wo nicht nur der Einzelne, sondern eben auch die Gemeinschaft sich
besser fühlt, sich freier entfalten kann. Und eben vor allem nicht mehr betroffen ist von
irgendwelchen, ja Unterdrückungs- und Unrechtverhältnissen, unter welchem
Vorzeichen auch immer sie gelaufen waren. Und davon haben wir, meine Familie und
ich, einiges erlebt, in zwei Regimen. Und so entstand bei vielen von uns, bei mir ist das
vielleicht besonders deutlich erkennbar unter den gegeben Bedingungen, die Idee irgend
etwas anderes zu schaffen und das war eigentlich die Idee dieses Prager Frühlings, wo
wir glaubten, vielleicht kann man das irgendwie rehabilitieren. Erstens glaubten wir
daran und zweitens war das wirklich unsere einzige Chance. Wir hatten ja nicht die
Möglichkeit irgendwie intensiver zu kommunizieren mit dem Westen und die ganzen
Diskussionen zu vollziehen und so ist es etwas, was, glaube ich, verständlich ist. Ich
habe mich dann sehr, sehr engagiert, war dann aufgenommen worden in die Akademie
der Wissenschaften, habe viel publiziert und habe eine neue Karriere gemacht in der...
(2. Seite) Helena: Also 64 bis 68? Jirka : Also genau bin ich Ende 62 aufgenommen
worden, also ich mußte ja auch erstmal meine Arbeit, meine Promotionsarbeit, meine
Dissertation fertig machen... Helena: Worüber war die? Jirka : Die war über...die hieß
"Fach- und Führungskräfte in der westdeutschen Wirtschaft" und die Idee..., erstens gab
es eine Gruppe, die sich mit diesen Themen befaßte und das zweite war, daß ich deutsch
konnte und das dritte war, daß ich doch schon irgendwo spürte, daß irgendwelche
positiven Erfahrungen verwertbar wären für unsere Ideen eines besseren Sozialismus,
ja. Daran habe ich gearbeitet, 66 habe ich die Arbeit verteidigt, damals gab es die
berühmten Titel... die sogenannten Kandidaten. Na ja, aber jedenfalls, es war eine
schöne Zeit für mich, für viele von uns und ich denke immer noch, daß also vieles, was
wir damals neu diskutierten, vieles war auch zeitbedingt, das wäre auch heute anders,
aber ich finde schon, daß man da einiges hervorheben könnte. Und vielleicht noch auf
die jüdische Frage zurückzukommen, also ohne daß ich der Sache immer irgendwie
besonders nach... es gab nicht mehr sehr viele Juden meiner Generation in Prag, die
meisten sind entweder umgekommen und viele sind dann auch emigriert wegen der
verschiedentlich sich wiederholenden Verfolgungen, aber doch, es gab etliche
Intellektuelle unter Schriftstellern, die jüdischer Herkunft waren, unter
Wissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, Naturwissenschaftlern und uns verband, ohne
daß wir uns dessen irgendwo bewußt waren doch irgendwie dieses gemeinsame
Schicksal. Und wenn ich jetzt an die einigen wenigen denke, die heute noch leben, die
das auch miterlebt haben, wir haben immer auf der gleichen Welle gedacht und gefühlt.
Und als Schlußwort möchte ich noch etwas anderes ergänzen. Es hat in meinem lieben
eine ganz wichtige Rolle gespielt, nicht nur im persönlichen, aber vor allem im
persönlichen Leben, und das ist meine Ehe und meine Kinder. In den Jahren, wo meine
Eltern eingekerkert wurden, mein Vater Ende 1949, meine Mutter im August 1950, war
ich wirklich allein. Mein Bruder war schon verheiratet mit seiner Frau, die waren also
sehr bemüht, irgendwie sich so eine Art Elefantenhaut, würde ich sagen, anzulegen, also
irgendwie es abzuwehren, was da alles lief und irgendwo sich insofern anzupassen,
nicht politisch oder irgendwie da zu kollaborieren, aber irgendwie sich so eine Art
Abwehrmechanismus anzulegen, daß sie alles, was beschwerlich war, abzustreifen
versuchten. Und ich habe da so ein bißchen eine andere Mentalität, also ich kann das
nicht so, ja. Und fühlte mich ein bißchen alleingelassen. Ich hatte auch nicht die
178
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
Möglichkeit von irgendwo Hilfe zu bekommen. In dieser Zeit war ich in einer
sogenannten Arbeitsbrigade, wo wir am Bau freiwillig, auf dem Prinzip der
Freiwilligkeit beim Aufbau des Sozialismus, um diese Phrase zu wiederholen, helfen
sollten, da habe ich meine spätere Frau kennengelernt, die aus einem ganz anderen
Milieu kommt, aus einer tschechischen Handwerkerfamilie und der das alles total fremd
war. Und sie, das war so Ende 1950, kurz nach der Inhaftierung meiner Mutter, also in
dieser Situation..., sie war 18, ich war 28... 29, haben wir uns entschlossen, schnell zu
heiraten. Und da war auch ein Stück meiner Lebensgeschichte mitentscheidend Sie hat
gespürt..., sie war ohne Vater, nur mit Mutter, es ging ihnen nicht gut materiell, sie hat
irgendwo gespürt, sie braucht Hilfe und für mich war sie auch ein bißchen jemand, der
mich verstand, auch gefühlsmäßig und auch eben die es mir ermöglichte, aus der
ständigen..., dieser Art von Verfolgungswahn, wo man wirklich spürte, irgendwo wird
man ständig verfolgt und beschattet, man kann sich nicht entfalten, man kann keinen
Beruf ergreifen..., dieses Spitzelsystem war ja schlimm... und das war für mich
irgendwo, ich würde sagen, auch eine Flucht aus dieser Situation, wo sie mir half. So ist
unsere Ehe entstanden, eine sehr..., eine Ehe von zwei Menschen, die aus sehr
unterschiedlichen Milieus stammen und daraus ergibt sich..., wo es aber manchmal, wie
ich finde, eben nicht so diese Last..., diese eine Art Erblast, würde ich sagen, der
Verfolgung von Juden, mir kommt es irgendwie so vor, daß in mir irgendwo doch etwas
steckt von Pogromen vor Jahrhunderten, die sich in ganz anderer Form wiederholt
haben, und so, muß ich sagen, hat die Helena mir immer sehr geholfen und dann eben in
diesen schweren Zeiten, nachdem der Prager Frühling, darauf komme ich noch zu
sprechen, eben niedergeschlagen wurde, wo die Tschechoslowakei von sowjetischen
Truppen besetzt wurde, wo allerdings alle die Verfolgungen, die ich irgendwie schon
verinnerlicht habe, wieder neu aufkamen und wir emigriert sind, hat sie mir auch sehr
geholfen. Wir hatten ja schon sehr früh nach unserer Hochzeit die Kinder, 1951 kam die
Ivana zur Welt, 3 Jahre später der Peter, also diese beiden Kinder haben uns auch sehr
verbunden, wir haben uns entschlossen, zu emigrieren. Die Geschichte meiner
Emigration über Österreich und München nach Deutschland, das ist, glaube ich, wieder
so ein anderes Kapitel, daß ich jetzt keine Lust habe, das nachzuvollziehen. Helena:
Aber vielleicht einfach zu Deutschland, ich meine, wenn man mit so einer Biographie
nach Deutschland kommt. Jirka : Ja, ja. Fragen Sie jetzt Einzelfragen vielleicht. Was
Deutschland betrifft, es ist so: 1968 war für mich vor allem das Jahr des Präger
Frühlings mit der Aufbruchstimmung und auch mit der Niederlage, die kam, und zu
dieser Zeit hatte ich, im Unterschied zu vielen, die auch den Holocaust überlebt hatten,
eigentlich immer noch, das ist ein Erbe meines Vaters und meiner Jugend, immer noch
das Gefühl, daß vielleicht vorübergehend, sagen wir in den Jahren so 64 bis 68,
irgendwo sehr im Hintergrund, nicht wahr, daß man doch differenzieren muß zwischen
den Deutschen. Also das habe ich schon gespürt. Und ich habe gewußt, es gab
Antifaschisten, ich kannte die, die haben in den 30-er Jahren bei uns als Emigranten
gelebt, auch mit ihren Familien, und wir hatten Kontakte, und ich wußte, es gibt da
schon wieder was Neues, trotzdem war ich eigentlich nicht unbedingt sehr motiviert,
direkt nach Deutschland zu gehen. Das war so eine zwiespältige Situation, und diese
Situation führte auch zu meinem Entschluß, es in Österreich zu versuchen. Und in
Österreich hatte ich noch meinen tschechoslowakischen Paß, sogar die Familie konnte
mich besuchen, das war so eine Art Übergangszeit, aber das war dann immer
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
179
schwieriger im Laufe des Jahres 69, und ich war auch einige Male in Prag, die
Entscheidung fiel mir sehr schwer. Aber es stand nicht sozusagen auf der Tagesordnung
die Frage nach Deutschland Das war gar nicht damals aktuell. Dann stellte sich heraus
entweder... erstmal war die Frage: Bleibe ich in Österreich oder ich gehe zurück in die
Tschechoslowakei? Und da habe ich..., es bedurfte keines großen Einflusses von vielen
Freunden, auch noch meines Bruders, und gut informierten sozusagen Tschechen, die
alle mir rieten, in meiner Situation, bei meinen Deutschkenntnissen, bei meinen
Kontakten, Sik hatte mich übrigens nach 64 nach Deutschland zu Vorträgen geschickt,
mein Chef, der Wirtschaftreformer und ich habe eigentlich in Deutschland immer sehr
erfolgreich referiert, als tschechischer Referent in Deutschland zwischen 64 und 68,
aber sozusagen alle rieten: Bleib in Österreich. Aber als ich in Österreich zu dem
damaligen Chef, dem österreichischen Direktor kam und ihm sagte: "Ich werde jetzt
hier nicht mehr bleiben können mit meinem tschechoslowakischen Paß, die Brücken
sind abgebrochen", ich war nämlich abberufen offiziell, "dort habe ich bestimmt
Berufsverbot, im besten Fall, vielleicht werde ich sogar verhört und, wer weiß,
vielleicht auch eingesperrt, also ich möchte bleiben." Da sagte er mir dann dieser
Direktor: "Ja, lieber K.", mit so einem schönen Wiener Akzent, "bei uns können Sie
nicht bleiben, weil wir ein internationales Institut sind, wir können Emigranten nicht
einstellen, wir wollen offizielle Kontakte mit den Ostblockländern haben, aber ich kann
Ihnen einen guten Job verschaffen in einer Staatsbank oder in irgendeinem Konzern,
wir haben gute Kontakte, Sie werden auch dort ganz gut bezahlt." Ich habe gesagt: "Ich
möchte doch in der Wissenschaft bleiben, irgendwie, wenn ich schon..." "Da müssen
Sie es in Deutschland versuchen", sagte er. Mein Bruder war in der Schweiz das erste
Jahr, aus ähnlichen Gründen wie ich, wollte er nicht direkt nach Deutschland gehen,
aber nie zurück, der war also fest entschieden. Da haben wir uns mal beraten, er hat
gesagt: "Schau, in Deutschland ist eigentlich eine Regierung, die uns irgendwo von
unserer ganzen intellektuellen und politischen Entwicklung nahesteht", mit Willy
Brandt an der Spitze damals, ja, "ich habe da Kontakte", mein Bruder war immer sehr
rührig in dieser Hinsicht, er war ganz berühmt im Buchhandlungsund Verlagswesen,
hatte viele Autorenbekannschaften geknüpft mit Böll und Grass..., so war er da sehr,
sehr bekannt, ich war so in wissenschaftlichen Kreisen bekannt oder hatte Kontakte,
also wir haben das alles so analysiert und wußten, daß wir keine... beruflich keine
Probleme hätten in Deutschland und daß eben auch vielleicht die politischen
Verhältnisse irgendwie günstiger sind, in unserem Sinn, daß es da nicht irgendwie
chauvinistisch, nationalistisch zugeht, was wir bei den Sozialdemokraten nicht
annahmen. Und eigentlich hat sich das bestätigt. Wir sind nach Deutschland gegangen,
ich hatte keine Probleme, ich hatte vier Angebote in Forschungsinstitute, ging dann
nach München und von dort eben nach einem Berufungsverfahren habe ich einen
Lehrstuhl erworben als Professor in Frankfurt. Und alles, was ich später in Deutschland
erlebt habe, vor allem mit der jungen Generation, hat eigentlich... ja... in keinster Weise,
würde ich sagen, irgendwie dazu geführt, daß ich es bereut hätte. Im Gegenteil, ich habe
nie einen Hehl daraus gemacht..., aus der Herkunft, soweit überhaupt das jemand
interessiert hat, die jungen Leute interessiert nicht so die Nationalität, Reh'gion. Und
eben gerade die junge Generation, die kennen das ja in Deutschland ziemlich alle, das
Gros, es gibt Ausnahmen, alle die Probleme mit den Skins, aber ich glaube, das ist nicht
das Entscheidende. Also ich hatte Probleme, um es zusammenzufassen, Ressentiments
180
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
haben eine gewisse Rolle gespielt, vielleicht eine kleinere als bei anderen Leuten..., und
die Entscheidung nach l und 1/2 der Emigration nach Deutschland zu gehen und dort zu
bleiben, habe ich nicht bereut. Also das ist diese Frage. Helena: Wie war das in der
Familie mit den Kindern, haben Sie mit ihnen darüber gesprochen, über Ihre Erlebnisse
während der Nazizeit vom Anfang an, es ihnen erzählt oder erst später oder? Jirka : Ich
kann mich nicht genau erinnern, ob wir überhaupt darüber gesprochen habe, wenn
überhaupt, so sehr marginal, nie irgendwie ausfuhrlich, nie irgendwie, um das
irgendwie herauszustreichen, irgendwo, ich weiß auch gar nicht so genau die
Motivation, warum wir dieses Thema eigentlich nie so besonders diskutiert haben, mit
der Helena auch nicht sehr..., aber der Helena habe ich alles erzählt, die hat alles
gewußt, aber nie wiederholt... Ich glaube, es waren zwei Gründe: Das eine ist, was
vielleicht bei vielen Holocaustüberlebenden der Fall ist, daß man nicht so gern über
diese Zeit spricht, irgendwo ist man froh, daß man überlebt hat, und ist nicht mehr in
der Lage dieses sozusagen immer neu..., heute vielleicht ist es nicht mehr so schwierig
wie damals. Aber irgendwo hat es einen doch immer wieder aufgerüttelt. Warum soll
man das auch noch den Kindern aufbürden, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt,
nicht bei allen, aber bei vielen. Bei mir hat noch etwas eine besondere Rolle gespielt:
mein ständiges Engagement. Ich war für diese Ideen immer irgendwie engagiert, in der
oder einer anderen Form haben sich die Ideen verändert, und die konkreten
Institutionen, denen ich mein Vertrauen geschenkt habe, aber ich war immer sehr
engagiert. Und in der Zeit, wo ich sozusagen..., sagen wir mal in den 50-er Jahren, wo
meine Eltern eingesperrt wurden und wo ich nicht engagiert war, weil es in der Zeit
nicht sein durfte (lacht), da hat bei mir, muß ich sagen, doch eine große Rolle gespielt
die allgegenwärtige Angst. Vielleicht hat die auch etwas zu tun gehabt mit früheren
Erlebnissen unter den Nazis, ich hatte am Anfang der 50-er Jahre dieses Spitzelsystem,
wo wir so verstrickt waren, ohne eigenes Verschulden, in diese Geschichte um die
Slánsky-Prozesse und diese ständigen Versuche von meinem Bruder und meinerseits,
davon habe ich noch nicht gesprochen, wir haben ständig versucht, irgendwie die Eltern
herauszukriegen, irgendwie klarzumachen, die Eltern können doch sowas nicht gemacht
haben, wir haben ständig Eingaben geschrieben an den Innenminister, an die Polizei
usw.. Wir haben die Mutter gesucht, bei Vater wußten wir, wo er ist, er war in
Einzelhaft. Also da hatte man auch Angst, und noch die Angst zu mehren, indem man
noch die alten Probleme..., noch über solche miesen Dinge spricht, das glaube ich, hatte
auch eine Rolle gespielt. Also insgesamt eigentlich habe ich nie darüber gesprochen.
Besonders mein Sohn, der Peter, der jetzt als Slavist in Potsdam tätig ist, deutsch
geheiratet hat, also eine Frankfurterin, drei Mädchen hat, der ist sehr interessiert in den
letzten erst so drei vier Jahren. Da ist jetzt die Zeit gekommen, wo also ich viel darüber
rede, vor allem mit Peter, die Ivana die ist halt irgendwie..., ja, die ist anders, die ist halt
nicht so sehr engagiert in diesen Fragen, nicht, daß sie an meinem Schicksal nicht
interessiert wäre, aber der Peter, der ist heute generell mehr interessiert an dieser ganzen
Geschichte des Judentums, an all den Verfolgungen, was war da eigentlich, warum war
das, er ist also vielleicht auch ein bißchen durch diese Wissenschaft bewegt, und er hat
auch Forschungsprojekte übernommen, er ist also eher Sprachwissenschaftler, aber
auch über diese Sache deutsch-tschechisch-jüdisch irgendwie ein bißchen forscht, ja,
also der ist da einfach durch persönliches Schicksal unserer Familie..., der Ivana ist das
alles jetzt auch gegenwärtig, sie hat einen Vortrag unlängst gehalten, vor einem halben
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
181
Jahr, über die Prager Juden, auch meines Lebenslaufs, sie hat erst gesagt, es wäre doch
gut, wenn ich das für die Enkel festhalten würde, sie hat dann selbst das Video gemacht.
Also es ist auch bei ihr das Interesse. Aber in den ersten Jahren haben wir nie darüber
gesprochen... Helena: Es ist auch jetzt leichter darüber zu sprechen, oder? Jirka : Ja, ja,
ist alles viel stärker verarbeitet, wie gesagt, es ist eben eigentlich alles einfacher, es ist
auch für mich viel einfacher im Rückblick, die späteren Entwicklungen auch, zu
verdauen, zu verarbeiten. Es ist ja so, daß also besonders, wenn es irgendwas gibt wie
eine Art Weisheit des Alters oder der Erfahrungen, die man irgendwie verarbeiten kann,
ist es bei nur vor allem, nicht eine Resignation, aber eine sehr viel nüchternere
Beurteilung von Visionen und Philosophien, von verschiedenen, sagen wir, Aufs und
Abs im Leben, ich sehe das alles viel nüchterner und bin da stärker gewappnet. Als bei
dem Spielberg Interview die Fragende immer wissen wollte, wie weit man unter dem
Trauma leidet, ich muß sagen, das ist bei mir viel weniger der Fall als vor zwanzig
dreißig Jahren. Irgendwo nehme ich das irgendwie viel nüchterner zur Kenntnis und bin
in der Lage, es in irgendeine Schublade (lacht) zu verschieben, wo ich es haben will, um
es wieder aufschlagen zu können. Gut, manchmal bekommt man sicher Alpträume, aber
es ist ja nicht schlimm... (hustet) Helena: Sie haben ja vorhin gesagt, daß Sie auch erst
in den letzten Jahren eigentlich wissenschaftlich angefangen haben, oder so bißchen
historisch und so, sich damit zu beschäftigen. Jirka : Ja, also wissenschaftlich habe
ich..., es ist so..., in dieser Hinsicht, muß ich sagen, gibt es in meinem Berufsleben, jetzt
abgesehen von dieser Zwangsarbeit, drei Phasen: Das eine ist die Phase, wo ich nicht,
da gehört schon die Zwangsarbeit hin, aber auch andere Berufe dazu, wo ich nicht die
Möglichkeit hatte in meinem eigenen Beruf Wissenschaft zu betreiben. Ich mußte eben
so als Angestellter, als Beamter arbeiten oder als Arbeiter, dann kam die Phase, wo ich
mich voll eingeschaltet hatte in die Sozialwissenschaft, sagen wir, als Bürger der
Tschechoslowakei, als Tscheche selbstverständlich, als Ökonom und auch als jemand,
der irgendwie sich nicht eng mit einem sozialwissenschaftlich spezialisierten Fach
betätigt, mich interessierte Nationalökonomie und Volkswirtschaft als Bestandteil einer
gesamten Sozialwissenschaft: Moral, Psychologie, Politik, Soziologie, das sind immer
Bereiche, und in meinen Publikationen kam es immer zum Vorschein, Grenzbereiche
auch, und da habe ich sehr viel gemacht, das hat mir immer Spaß gemacht. Die dritte
Phase ist die, wo ich mich, und das ist das, worauf Sie hinzielen, was ich Ihnen auch vor
dem aufgenommenen Gespräch gesagt habe, das ist das Interesse an der jüdischen
Geschichte, an den Zusammenhängen, die irgendwo zurückgehen oder zurückgeführt
werden können auf das, was sozusagen meine Vorfahren erlebt haben und was
sozusagen es ausgemacht hat in der früheren Zeit, Jude zu sein und die Prozesse, nicht
nur die Aufrechterhaltung des Judentums, aber auch die Prozesse, die ich überhaupt
nicht verurteile, ich habe sie selber durchgemacht, und einige Zeit war ich sogar von
ihnen sehr eingenommen, daß man sich assimiliert, daß man sich integriert in die
Gesellschaft, liberal, genauso die anderen anerkennen sollte, das verstehe ich immer
noch, aber früher hat es dazu geführt, daß ich gesagt habe, warum soll man sich
besonders für Juden interessieren, so war ungefähr meine Philosophie früher (lacht),
vielleicht unbewußt. Aber etwa so seit drei vier Jahren spüre ich..., es ist emotionaler, es
kommen dann Emotionen auf, daß ich z.B. irgendwo so Lust hab, ich hab nicht mehr
die Kraft, das alles zu realisieren, auch die Helena hält mich bißchen davon ab, ich
möchte z.B. alte Friedhöfe besuchen, wo meine Großeltern sind, das würde mich heute
182
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
interessieren, auch unter welchen Bedingungen sie aufgewachsen sind, warum sie diese
und jene Berufe hatten, warum mir fromme Juden sagen : "Du bist was Besonderes",
also ich glaube nicht, daß das stimmt, aber es ist schon irgendwie komisch und
interessant, daß der Name Kohn, das habe ich auch früher nicht gewußt, bedeutet irgend
etwas wie jüdischer Priester, die haben also irgendwie eine besondere Rolle (lacht)
gespielt in der Geschichte der Juden und ihre Grabsteine sind gekennzeichnet mit
Händen und mit Fingern. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben? Helena:
Ja, ich glaube schon. Jirka : Das sind Kohn und das heißt angeblich hebräisch.. .in der
Mehrzahl und das ist eine hebräische Endung und das waren irgendwie irgendwelche
besondere Juden..., und das interessiert mich einfach, wie es dann dazu kam, daß die
Juden, sagen wir, unter Josef II. im alten Österreich-Ungarn, im Österreich noch damals
plötzlich aus ihrem Ghetto herauskommen konnten, und ich habe natürlich, soweit es
dieses Interesse an Judentum betrifft, eine besondere Affinität zu allen innerjüdischen
Bewegungen, die in Richtung Liberalismus, Offenheit, Toleranz, Aufgeschlossenheit
gegenüber anderen Religionen, das habe ich immer gemocht, nicht jüdischer
Messianismus, der mir irgendwie zuwiderläuft... Dann ist auch..., es sind Dinge, die
mich besonders fasziniert haben, das ist bei mir geblieben, z.B. ich weiß nicht, ob Sie
von Lessing "Nathan der Weise" kennen, diese Ringparabel dieses..., ja, das fasziniert
mich, daß es so etwas gibt, daß man die eigene Herkunft und die Identität nicht
verleugnet, man kann auch stolz sein irgendwo drauf,.... aber auf der anderen Seite, daß
man eben nicht sieht, daß in der Menschheit etwas übergreifend ist. Und was auch für
mich sehr wichtig ist, und das ist auch rein emotional, ich kann das also vielleicht
bißchen rational begründen, aber es ist im Kern emotional. Also ich suche eine Affinität
zwischen der tschechischen Geschichte und der jüdischen Geschichte. Ich werde auch
so, glaube ich,... ich habe so viele Freunde, die eine ähnliche Mentalität hatten, mit
denen ich mich so gut verstehe, und ich könnte nie, da bin ich also..., entgegen meiner
multikulturellen, sagen wir, Weltanschauung (lacht), bin ich irgendwo schon gehalten
zu sagen: "Ja, das sind meine Leute, to jsou mí lidi", während ich das bei Deutschen,
da..., kommt auch vor, aber irgendwo ist das hier bei mir stärker, die Leute meiner
Generation, auch jüngere Leute, Tschechen, "já si s nima rozumìm prostě." Und ich
habe das Gefühl, da ist irgendwas Ähnliches, das sind Kleinigkeiten, man mußte sich
mal anpassen, man mußte überleben, das gilt für Tschechen wie für Juden, ja..
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 47/2002
183