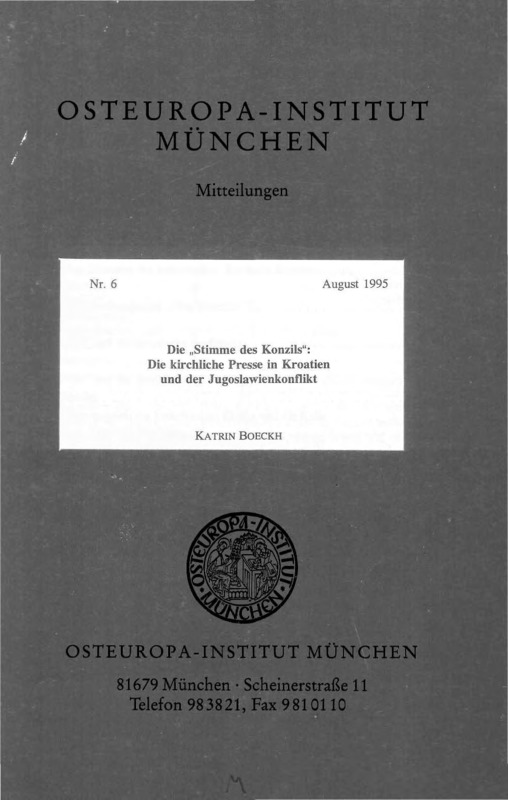https://www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_06.pdf
Media
- extracted text
-
f; f |
> ,
s
•
OSTEUROPA-INSTITUT
MÜNCHEN
Mitteilungen
Nr. 6
August 1995
Die „Stimme des Konzils":
Die kirchliche Presse in Kroatien
und der Jugoslawienkonflikt
KATRIN BOECKH
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN
81679 München • Scheinerstraße 11
Telefon 983821, Fax 981 Ol 10
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN
Mitteilungen
Nr. 6
August 1995
Die „Stimme des Konzils":
Die kirchliche Presse in Kroatien
und der Jugoslawienkonflikt
KATRIN BOECKH
Scheinerstraße 11, D-81679 München, Tel. (089) 99839 - 6442 / 99839 - 441
Fax (089) 9810110, E-Mail u9511aj@sunmail.lrz-muenchen.de
Inhalt
Vorwort
3
Die derzeitige Situation der katholischen Kirche in Kroatien
4
Allgemeine Bemerkungen zu „Glas Koncila"
5
„Glas Koncila" und die kroatische Regierung
7
„Glas Koncila" und die Bevölkerung Kroatiens
Die Kroaten
Die Vergangenheit der katholischen Kirche und die Rolle
von Kardinal Stepinac
Die Bedeutung des Papstes
Die Serben in Kroatien
12
12
14
15
17
„Glas Koncila" und die Ökumene
Die kleineren Glaubensgemeinschaften in Kroatien
Die Orthodoxie
Der Islam
18
18
19
22
Die Kriegsdarstellung in „Glas Koncila"
23
Schlußbewertung
25
Vorwort
Religiöse Motive sind während des derzeitigen Krieges in Jugoslawien, der sich
auf dem Boden Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas abspielt, selten die Auslöser für militärische Handlungen. Dennoch werden sie von den kriegsführenden
Parteien oftmals als propagandistische Rechtfertigung vorgeschoben. Dies ist
insofern leicht möglich, als die drei Hauptgegner - Serben, Kroaten und bosnische
Muslime - in der Mehrheit einer bestimmten Religionsgemeinschaft - der Orthodoxie, der katholischen Kirche und dem Islam - angehören, die eine große
Bedeutung bei der jeweiligen nationalen Identität besitzt.
Die Frage danach, inwieweit die Kirchen tatsächlich in den Krieg verwickelt
sind, werden in die vielfältigen Analysen des Jugoslawien-Konfliktes selten
miteinbezogen. Die vorliegende Arbeit soll versuchen, den Standpunkt der katholischen Kirche in Kroatien zu schildern und deren Rolle nach dem Zerfall Jugoslawiens darzustellen.
Grundlegend ist dabei die Berichterstattung der in Zagreb erscheinenden katholischen Zeitung „Glas Koncila" („Stimme des Konzils"; im weiteren: GK). Die
Zeitung nimmt insofern eine wichtige Position in der kroatischen Presselandschaft
ein, als sie auch Äußerungen von hohen kirchlichen Vertretern enthält und damit
die offizielle Position der katholischen Kirche in Kroatien widerspiegelt.
Eine nähere Betrachtung der Haltung der Katholiken in Kroatien erscheint nicht
nur deshalb von Interesse, weil damit der innerkirchliche Zustand beleuchtet wird,
sondern auch, weil sich daraus Rückschlüsse ziehen lassen auf die innenpolitischen Verhältnisse des sich im Krieg befindlichen Landes und auf den
Freiraum, den der Kirche als bedeutender gesellschaftlicher Kraft in dieser
schwierigen Lage zugestanden wird.
Folgende Fragestellungen stehen im Vordergrund der Analyse: Einführend ist
die derzeitige Situation der katholischen Kirche in Kroatien zu charakterisieren,
dann wird ihr Sprachrohr GK vorgestellt. Im weiteren werden derzeit wichtige
Themen aus der Zeitung herausgegriffen und näher untersucht: das Verhältnis von
GK zur kroatischen Regierung, zum kroatischen Volk und zur serbischen Minderheit in Kroatien sowie zur Ökumene. Abschließend wird auf die Kriegsberichterstattung von GK eingegangen. Insgesamt sollen aber nicht Details und Einzelfragen, sondern Tendenzen und Schwerpunkte der Zeitung zur Sprache kommen.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
3
Die derzeitige Situation der katholischen Kirche in Kroatien
Im ehemaligen Jugoslawien werden insgesamt 4.500.000 Katholiken verzeichnet,
deren Mehrheit in Kroatien, in Slowenien und in Bosnien-Herzegowina lebt. Es
gibt 11 katholische Bistümer in Kroatien, davon ein uniertes Bistum. In BosnienHerzegowina bestehen drei katholische Bistümer. Die spannungsreiche politische
Entwicklung in den letzten Jahren beeinträchtigte auch die Situation der Kirche
wesentlich.
Im Januar 1992 wurde Kroatien von den EG-Staaten und den USA völkerrechtlich anerkannt. Der Vatikan ernannte im Februar 1992 einen Nuntius, Giulio Einaudi, zuvor Nuntius in Chile, als kroatischer Botschafter kam Ive Livljanic in den
Vatikan. Der Heilige Stuhl sandte gleichzeitig eine Note an die serbische Regierung in Belgrad, in der betont wurde, daß die Anerkennung Kroatiens keinen
feindlichen Charakter gegenüber Serbien besitze und die diplomatischen Beziehungen zu „Jugoslawien" aufrechterhalten werden sollten.1 Allerdings zog Belgrad zugleich den bisherigen Botschafter Jugoslawiens beim Heiligen Stuhl, Ivica
Mastruko, mit der Begründung ab, dieser - ein Kroate - habe sich in Rom in den
ausschließlichen Dienst der kroatischen Tagespolitik gestellt.2
Das Ende des kommunistischen Systems zog in Kroatien nicht automatisch eine
religiöse Euphorie nach sich;3 die Situation der Kirche verbesserte sich nicht
schlagartig. Im Gegenteil sah man sich auf einmal mit neuen Schwierigkeiten
konfrontiert, die insbesondere in Zusammenhang mit den kriegerischen Ereignissen standen:
-
Innerhalb der landeskirchlichen Organisation löste sich die Jugoslawische
Bischofskonferenz im April 1992 auf und wurde im Jahr danach durch eine
Kroatische Bischofskonferenz ersetzt. Eine neugegründete Bischofskonferenz
für Bosnien-Herzegowina traf sich im Januar 1995 zu ihrer ersten Sitzung.
-
Das Verhältnis zur serbischen orthodoxen Kirche mußte neu definiert werden, aber auch zur katholischen Kirche in Slowenien. Hier bestehen Meinungsverschiedenheiten wegen einer Pfarrei, Raskrizje, die sich auf dem Territorium des slowenischen Staates befindet, Jurisdiktionen aber zum Erzbistum Zagreb gehört.
-
Im Dienst an den Gläubigen muß eine effektive Seelsorge aufrechterhalten
werden. Dies ist in den Bistümern, deren Territorien von Serben kontrolliert
1
THOMAS BREMER AUS der Römisch-Katholischcn Kirche in Kroatien, in: Kirche im Osten,
Bd. 37 (1994) S. 112-121, hier S. 113, Anm. 1.
2 Vatikan erkennt Republiken an, in: Glaube in der 2. Welt 20 (1992) Nr. 1, S. 5; Sveta Stolica
priznala Hrvatsku, in: GK (1992) Nr. 3, S. 1 und 3.
3 Vgl. FRANO PRCELA [Interview mit Zivko Kustic] Izazov demokracije, in: Ziva zajednica
(Juni 1990) Nr. 6, S. 6-7, hier S. 6.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
4
werden, großenteils nicht einmal mit Hilfe der UNO-Truppen möglich. Oft
wurden die Gläubigen, Priester und Ordensleute ermordet, vertrieben oder
dürfen sich als Katholiken nicht mehr äußern. Viele kirchliche Gebäude wurden mutwillig beschädigt: Bis 1994 wurden durch Kriegseinwirkungen schätzungsweise über 1000 Moscheen sowie je rund 500 katholische und orthodoxe Gotteshäuser zerstört.4
-
Die Versorgung von hunderttausenden Flüchtlingen und Vertriebenen muß
gewährleistet werden. Hierin liegt die Hauptaufgabe der katholischen Kirche.
Unterstützung kommt dabei von der Caritas vor allem aus Deutschland,
Österreich und Italien, aber auch die kroatische Regierung leistet Beachtliches: 1992 mußte sie 20% des Staatsbudgets dafür aufwenden (62 Mio. USDollar pro Monat). Die katholische Kirche macht bei ihren Unterstützungsmaßnahmen keinen Unterschied in der Konfession der Bittsteller: In Bosnien
waren es 1994 ca. 50% Muslime, die sich an katholische Hilfsstellen wandten5. Die katholischen Stellen haben sich auch vieler Säuglinge angenommen,
die von vergewaltigten bosnischen Frauen zur Welt gebracht wurden.
Das politische Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem Staat ergibt sich aus der Verfassung der kroatischen Republik aus dem Jahr 1990, die in
Art. 14 ausdrücklich die Gleichheit aller Bürger ungeachtet ihres Glaubens vor
dem Gesetz erklärt. Während einzelne Bestimmungen der Verfassung im Falle
eines Krieges oder bei Naturkatastrophen durch das Parlament eingeschränkt
werden können, darf dies in Bezug auf die Gedanken-, Gewissens- und Glaubensfreiheit nicht geschehen (Art. 17).6
Für die Gläubigen und die Kirche hat die Religionsfreiheit zur Folge, daß sie
nun, anders als zu kommunistischer Zeit, unbehindert in der Öffentlichkeit auftreten kann, Zugang zu Radio und Fernsehen hat und ihre Publikationen frei verkaufen und verbreiten kann.
Allgemeine Bemerkungen zu „Glas Koncila"
Publizistisches Forum der katholischen Kirche im ehemaligen Jugoslawien ist die
wöchentlich in Zagreb erscheinende Zeitung GK. Ihr Umfang beträgt derzeit ca.
16 Seiten, die Auflage momentan 50.000 Exemplare. Mit dem Verkaufserlös (eine
Einzelnummer kostet zwei Kuna, umgerechnet ca. 70 Pfennig) können alle Ko4
5
6
Zerstörte Kirchen in Zahlen, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 1, S. 3.
Neue katholische Bischöfe, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 1, S. 3-4.
Eine deutsche Übersetzung der kroatischen Verfassung vom 22. Dezember 1990 in: Jahrbuch
für Ostrecht 32 (1991) 2. Halbband, S. 388-414.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
5
sten für den Druck und sonstige Ausgaben gedeckt werden. Die Zahl der Leser
läßt sich nicht exakt in Erfahrung bringen, ebensowenig das Verbreitungsgebiet.
Dazu gehört auf jeden Fall das kroatische Staatsgebiet, weggebrochen sind aber
durch den Krieg viele katholische Gemeinden in den serbisch besetzten Gebieten,
z.B. in Slawonien und in Bosnien, wo viele Gläubige ohne jeglichen geistlichen
Beistand auskommen müssen.
Anders als in Deutschland, wo die einzelnen Bistümer eigene kleinere Zeitungen veröffentlichen, ist GK eine überregionale Zeitung. Wegen ihrer kirchlichkatholischen Grundhaltung kann man sie mit dem in Bonn erscheinenden
„Rheinischen Merkur" vergleichen, der jedoch wesentlich mehr politische Informationen bringt.
GK sieht seine Aufgabe darin, über kirchliche sowie über die Kirche betreffende politische Vorgänge zu informieren. Das Zielpublikum dürften daher interessierte Laien sein bzw. Gläubige jeder sozialen Herkunft. Der Stil von GK ist
leicht verständlich, die Artikel sind in der Regel nicht überlang.
Die erste Ausgabe von GK erschien nach Beginn des 2. Vatikanischen Konzils
- daher der Name der Zeitung - im Jahr 1962; den kroatischen Gläubigen ist die
Zeitung also eine längst vertraute Erscheinung. Als man 1993 die 1000. Nummer
publizierte, stellte Kardinal Kuharic in einem Grußwort die seit jeher von GK
postulierten Grundsätze zusammen: der Dienst an der Wahrheit und am Gewissen
der Gläubigen, an der moralischen Gesundung des Volkes, an der apostolischen
Lehre und am sozialen Programm der Kirche. GK soll als Zeitung zum Dialog
sowohl innerhalb der katholischen Kirche, als auch zwischen allen Christen und
christlichen Kirchen anregen, aber auch alle anderen Leute, die keiner Kirche angehören, ansprechen.7
Weltanschaulich ist damit die Position von GK definiert: Ihr Maßstab sind neben der Lehre der katholischen Kirche und des Evangeliums alle ethischen Werte,
allen voran die Menschenrechte, die individuellen Freiheitsrechte und die Würde
des Menschen.
Ein wichtiges Kriterium in der Beurteilung einer Publikation besteht darin, zu
untersuchen, inwieweit sie von ihrem politischen Umfeld unabhängig ist. Es gilt
also zu klären, in welchem Verhältnis GK zum Staat bzw. zur kroatischen Regierung steht.
7
FRANJO
KUHARld: Glas Koncila je glas Crkve u Hrvatskoj, in: GK (1993) Nr. 32, S. 3;
SAGI BUNlC Glas Koncila - Bozij dar Crkvi u Hrvata, ebenda.
TOMISLAV
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
6
„Glas Koncila" und die kroatische Regierung
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: GK ist bemüht, sich in staatliche Angelegenheiten nicht einzumischen, keinen zu engen Kontakt zur Regierung herzustellen und der Regierungspartei in Zagreb, HDZ, möglichst neutral gegenüberzustehen. Diese bewußte Distanzierung vom Staat und von den staatlichen Interessen hat eine lange Tradition, die GK bereits in kommunistischer Zeit praktizierte. Damals war das Verhältnis der katholischen Kirche zum kommunistischen
und atheistischen Staat kühl. Wegen der staatlichen Diskriminierungen wurden
viele Katholiken in die Emigration gezwungen.
Dennoch konnte GK publizieren. Es gelang der Zeitung sogar, einen
unabhängigen Standpunkt einzunehmen und sich einen Freiraum zu schaffen, wie
es in Jugoslawien kaum einer anderen Pressepublikation gelang. GK war die einzige Zeitung, die eine freie, wenn auch vorsichtige und äußerst risikoreiche Berichterstattung zustandebrachte, immer in der Gefahr, mit der nächsten Ausgabe
gleichzeitig die letzte herauszugeben. Von der Regierung in Belgrad wurde GK
wohl mit dem Hintergedanken geduldet, um dadurch dem Ausland vorweisen zu
können, man habe Pressefreiheit. Gelesen wurde GK, das zu Spitzenzeiten eine
Auflage von 180.000 erreichte, damals von Gläubigen, die sich für die Vorgänge
innerhalb der Kirche interessierten, aber ebenfalls von kommunistischen Funktionären, die sich ein Bild über kirchliche Positionen machen wollten. Diese Unabhängigkeit von der Politik trotz staatlicher Repressionen hat GK in eine Position
versetzt, die sie auch unter den neuen Verhältnissen in Kroatien nicht mehr aufgeben will.
Natürlich wurde 1990 die staatliche Unabhängigkeit Kroatiens auch von der katholischen Kirche mit großer Begeisterung begrüßt. In der künftigen Entwicklung
sah man nur Positives und erhoffte sich von einem neuen demokratischen kroatischen Staat Gewissens- und Religionsfreiheit, die bisher unter den Kommunisten
nicht gewährleistet waren.
Kardinal Kuharic bezeichnete die völkerrechtliche Anerkennung Kroatiens
1992 als einen Sieg der Freiheit und des Friedens. Staatsrechtlich bezog er sich
auf den kroatischen Staat im Mittelalter, der dann 1102, mit der Übernahme der
kroatischen Landesteile in das Königreich Ungarn, in seiner Souveränität eingeschränkt worden war. Damit argumentierte er nicht anders als die Politiker in
Kroatien, die die staatliche Unabhängigkeit historisch legitimierten (wobei sich
viele andere Länder Ostmittel- und Südosteuropas, die nach dem Fall des
Kommunismus die Unabhängigkeit erlangten, ebenfalls auf einen mittelalterlichen Staat beriefen). Allerdings ist dieses Begründungsmuster eigentlich unnötig, da der Rekurs auf ein in früheren Zeiten bestehendes Staatswesen kein
zusätzliches Argument für die völkerrechtliche Legitimation des kroatischen
Staates darstellt.
Welche weiteren Folgen die kroatische Unabhängigkeit im außenpolitischen
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
7
Bereich mit sich bringen würde, erkannte man 1992 nicht und konnte man im
nationalen Überschwang im Moment wohl auch nicht erkennen.
Dem Prozeß der inneren Demokratisierung des jungen Staates stand GK positiv
gegenüber. Da die Demokratie die von Gott gewollte Ordnung darstelle, sei jeder
Gläubige zu ihrer Verwirklichung aufgerufen, so GK. Die Mitarbeit am Staat und
die Teilnahme an den staatlichen Wahlen sei eine „moralische Pflicht der Gläubigen".8 Wahlpropaganda zugunsten einer Partei veröffentlichte GK nicht, rief aber
dazu auf, jede Partei an ihren Aussagen über den Wert des Lebens und der Menschenrechte zu messen. Als Wähler müsse man insbesondere darauf achten, ob die
Parteiprogramme mit dem christlichen Verständnis über das Leben, den Menschen, die Familie und den Staat in Einklang zu bringen seien und ob die entsprechenden Kandidaten imstande seien, die Verantwortung für politische Tätigkeiten
zu übernehmen.9
Außerdem besteht GK darauf, daß die Kirche weder eine politische Partei darstelle noch sich mit einer solchen identifiziere. Andererseits dürfe auch keine politische Partei für sich das Recht in Anspruch nehmen, die Kirche zu repräsentieren. GK erinnert daran, daß Diktatoren auch über demokratische Wahlen an die
Macht kommen können, um dann das Volk, das sie gewählt hat, seiner natürlichen
Rechte zu berauben und es einer Tyrannei zu unterwerfen. Die Christen und alle
demokratischen Kräfte müßten sich nach Kräften dafür einsetzen, daß sich dieses
nie wieder ereigne. Werte wie die Freiheit und die Würde des Menschen sollten
immer wieder betont werden.10 Die Wahl einer politischen Vertretung überläßt
GK also den Lesern, es werden lediglich Entscheidungskriterien angeboten.
Auch in der Kommentierung der Tagespolitik verhält sich die Zeitung zurückhaltend; gelegentlich werden zwar aktuelle Fragen der Innenpolitik diskutiert,
aber nur, soweit sie Angelegenheiten der Kirche und der Gläubigen darstellen,
z.B. die Frage der Einführung von Kirchensteuern oder des Religionsunterrichts.
Ansonsten ist jedoch über Politik in GK selten etwas zu lesen, und wenn, dann
sind die einzelnen Artikel oftmals mit dem Namen des Autors gezeichnet, der
damit aufzeigt, daß er für den Inhalt selbst verantwortlich ist und nicht automatisch die Position der Redaktion von GK vertritt. Allerdings würde GK keine Artikel abdrucken, wenn sie eine der katholischen Kirche entgegengesetzte Meinung
vertreten.
Belobigungen auf die kroatische Staatsführung gibt es in GK nicht. Umgekehrt
ist auch nicht zu lesen, in welchen Aspekten die Regierung eine andere Haltung
von der katholischen Kirche erwartet. Die Regierung sucht insgesamt einen guten
Kontakt zur katholischen Kirche. Dies kommt in vielen Appellen und Empfängen,
aber auch in symbolträchtigen Taten zum Ausdruck. So wurden beispielsweise die
8 Sudjelovanje na izborima je moralna duznost", in: GK (1990) Nr. 14, S. 1.
9 Ebenda.
10 Da demokracija samu sebe ne prevari, in: GK (1993) Nr. 4, S. 2 .
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
8
Tagebücher von Kardinal Stepinac,11 die von den Kommunisten requiriert worden
waren, an die Kirche zurückgegeben,12 was mit nur geringen Kosten verbunden
war, aber einen wirkungsvollen demonstrativen Akt darstellte.
Tatsächlich decken sich bestimmte Interessen der Politik durchaus mit Forderungen der Kirche. Auch die Regierung ist interessiert an einer Stärkung des Katholizismus, der einen wesentlichen Teil des kroatischen Nationalbewußtseins
ausmacht und über den es möglich ist, Einfluß im Volk zu gewinnen. Der Gefahr,
daß die Regierung ihre Macht auch mit Hilfe der Kirche ausbreiten möchte, ist
sich GK durchaus bewußt, und die Zeitung wehrt sich dagegen. Ein Ausdruck
dessen ist in jüngster Zeit (1995) die Auseinandersetzung von GK mit der Zagreber Zeitung „Vjesnik" sowie mit kroatischen Politikern, die plötzlich ihre katholische Gesinnung entdeckt haben und versuchen, über Tageszeitungen Kritik an GK
zu propagieren.13 In einem Kommentar geht die Redaktion von GK auf einen solchen Vorgang ein, als in „Vjesnik" behauptet wurde, es gebe kaum einen kroatischen katholischen Geistlichen, der die Feindeshebe predige.14 GK hält dies für
eine Beleidigung der kroatischen Geistlichen, die sich durchaus an den Geist des
Evangeliums hielten und sehr wohl die Liebe gegen welchen Feind auch immer
betonten. In diesem Zusammenhang wehrt sich GK auch entschieden dagegen,
daß von bestimmten, nicht namentlich genannten Politikern in Kroatien versucht
wird, den Katholizismus als Staatsideologie aufzubauen. Das Christentum könne
niemals eine Ideologie werden, da es nichts anderes sei als der Weg der Nachfolge Jesu Christi, dessen wichtigstes Gebot in der Nächstenliebe bestehe. Der
Versuch, das Christentum zur Staatsideologie umzudeuten, sei weniger für die
Kirche als für den Staat gefährlich, formuliert GK. Denn nur totalitäre Regime
benötigten eine Ideologie, während in einem demokratischen Staat weder eine
Staatsideologie noch eine Staatskirche ausschlaggebend seien. Den besagten
Leuten sei nicht klar, daß sie mit ihrer Forderung in das Argumentationsmuster
der Vergangenheit zurückfielen und das frühere Einparteiensystem durch ein anderes ersetzen wollten, die marxistische Ideologie durch den Kathohzismus. In
dieser Position wäre aber die Kirche nicht mehr das öffentliche, kritische Gewissen, unabhängig von der staatlichen Herrschaft.
Dennoch fordern einige kroatische Politiker wiederholt, Kroatien solle ein
11 Zu Kardinal Stepinac vgl. unten S. 14f.
12 Predsjednik Tudjman vratio Crkvi Stepinöeve „dnevnike". „Jedan od ispravaka koje ce povijest morati izvrsiti", in: GK (1991) Nr. 8, S. 1.
13 Zur Auseinandersetzung zwischen GK und „Vjesnik" vgl. auch folgendes Interview des
Redakteurs von GK, IVAN MIKLENIC Crkva nece nasjesti na ideoloski lijepak, in: Vjesnik
(17. 3. 1995). Zur selben Thematik: IVAN MlKLENlt Crkva ne daje prednost ni jednoj stranci,
in: Danas (4. 10. 1994), deutsch übersetzt in: Südosteuropa 44 (1995) H. 1-2, S. 102-106.
14 Teska uvreda hrvatskim katoliökim svecenicima, in: GK (1995) Nr. 9, S. 2. Vgl. auch die
Überlegungen von ZrvKO KUSTIC Postaje li katolistvo drzavna ideologija?, in: DERS. Hrvatska. Mit ili misterij. Zagreb 1995, S. 246-249.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
9
„katholisches Kroatien" und ein „katholischer Staat" sein. Gegen diese Tendenz
wehrt sich die katholische Kirche vehement, weil man verhindern will, daß die
konfessionelle Zugehörigkeit eines Bürgers politisch mißbraucht wird. GK gibt
folgende Begründung: Ein Staat ist von seiner Definition her eine weltliche Einrichtung. Christen könnten zwar darauf bestehen, daß seine Gesetze humanitären
Grundsätzen entsprechen, jedoch dürfe die Kirche dem Staat keine Gesetze auferlegen. Beispielsweise könne die Kirche im Eherecht nicht darauf drängen, daß
alle Geschiedenen oder zivilrechtlich Wiederverheirateten aus dem öffentlichen
Leben ausgeschlossen werden. Hervorzuheben, das katholische Bekenntnis sei ein
Hauptmerkmal der kroatischen Staatlichkeit, sei für Kroatien verhängnisvoll, weil
dies einen Gegensatz unter seinen Volksangehörigen schaffe. Man könne daher
zwar von einem katholischen Volk, aber nie von einem katholischen Staat sprechen.15 Zudem verstoße der Kampf für einen katholischen Staat gegen die zeitgenössische katholische Soziallehre und gegen die Grundsätze des 2. Vatikanischen Konzils.16 Die kroatische katholische Kirche wolle dem Volk zwar
dienen, aber nicht als Organ des Staates und nicht als „staatlicher Glaube". Jeder
Versuch, den Katholizismus zur Staatskirche oder Ideologie zu erheben, sei gegen
das Evangelium und zudem gegen den kroatischen Staat als demokratischen Staat
gerichtet.17
Weitere Reibungspunkte zwischen der katholischen Kirche und der Zagreber
Regierung bestehen hinsichtlich der Einführung einer Kirchensteuer (bisher finanzieren sich die Kirchen in Kroatien nur durch Kollekten und Spenden), der
Reprivatisierung und Restitution von Kirchenbesitz (dazu zählen neben kirchlichem Grundbesitz auch historische Urkunden, Matrikelbücher oder Archivmaterialien, die der Kirche entzogen worden waren und nur allmählich zurückgegeben
werden) sowie bei der Regelung der Abtreibungsgesetzgebung (bisher wurde an
der unter den Kommunisten eingeführten Fristenregelung festgehalten, die sich
mit den kirchlichen Vorstellungen nicht in Einklang bringen läßt). In diesen Fragen sieht es momentan nicht so aus, als würde sich die Position der Kirche gegen
die staatlichen Interessen durchsetzen lassen.
Übrigens wäre eine offen in GK geführte Auseinandersetzung mit der Regierung von Franjo Tudjman eine delikate Angelegenheit, weil sie von dritter, nämlich von serbischer Seite her, mißbraucht werden könnte. Ein Beispiel dafür ist ein
Interview mit dem langjährigen früheren Redakteur von GK, Zivko Kustic, der in
einer kroatischen Zeitung erklärte, er sehe in Kroatien klare Erscheinungen des
Nazismus und Rassismus. Diese Aussagen wurden von Belgrader Medien aufgegriffen, wo es schließlich hieß, ein führender kroatischer katholischer Intellektu15 Sto znaä „katoliöka Hrvatska"?, in: GK (1993) Nr. 21, S. 2.
16 Hrvatska - katoliöka drzava?, in: GK (1994) Nr. 45, S. 3.
17 Zasto se neki politiöari ljute na Crkvu?, in: GK (1995) Nr. 13, S. 13.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
10
eller beschuldige den kroatischen Staat, Nazismus und Rassismus zu fördern. Daß
man unter diesen Umständen jedes zur Veröffentlichung bestimmte Wort überlegen muß, liegt auf der Hand, zumal sich dann auch als weitere Reaktion die kroatische Presse bemüßigt fühlte, Kustic darauf hinzuweisen, mit seiner Kritik vorsichtiger zu sein.18
Insgesamt dürfte gerade Kustic wegen seiner kritischen Äußerungen nationalkroatischen Kreisen ein Dorn im Auge sein. Vor einiger Zeit wandte er sich dagegen, das Kroatentum zu einem Mythos zu erheben, da dies beinhalten könne, daß
man in seinem Namen Verbrechen und Mord begehen dürfe: „Gott erlaubt kein
Opfer eines Menschenlebens für irgendeinen Zweck. Ein menschliches Wesen
kann sich selbst für andere opfern, doch niemand sonst darf sein Opfer fordern.
Wenn das Vaterland zum Mythos wird, welcher Verbrechen gegen die Menschlichkeit rechtfertigt, dann ist das kein Vaterland mehr, sondern ein Teufel... Wenn
jemand behauptet, die Kroaten in Kroatien seien das einzig souveräne Volk, und
infolgedessen glaubt, daß Serben nicht souverän seien, dann redet diese Person
völligen Unsinn. Nirgendwo existiert eine ethnische Gruppe, die als politische
Einheit organisiert ist und als solche ausschließlich regieren könnte. Dies stellt
einen unserer Mythen dar, für welchen Menschen ihr Leben verlieren: Bei uns
sind die Kroaten souverän, also sollen in Kroatien nur die Kroaten regieren
[-]". 19
Welche Folgen die staatliche Unabhängigkeit Kroatiens für die gesellschaftliche Position und Arbeit der katholischen Kirche nach sich zieht, charakterisiert GK folgendermaßen: Die Kirche müsse die Rolle einer stillen Opposition
aufgeben und sich in den neuen demokratischen Verhältnissen zurechtfinden, die
die Kirche zwar nicht behindern, aber auch nicht unterstützen werden.20 In einer
pluralistischen Meinungsvielfalt müsse die Kirche wegweisend auftreten. Dies
bedinge eine verstärkte innere Umorganisierung der Kirche, damit sie in nachdrücklicher und überzeugender Weise in der Gesellschaft auftreten könne. Weiter
verhalte sich der demokratische Staat kraft seiner Verfassung den verschiedenen
weltlichen und ethischen Konzeptionen neutral und offen gegenüber. Eine Demokratie fühle sich aber nicht als Hüterin der Moral, auch nicht der christlichen
Moral oder des christlichen Weges der Verkündung der Wahrheit. Sie stehe auch
nicht in der Verpflichtung der Zehn Gebote. Die Kirche müsse jetzt die richtigen
Worte und Umgangsformen mit einem solchen Staat finden, was wesentlich größere Schwierigkeiten verursache als zu Zeiten des atheistischen kommunistischen
Staates.21
18 MATE PIIKOR Kusticeva „kritika s mjerom", in: Veöernji list (31. 3. 1995) S. 2.
19 Aus: Kirchen und nationaler Mythos, in: Glaube in der 2. Welt 21 (1993) Nr. 2, S. 6.
20 DRAGO SIMUNDZA Vrijeme (re)organizacije i akcije, in: GK (1991) Nr. 5, S. 4.
21 JosiP SABOL Sluzenje ili vladanje Crkve u demokratskoj drzavi?, in: GK (1995) Nr. 13, S. 6.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
11
Der katholische Erzbischof von Belgrad, Perko, stellte 1992 heraus, daß die erhaltene Freiheit sicher ein Gnadenmoment für die Christen bedeute, den es zu
nützen gelte. Nunmehr aber äußerten sich die Feinde der Kirche nicht mehr aus
kommunistischer Sicht, sondern aus der Position des Liberalismus. Die größte zu
gewärtigende Gefahr jedoch sei der Nationalismus, der als Ideologie die vorhergehende kommunistische ersetze.22
Zusammenzufassend läßt sich sagen, daß der Standpunkt von GK der Regierung gegenüber distanziert und kritisch ist. Dabei wurden vor der kroatischen
Unabhängigkeit alle demokratischen Bewegungen von der Kirche unterstützt,
während man nach der Demokratisierung Kroatiens zwar auf ein gutes Verhältnis
zur Regierung bedacht ist, sich aber nicht in die Politik einmischen will. Hierin
unterscheidet sich die katholische Kirche in Kroatien von der Orthodoxie in Serbien, die anfangs den Kurs unter Milosevic unterstützte, sich dann aber öffentlich
von ihm distanzierte, weil er die Belange des serbischen Volkes nicht energisch
genug verfolge.23
„Glas Koncila" und die Bevölkerung Kroatiens
Die Kroaten
Nation und Religion sind in vielen Staaten eng zusammenhängende Sachverhalte,
so auch in Kroatien, wo eine große Zahl der Einwohner katholischer Glaubensund kroatischer Volkszugehörigkeit ist. Für manche Kroaten ist die katholische
Konfession sogar die unabdingbare Voraussetzung für die Staatsbürgerschaft der
Republik Kroatien. Ein Leserbrief in GK greift dies auf und fragt an, ob es denn
möglich wäre, daß jemand kroatischer Staatsbürger, gleichzeitig aber nicht
katholischer Glaubenszugehörigkeit sei.24 GK antwortet darauf, daß dies sehr
wohl der Fall sein könne, und weist nachdrücklich darauf hin, daß es Aufgabe
jedes einzelnen sei, dies zu tolerieren. Damit ist ein Standpunkt, der in GK immer
22
23
24
FRANZ PERKO Die Christen im ehemaligen Jugoslawien, in: Ost-West Informationsdienst
(1992) H. 176, S. 55-65, hier S. 55-56.
Am 19. Januar 1992 veröffentlichte der Hl. Synod der serbischen orthodoxen Kirche eine
Erklärung, in der es hieß, das Vertrauen des serbischen Volkes in die politische Spitze Serbiens sei erschüttert, nachdem Milosevic den Vereinten Nationen gegenüber zugesagt hatte,
UNO-Blauhelme innerhalb des serbischen Siedlungsgebietes in Kroatien, der Krajina, einzusetzen. Der Synod wandte sich damit gegen die Zementierung der von den „Tito-Kommunisten" willkürlich festgelegten Grenzziehungen - vgl. Kritik an Milosevic, in: Glaube in der
2. Welt 20 (1992) Nr. 2, S. 13-14.
Nasi razgovori, in: GK (1990) Nr. 42, S. 10. Eine ähnliche Problematik behandelt ein anderer
Leserbrief unter dem Titel Narodna i crkvena pripadnost, in: GK (1990) Nr. 17, S. 10.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
12
wieder anzutreffen ist, formuliert, nämlich die Forderung nach Toleranz gegenüber den Nicht-Katholiken.
Als katholische Zeitung begreift sich GK vor allem aber als Organ der
(katholischen) Kroaten. Dies kommt in der Betonung des historischen Bewußtseins bzw. des „Bewußtsein des kroatischen Volkes" zum Ausdruck, das die
katholische Kirche seit Jahrhunderten förderte. In kommunistischer Zeit versuchte
sie, ihren Angehörigen Hoffnungen auf eine bessere Zukunft zu geben. Eine
Möglichkeit sah sie darin, daß sie kroatische Jahrestage betont feierlich beging,
z.B. die Jubiläen zum Bestehen des Christentums in Kroatien.25
Die Verbindung zum Kroatentum stellt in den Augen von GK nichts
Ungewöhnliches oder Negatives dar. Die vorgebrachte Begründung dürfte nicht
weit entfernt sein von der Argumentation der serbischen orthodoxen Christen: Die
Konstante „Volk" stelle - ähnlich wie auf der Ebene tiefer diejenige der „Familie"
- einen bedeutenden Wert dar, der das menschliche Zusammenleben erleichtere.
Nur derjenige, der fest im eigenen Volk verwurzelt ist, könne auch auf der Ebene
zwischen den Völkern, auf internationaler Ebene, zur Zusammenarbeit beitragen.
Im kirchlichen Leben bedeute dies, daß nur derjenige, der sich eng an die Kirche
anlehne, für die Ökumene eintreten könne. Für jeden Menschen seien beide Konditionen unerläßlich, wie GK schreibt: Es habe sich oft gezeigt, daß ein Mensch
ohne nationale und religiöse Wurzeln zum Spielball in den Händen von unmenschlichen Mächten werde.26 Allerdings wandte sich die 4. Vollversammlung
der Kroatischen Bischofskonferenz im Juni 1994 in einer Erklärung öffentlich dagegen, liturgische Feiern mit patriotischen Kundgebungen zu verbinden. Es wurde
empfohlen, bei nationalen Feiern Heber einen Wortgottesdienst oder Gebete abzuhalten, um die Heiligkeit der eucharistischen Feier zu erhalten.27
Wie weit darf nun die Liebe zur Nation und zum Vaterland gehen? Wie hat
man sich im Falle eines Krieges zu verhalten (so ein anderer Leserbrief im Jahr
1991)? Darf ein Christ mit Waffengewalt seine Heimat verteidigen? GK antwortet
klar: Man ist sogar zur Verteidigung verpflichtet. Es sei die heilige Pflicht jedes
Staatsbürgers, einem Aggressor bewaffneten Widerstand zu leisten, wenn die
Heimat bedroht ist und alle diplomatischen Wege ausgeschöpft sind.28
25
MlLE VIDOVIC Poslijeratni rad Crkve u Hrvata na oöuvanju hrvatske nacionalne svijesti, in:
GK (1992) Nr. 5, S. 3.
26 Zar opet covjek bez narodnosti, in: GK (1992) Nr. 39, S. 2.
27 A.H.: Keine patriotische Liturgie, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 7/8, S. 6-7.
28 Vjernik i oruzje, in: GK (1991) Nr. 4, S. 12.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
13
Die Vergangenheit der katholischen Kirche und die Rolle von Kardinal Stepinac
Eng verbunden mit der kroatischen Nation ist für GK auch die Auseinandersetzung mit der kroatischen Geschichte. GK bemüht sich dabei oft um Themen, die unter dem kommunistischen Regime tabu waren, insbesondere wenn es
um die Vergangenheit der Kirche geht und um die Verfolgungen, der sie unter der
Herrschaft Titos ausgesetzt war. Auch an der Erhellung von während des Zweiten
Weltkrieges begangenen Verbrechen hat GK großes Interesse. In den ersten
Themenkreis fällt beispielsweise eine Anfang 1995 begonnene Serie über die
staatliche Zensur, der alle Presse- und sonstigen Publikationen bis vor wenigen
Jahren unterworfen waren. Für die Thematik der Kriegszeit und der „Nezavisna
Drzava Hrvatska" (Unabhängiger Staat Kroatien, abgekürzt NDH), die 1941 auf
deutsche und italienische Initiative hin proklamiert wurde, wird relativ viel Raum
verwendet, da in diesem Zusammenhang viele Vorwürfe von serbischer Seite gegen die katholische Kirche erhoben werden und diese damit für den derzeitigen
Krieg zur Verantwortung gezogen wird. Ein Schwerpunkt in der gegenwärtigen
Diskussion der Kirche in der NDH bilden die sogenannten „Serbentaufen". GK
streitet dabei nicht ab, daß tatsächlich viele Serben zwangsweise dem Katholikentum zugeführt wurden und daß dies auch unter Mißbrauch kirchlicher Ämtern
geschah.29
Insgesamt ist die unter dem Tito-Regime unzureichend aufgeklärte und bewältigte Vergangenheit auch im jetzigen Konflikt insofern präsent, als sich in der
Bevölkerung - bei Serben wie bei Kroaten - über Jahrzehnte hinweg Vorurteile
und Schuldzuweisungen konservierten, die nun propagandistisch ausgenützt
werden. So wurde beispielsweise Anfang 1993 gegen den katholischen Erzbischof
in Serbien, Perko, der Vorwurf laut, er würde orthodoxe Gläubige in Serbien zu
Katholiken „umtaufen". Ein serbischer Politiker forderte in der Belgrader Tagespresse für dieses „Verbrechen am Serbentum" eine harte Bestrafung.30
Ein weiterer umstrittener Punkt sind die Verbrechen der Ustasa, d.h. der NDHFührung, im Konzentrationslager Jasenovac, wo Tausende von Regimegegnern
umgebracht wurden; dazu zählten neben Serben auch Kroaten und Juden. Die von
serbischer Seite vorgebrachten Zahlenangaben über die ermordeten Serben steigen in letzter Zeit inflationär, momentan spricht man, um die These des
„Genozides", den die serbische Nation nun abermals erleben müsse, zu untermauern, von über einer Million. Eine exakte Untersuchung über die Zahl der in
Jasenovac Ermordeten, beispielsweise über eine Erhebung ihrer Namen, ist bisher
nicht unternommen worden. Die früher von jugoslawischer Seite propagierte Zahl
von 700.000 Menschen unterschiedlichster Nationalität ist als „stark überhöht" zu
betrachten und „läßt sich mit den aus der Bevölkerungsstatistik ableitbaren Daten
29
Vgl. ZLATKO LATKOVIÖ Svecenik koji je „prekrstio" 2.586 pravoslavnih Srba, in: GK (1992)
Nr. 7, S. 13.
30 Vgl. A.H.: Erzbischof Perko beschuldigt, in: Glaube in der 2. Welt (1993) Nr. 5, S. 7.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
14
nicht einmal annähernd in Übereinstimmung bringen".31 Realistische Schätzungen
belaufen sich auf rund 60.000-80.000.32
Weiter wird von serbischer Seite gegen den Zagreber Kardinal Stepinac (18981960) wiederholt die Anschuldigung erhoben, gemeinsame Sache mit den kroatischen Faschisten unter dem NDH-Führer Ante Pavelic gemacht zu haben. Die
katholische Presse ist demgegenüber bemüht, die tatsächliche Rolle des damaligen Erzbischofs von Zagreb während des Zweiten Weltkrieges aufzuklären. Als
„Symbol des schuldlos beschuldigten Volkes" findet sich in GK eine Dauerserie
über sein Leben und Wirken. Stepinac, für den derzeit ein Seligsprechungsprozeß
angestrebt wird, gilt als wichtige Integrationsfigur in der kroatischen Geschichte,
weil er den Ideologien und Machthabern, mit denen er zeitlebens konfrontiert war,
entschiedenen Widerstand entgegenbrachte: Im Ustasa-Staat beschwerte er sich
über die Verfolgung von Zigeunern und Juden und verurteilte die Zwangskatholisierung, der die serbische Bevölkerung ausgesetzt war.33 Im Jugoslawien
Titos, wo er sich den Vorstellungen Titos über die katholische Kirche nicht unterordnete und wiederholt gegen die Verfolgung der Katholiken protestierte, wurde
er unter dem Vorwand der „Kollaboration" 1946 verhaftet und nach einem
Schauprozeß zu 16 Jahren Haft und Hausarrest verurteilt.
Stepinac kommt in der katholischen Kirche eine Vorbildfunktion zu: Er wurde
- so GK - nicht nur aus religiösen Gründen verfolgt, sondern auch aus nationalen,
wegen seiner großen Liebe zu seiner Heimat. Wie er einst werde das kroatische
Volk jetzt insgesamt bedrängt, weil es als Staatsnation anerkannt werden wolle.34
In GK ist ferner sogar von der „Stepincevska Crkva" (Stepinac-Kirche) die
Rede.35 Damit bezieht man sich nicht nur auf das, was Stepinac gesprochen und
für sein Land getan hat, sondern betont auch, daß sich die katholische Kirche in
Kroatien aus seinem Wirken entwickelte und darauf aufgebaut wurde.
Die Bedeutung des Papstes
Das katholische Eigenverständnis in Kroatien ist des weiteren durch die große
Bedeutung, die dem Papst zugemessen wird, gekennzeichnet. Anders als in
31
HOLM SUNDHAUSSEN
Geschichte Jugoslawiens 1918-1980. Stuttgart [u.s.w.] 1982, S. 122,
Anm.
32 Gegen den „Jasenovac-Mythos". Ein Kapitel jugoslawischer Vergangenheitsbewältigung, in:
Osteuropa-Archiv 40 (1990) S. 556-558.
33 Der jüdischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem wurde unlängst von jüdischer Seite eine
Dokumentation vorgelegt, die darlegt, wie Kardinal Stepinac in der Zeit des Zweiten Weltkrieges verfolgten Juden beistand und manchen sogar das Leben retten konnte - vgl. die
kurze Notiz Francuski kardinal - „Pravednik medju narodima", in: GK (1995) Nr. 10, S. 4.
34
35
Stepinac - simbol krivo optuzenog naroda, in: GK (1991) Nr. 7, S. 1 und 3, hier S. 3.
Stepincevski put kardinala Kuharica, in: GK (1994) Nr. 17, S. 2.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
15
Deutschland, wo das Oberhaupt aller katholischen Gläubigen vor allem an seinen
Aussagen zur Morallehre gemessen und kritisiert wird, gilt er in Kroatien als unbestrittene Autorität, die in keinerlei Zweifel gezogen wird. Daß der Papst, selbst
im Marxismus aufgewachsen, den kleineren Staaten in Ost- und Südosteuropa
nach dem Ende des Kommunismus eine moralische Stütze war, wird bei uns
jedoch weitgehend übersehen bzw. ist für uns irrelevant. Von großer Bedeutung
war daher der lang geplante Besuch des Papstes im September 1994 in Kroatien.
Vorher hatte der Vatikan auch Verhandlungen über einen Besuch in Serbien und
Bosnien geführt, doch dies war im Fall Bosniens zu gefährlich, außerdem verweigerte die serbische Orthodoxie eine Einladung nach Serbien. Die Begründung
lautete, daß die katholische Kirche enge Verbindungen zu den islamischen
Fundamentalisten unterhalte und der Papst an der Spitze einer internationalen
Kampagne gegen Serbien und die orthodoxe Kirche stehe.36 Trotz dieser
ablehnenden Haltung war der Papst bei seinem Besuch in Zagreb darauf bedacht,
versöhnliche Worte zu sprechen. So rief er in der Messe zu Vergebung gegenüber
den Feinden auf und betonte, daß diese ebenfalls um Verzeihung gebeten werden
müßten. Diese Aussagen wurden von den Gläubigen durch spontanen Beifall
gewürdigt.37
Die Ablehnung des Papstes und des Vatikans durch die serbische Orthodoxie
geht fast ins Irrationale, hat aber auch historisch greifbare Wurzeln: Im 19. Jahrhundert prägte der serbische Kirchengelehrte Nikolaj Velimirovic (1880-1956)
das Bild eines moralischen Verfalls in Europa. Zu diesem Mißstand habe der Vatikan wesentlich beigetragen.38 In der kommunistischen Zeit, in der die orthodoxe
Kirche nicht anders als die katholische erheblichen staatlichen Verfolgungen ausgesetzt war, galt der Vatikan wie auch die übrigen europäischen Staaten in den
Augen von serbischen Klerikern als Förderer des jugoslawischen Kommunismus.
Der Vorwurf neuesten Datums zielt darauf ab, daß der Vatikan das Auseinanderdriften der jugoslawischen Teilrepubliken und die „Separation" Sloweniens und
Kroatiens forciert habe und nun die Verantwortung dafür trage, daß die orthodoxen Serben nicht mehr in einem gemeinsamen Staat lebten und ihre Kulturgüter
zerstört werden.39
Ein anderer Umstand, der von der serbischen Seite als wie auch immer bedrohlich empfunden wird, ist die Tatsache, daß sich das Katholikentum als Weltkirche
36
Odjeci odbijanja SPC da Papa dode u Beograd. „Srpsko je pravoslavlje izrazito nacionalisticko", in: GK (1994) Nr. 34, S. 6.
37 W.G. Die kroatischen Katholiken und der Papstbesuch, in: Ost-West Informationsdienst
(1994) H. 184, S. 79-82, hier S. 81. Die Ansprachen anläßlich des Papstbesuches in Kroatien
sind abgedruckt in: Casopis za suvremenu povijest (1994) H. 2, S. 205-238.
38 ANNE HERBST Tod und Verklärung, in; Glaube in der 2. Welt 21 (1993) Nr. 4, S. 14-18, hier
S. 15.
39 Vgl. WOLFGANG GRYCZ Die Serbisch-Orthodoxe Kirche und der Krieg im ehemaligen
Jugoslawien, in: Ost-West Informationsdienst (1993) H. 179, S. 72-83.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
16
versteht, die als übernationale Institution an keine staatlichen Strukturen gebunden ist. Dahingegen hat sich die Orthodoxie in den verschiedenen Ländern immer
wieder an die politische Führung angelehnt, um ihre Interessen durchzusetzen.
Vielleicht ist es die Berufung auf den Papst und die Betonung seiner Bedeutung,
die den Argwohn orthodoxer Serben hervorgerufen hat, deren höchster kirchlicher
Vertreter selbst ein Serbe ist und nicht, wie bei den Katholiken, seinen Sitz im
Ausland hat.
Die Serben in Kroatien
Die Lage der orthodoxen Christen in Kroatien ist schwierig, weil sie mancherorts
ohne geistlichen Beistand leben müssen. Viele orthodoxe Geistliche sind aus
Kroatien emigriert, oftmals noch vor Ausbruch des Krieges, aus Furcht vor
Bedrohungen. Auch der orthodoxe Metropolit von Zagreb, Jovan, hatte 1991
Kroatien verlassen und lebte dann meist in Belgrad. Erst 1994 ist er zurückgekehrt, nachdem ihm von den kroatischen Behörden die Zuerkennung der
kroatischen Staatsbürgerschaft übergeben worden war.40
Von der katholischen Kirche wird die Situation der Serben in Kroatien ernstgenommen. Als vor kurzer Zeit im kroatischen Parlament, dem Sabor, von serbischen Abgeordneten die Klage vorgetragen wurde, serbische Kinder in Kroatien
würden in den katholischen Religionsunterricht gezwungen, ordnete Kardinal
Kuharic eine Untersuchung an, die genauere Hinweise über diese serbischen
Kinder erbringen sollte.41 Der Hintergrund ist, daß im Schuljahr 1992/93 in Kroatien Religion als Wahlpflichtfach eingeführt worden war. Dies bedeutete, daß die
Eltern am Anfang des Jahres individuell von den Schulen gefragt werden, ob ihre
Kinder den Religionsunterricht besuchen sollen oder nicht. Im Fall der Zustimmung durch die Eltern ist das Kind zur Teilnahme verpflichtet. Das neue Fach
wurde bisher nicht schlecht angenommen: 1994 besuchten in den Grundschulen
90%, in den Mittelschulen 50-60% der Schüler den Religionsunterricht.42 Zur
Klage serbischer Eltern kam es daher, weil serbische Schüler ebenfalls am
katholischen Religionsunterricht, in den viele ihrer Schulkameraden gingen, teilnehmen wollten und dies von ihren Eltern als immanenter Zwang aufgefaßt
wurde. Das Ergebnis der Untersuchung in der Diözese Zagreb war, daß hier
40
Dieser Akt war nötig, weil sich der Metropolit mit seinem alten jugoslawischen Paß nur sechs
Tage auf kroatischem Staatsgebiet hätte aufhalten dürfen - vgl. Bischof Jovan kehrt zurück,
in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 3, S. 8-9; Kardinal Kuharic predlaze zajednicki put
oprosta, in: GK (1995) Nr. 10, S. 1.
41 Ubrzo ce biti utvrdjene öinjenice, in: GK (1994) Nr. 45, S. 3; Z.K.: Ima li u Hrvatskoj pokatoliöenja srpske djece?, in: GK (1994) Nr. 47, S. 3. Zu den Klagen orthodoxer Gläubiger in
Kroatien vgl. auch: Druck auf Orthodoxe, in: Glaube in der 2. Welt 20 (1992) Nr. 7/8, S. 6.
42 A.H.: Stimme von der Basis, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 12, S. 4-5.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
17
tatsächlich serbische Kinder, allerdings lediglich eine relativ geringe Anzahl, den
katholischen Religionsunterricht besuchten. Die Mehrheit stammte aus serbischkroatischen Mischehen, nur in Ausnahmefällen kamen sie aus rein serbischen
Familien. Nach einem Treffen mit Kardinal Kuharic meldete jedenfalls der serbische Metropolit Jovan nach Belgrad, daß es keine Belege für eine angebliche
Kroatisierung serbischer Kinder in Kroatien gebe.43
Ein anderer Versuch seitens der katholischen Kirche, die Differenzen zwischen
Serben und Kroaten aufzuheben, besteht darin, bekannte Persönlichkeiten Kroaten und in Kroatien lebende Serben - an einen Tisch zu setzen und darüber
diskutieren zu lassen, welche Gemeinsamkeiten zwischen beiden Völkern bestehen.44 Dabei kommen die Parteien oft überein, daß zwischen beiden Völkern kein
Haß bestehen dürfe und daß übersteigerter Nationalismus eine gefährliche Bedrohung darstelle.
Regelmäßig werden auch konfessions- und nationsübergreifende Veranstaltungen durchgeführt. So beteiligten sich an einem im Januar 1994 abgehaltenen
Gebetstag in Zagreb neben der katholischen Geistlichkeit auch Vertreter der serbischen orthodoxen, der evanglischen, der jüdischen und der islamischen Religion.45
„Glas Koncila" und die Ökumene
Die kleineren Glaubensgemeinschaften in Kroatien
Im Gegensatz zur kommunistischen Zeit, wo GK über andere Religionen wenige
Berichte brachte, hat man nach Ausbruch des Krieges fast den Eindruck, als seien
alle Konfessionen in Kroatien näher zusammengerückt. Verstärkt erscheinen in
GK Artikel zum ökumenischen Gedanken. 1995 begann ab Nummer 4 eine weitere engagierte Serie über die Ökumene. Hier geht es in erster Linie darum, Gemeinsamkeiten der Glaubensrichtungen hervorzugeben, nicht deren Unterschiede.
Theologische Differenzen mit anderen Religionen sind aber insgesamt selten ein
Thema in GK.
GK betont immer wieder, daß die katholische Kirche zu den anderen
Konfessionen (Juden, evangelische Christen, Altgläubige, Muslime, aber auch
orthodoxe Serben) grundsätzlich gute Beziehungen aufrechterhalten will und
ANTUN SKVORCEVI^ Susret kardinala Kuharica i mitropolita Jovana, in: GK (1995) Nr. 10, S.
5; Velikosrpska propaganda ne odustaje, in: GK (1995) Nr. 14, S. 2; Nema podataka, in: GK
(1995) Nr. 8, S. 4.
44 GK (1991) Nr. 21, S. 7.
45 Gebets tag für Frieden - ökumenisch, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 2, S. 4-5.
43
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
18
muß. Bei den kleineren Religionsgemeinschaften ist dies anscheinend ohne größere Konflikte möglich. Insbesondere zum Judentum bemüht sich die katholische
Kirche um ein positives Verhältnis, wie auch umgekehrt dieser Wunsch vorgebracht wird. Bei offiziellen Anlässen stehen oftmals jüdische Vertreter Seite an
Seite mit Katholiken. Beim Neujahrsempfang der Staatsregierung 1991 äußerte
sich der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Nenad Porges, zufrieden über die
staatlichen Initiativen zum Bau des jüdischen Kulturzentrums mit einer Synagoge
in Zagreb. Zudem betonte er, daß das Schicksal der Juden in Kroatien eng verbunden sei mit dem Schicksal der Kroaten, daß jedoch kein Problem auf Dauer
mit Waffengewalt gelöst werden könne.46 Als 1994 in der kroatischen Tagespresse verschiedene Artikel mit antisemitischem Inhalt gedruckt wurden, brachte
Kardinal Kuharic seine offene Empörung darüber zum Ausdruck. Auch die von
GK dagegen unternommenen Anstrengungen wurden von dem Herausgeber der
Zagreber Zeitung „Erasmus", Slavko Goldstein, lobend hervorgehoben.47
Obwohl GK auch zu den übrigen Glaubensgemeinschaften - Adventisten,
Baptisten, Mormonen, Pfingstler, evangelische Gläubige - ein gutes Verhältnis
unterhalten will, wurden von diesen in letzter Zeit verschiedene Klagen geäußert.
Sie verlangten vor allem, daß ihnen ein besserer Zugang zu den Medien erlaubt
wird, daß sie das Recht auf Seelsorge in Krankenhäusern bekommen und daß ihre
zerstörten Kultstätten renoviert werden. Um ihre Interessen stärker durchzusetzen,
schlössen sie sich im Februar 1994 zu einer „kroatischen Vereinigung für Religionsfreiheit" zusammen.48 Über diese Gruppierungen ist in GK insgesamt nur
selten etwas zu lesen, am ehesten werden noch die griechisch-katholischen Christen (ihre Kriegsschäden sind in die Berichte zerstörter Kirchen miteinbezogen)
sowie die evangelischen Christen erwähnt, deren Vertreter oft bei ökumenischen
Treffen anwesend sind.
Die Orthodoxie
Die katholisch-orthodoxen Kontakte scheinen schwieriger zu pflegen und müssen
daher differenziert betrachtet werden. Auf der einen Seite stehen die lokalen orthodoxen Geistlichen. Sie werden von GK kaum negativ beschrieben, im Gegenteil: es wird sogar hervorgehoben, daß sie keine kriegsforcierende Kraft sind. Oft
seien sie selbst Opfer der serbischen Truppen, von denen sie für ihre Zwecke
instrumentalisiert würden. Darüber seien sich die Geistlichen auch selbst im
klaren, weil über sie Einfluß auf das Volk ausgeübt werden könne. In GK finden
sich außerdem Berichte darüber, daß orthodoxe Priester katholischen Geistlichen
46
47
48
Za godinu mirnog raspleta, in: GK (1991) Nr. 4, S. 7.
Antisemitische Presse, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 2, S. 6.
Nicht-Katholiken begehren auf, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 6, S. 7.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
19
in Gefangenschaft Trost zugesprochen und ihnen Hostien und Meßwein gebracht
haben, damit sie die Heilige Messe feiern konnten.49 Auch auf andere Art kommt
im GK zum Ausdruck, wie man die Rolle von Serben positiv bewertet, beispielsweise in einem Artikel über einen Appell von Serben aus Mostar, die in einem
offenen Brief um Hilfe für die Kroaten in Banja Luka bei den dortigen serbischen
Behörden nachsuchten.50
Anders verhält sich das Urteil von GK über hohe Würdenträger der serbischen
Orthodoxie. Hier ist eine sich wandelnde Einschätzung zu beobachten: So wurde
der serbische Patriarch Pavle nach seiner Einsetzung als höchster kirchlicher
Würdenträger, als Autorität, als Hoffnungsträger und Vermittler dargestellt, der
den Katholiken gegenüber aufgeschlossen sei. Es fanden verschiedene Treffen mit
Kardinal Kuharic statt; auch betete Pavle zusammen mit dem katholischen Erzbischof Perko von Belgrad für die im Krieg Gefallenen und schloß ausdrücklich
kroatische Opfer mit ein.51 Jedoch vollzog sich dann eine Veränderung der
Berichterstattung angesichts politischer Äußerungen Pavles, die von kroatischer
Seite nicht akzeptiert werden konnten. So schrieb der Patriarch einen Brief an
Lord Carrington, den damaligen Vorsitzenden der Friedenskonferenz von Den
Haag, in dem er äußerte, daß die derzeitigen Staatsgrenzen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken weder ethnisch noch historisch zu begründen seien,
weil sie von dem Kroaten Tito festgelegt worden seien, und daß nach der kroatischen Unabhängigkeitserklärung die Serben und Kroaten nicht mehr in einem
gemeinsamen Staat zusammenleben könnten.52 Er begründet dies damit, daß die
Serben in Kroatien jetzt den „zweiten Genozid" nach dem Genozid im
„Unabhängigen Staat Kroatien" 1941-1945 durchlebten. In einem kroatischen
Staat seien die Serben jetzt nicht mehr in der Lage, den Kroaten zu vertrauen. GK
reagierte auf diesen Vorstoß Pavles mit Unverständnis und dementierte die an die
kroatischen Seite gerichteten Vorwürfe: Pavle ignoriere die derzeitige tatsächliche
Srpski episkop donio hostije i vino zatocenom hrvatskom franjevcu, in: GK
(1992) Nr. 39, S. 8.
49
MARIJAN BRKIC
50
Srbi iz Mostara traze zastitu za Hrvate u Banjoj Lud, in: GK (1995) Nr. 8, S. 11.
In der serbisch besetzten Diözese Banja Luka in Nordbosnien, inmitten der von den Serben
proklamierten „serbischen Republik", ist der Terror gegen die Katholiken in letzter Zeit
besonders gewachsen. Sie soll offenbar völlig zerstört werden, um die dort seit Jahrhunderten
lebende kroatische Bevölkerung zur Abwanderung zu bewegen - vgl. Terror gegen Christen
in Banja Luka, in: FAZ (17. Mai 1995) Nr. 114, S. 7. Im Juni 1995 ordneten die serbischen
Truppen in der Region Banja Luka an, daß „alle Katholiken und Muslime" die Gegend zu
verlassen hätten (vgl. Jelzin gegen amerikanische Soldaten in Bosnien, in: FAZ [1. Juni 1995]
Nr. 126, S. 1-2, hier S. 2.) In dieser Formulierung klingt wieder an, in wie hohem Maß die
Nationszugehörigkeit mit der Konfession gleichgesetzt wird. Der Abdruck eines wiederholten
dramatischen Appells des Bischofs von Banja Luka, Franjo Komarica: Von aller Welt verraten und verkauft, in: Rheinischer Merkur (23. Juni 1995) Nr. 25, S. 24.
51 Molitva za pale Srbe i Hrvate, in: GK (1992) Nr. 7, S. 4.
52 Sto znacl tvrdnja da Srbi i Hrvati vise ne mogu zivjeti zajedno?, in: GK (1991) Nr. 46, S. 3.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
20
Lage, die vielen tausend muslimischen und kroatischen Flüchtlinge, die zerstörten
Dörfer und Kirchen und die auch an Kroaten verübten Massaker. Zudem wird
darauf verwiesen, daß die kroatischen Staatsgrenzen historisch gewachsen sind
und daß an ihrer Fixierung maßgeblich ein Serbe, nämlich der enge Tito-Mitarbeiter Milovan Djilas, beteiligt war.
GK dient also auch als Forum für Rechtfertigungen der katholischen Kirche,
die nicht nur auf Äußerungen des serbischen orthodoxen Klerus, sondern auch auf
andere serbische Publikationen reagiert, die nationalistische Züge tragen und politisch gegen die Kroaten mißbraucht werden können. Dazu kommen Nachrichten
aus Belgrad wie z.B., daß der Vatikan Kroatien mit Geld unterstützt habe oder
daß „Ustasa-Terroristen" mit Flugzeugen aus Deutschland losgeflogen seien und
Serben angegriffen hätten. Dementi auf Meldungen dieser Art sind GK deshalb
wichtig, weil die Zeitung befürchtet, daß die europäische Öffentlichkeit den
Schleier solcher Falschnachrichten nicht immer durchschaue.53 Diese Dementi
fallen GK insofern leicht, als nur darauf verwiesen werden muß, daß die vorgebrachten Anschuldigungen in der überwiegenden Zahl keine Beweise oder Belege
anführt.
Weiter kommt es in GK auch zur Auseinandersetzung mit der Presse der serbischen Orthodoxie und deren offiziellem Organ „Pravoslavlje".54 Schwierig ist
dies aber deshalb, weil die Redaktion von GK durch das Embargo gegen Serbien
keine Möglichkeit hat, die Zeitung offiziell zu beziehen - wie übrigens aus denselben Gründen auch für die Redaktion von „Pravoslavlje" nur selten die
Möglichkeit besteht, in den Besitz einer Ausgabe von GK zu gelangen. Wenn auf
Umwegen dennoch eine Nummer von „Pravoslavlje" nach Zagreb gelangt, stoßen
Artikel mit folgenden Überschriften hier auf massive Kritik: „Das orthodoxe
serbische Volk ist von Gott auserwählt, die westlichen Grenzen der Orthodoxie zu
bewachen". Damit fördere „Pravoslavlje" keineswegs das ökumenische Verständnis, so GK. In ähnlicher Weise wird ein Artikel kommentiert, der zum Inhalt hat:
„Nach dem Fall der gottlosen Regime in den orthodoxen Ländern befinden wir
uns vor dem Überfall der westlichen Kirchen gegen die Orthodoxie."55
GK erhebt aber von sich aus keine Vorwürfe an die serbische orthodoxe Kirche.
Die Mehrheit der Artikel in GK gegen die Orthodoxie sind Reaktionen auf übertriebene und offenbar bewußt verfälschte Äußerungen serbischer Propaganda. Der
Standpunkt von GK ist daher dezidiert als defensiv zu bezeichnen.
Weitere Angriffe auf die katholische Kirche kommen in letzter Zeit auch häufig
von der griechischen orthodoxen Kirche, wie von GK beklagt wird. Hier wurde
ebenfalls wiederholt der Vorwurf geäußert, der Papst unterstütze den Kampf ge53
54
55
Informacija za demokraciju, in: GK (1991) Nr. 8, S. 2.
Kurz zu „Pravoslavlje": „Pravoslavlje" - Blatt aller Serben, in: Glaube in der 2. Welt 20
(1992) Nr. 6, S. 10.
ZrVKO Kusnd: Novo srednjovjekovlje na srpski i grcki nacin, in: GK (1993) Nr. 43, S. 3.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
21
gen die Serben in Bosnien, indem er die bosnischen Muslime (warum eigentlich
nicht die Kroaten?) mit Waffen versorgen lasse.56 Die Verbundenheit zwischen
der serbischen und der griechischen Orthodoxie kam unlängst auch zum Ausdruck, als der Heilige Synod Serbiens den Orden des Heiligen Sava, seine höchste
Auszeichnung, dem griechischen Volk und der griechischen orthodoxen Kirche
verlieh.57
Weshalb die griechische und die serbische Orthodoxie einen gemeinsamen
Gegner in der katholischen Kirche erkannt haben, ist logisch nicht nachvollziehbar. Von anderen orthodoxen Landeskirchen am Balkan wie der bulgarischen oder
makedonischen sind keine vergleichbaren Vorwürfe zu vernehmen.
Der Islam
Eine weitere speziellere Charakterisierung erfordert das Verhältnis der katholischen Kirche zum Islam, mit dem die katholische Kirche in Kroatien durch die
vielen Flüchtlinge aus Bosnien momentan verstärkt konfrontiert wird. Auf der
theologischen Ebene erfährt der Islam eine neutrale Schilderung von GK. Er wird
nicht als aggressive Religion dargestellt, das Problem des Fundamentalismus, das
in diesem Zusammenhang sonst selten unerwähnt bleibt, stellt man kaum zur Diskussion.
Von den Muslimen in Kroatien selbst kommen zur kroatischen Staatlichkeit positive Signale. Wie ihr Vorsitzender Omerbasic betonte, freuten sich die Muslime
über die demokratische Entwicklung Kroatiens. Nur in einer Demokratie könne
das friedliche Zusammenleben aller Konfessionen garantiert werden. Nicht in allen jugoslawischen Republiken werden den Muslimen die verfassungsmäßig garantierten Menschen- und religiösen Rechte auch de facto zugestanden, so beispielsweise nicht im Kosovo.
In jüngster Zeit tauchen von muslimischer Seite aber auch kritische Töne und
Klagen auf, beispielsweise über die Verhältnisse in Flüchtlingslagern in Kroatien,
wo Muslime einer angeblichen „Kroatisierung" unterzogen würden. Sichtbar sei
dies daran, daß keine Räume für Gebete der Muslime zur Verfügung gestellt wurden oder daran, daß in einem Lager ein christliches Weihnachtsfest gefeiert
wurde. GK hat diese Anschuldigungen zurückgewiesen.58
Eng verbunden mit der Frage des Islam ist das Schicksal der kroatischen Nach56 Pravoslavni mitropolit proglasio Papu ratnim zloöincem, in: GK (1993) Nr. 39, S. 4.
57 A.H.: Orthodoxer Synod zieht Bilanz, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 7/8, S. 12-14,
hier S. 12
58 MARIJAN BRKIC U Z interview zagrebackog imama Mustafe Cerica. Alija spasio Hrvatsku?!,
in: GK (1993) Nr. 3, S. 13. Ob die von den Muslimen vorgebrachten Kroatisierungs-Vorwürfe indirekt mit denjenigen der Serben in Kroatien (vgl. oben S. 17f.) zusammenhängen,
sei dahingestellt.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
22
barrepublik Bosnien-Herzegowina, wo ebenfalls katholische Kroaten leben, allerdings gegenüber der muslimischen und serbischen Bevölkerung in der Minderheit. Die von der katholischen Kirche getragenen politischen Vorstellungen sehen
- entgegen der Konzeption serbischer und kroatischer Politiker - vor, die staatliche Einheit Bosnien-Herzegowinas beizubehalten. Dies betonte Kardinal Kuharic bei verschiedenen Gelegenheiten. Bosnien-Herzegowina müsse als Staat
erhalten bleiben, wie er international anerkannt und zudem Mitglied der Vereinten
Nationen sei. Serben, Kroaten und Muslime müßten weiter zusammenleben
können. Bosnien brauche Gerechtigkeit und Freiheit für alle und die Achtung der
Menschenrechte ohne Vorbehalte. Jeder Mensch habe das Recht, sicher und frei
dort zu leben, wo er geboren sei. In diesem Zusammenhang ruft Kuharic mit
scharfen Worten die Kriegstreiber zu ihrer Verantwortung auf. Es gebe keine
Berechtigung für begangene Verbrechen; es gebe zwar das Recht des Menschen,
sein Leben und sein Recht zu verteidigen, aber nur in den Grenzen der ethnischen
Normen. Daher verurteile er jedes Kriegsverbrechen, egal von wem es begangen
wurde.59
Auch der Vatikan bekundete sein Bemühen, Bosnien-Herzegowina in seiner
staatlichen Einheit beizubehalten. Zwei Wochen nach der Europäischen Gemeinschaft erkannte er im August 1992 die Republik staatsrechtlich an,60 am 11. Juni
1993 wurde Erzbischof Francesco Monterisi als Nuntius nach Sarajevo entsandt.
Bei dem zeitgleich stattfindenden Besuch des bosnischen Präsidenten Izetbegovic
im Vatikan forderte der Papst, die Kämpfe einzustellen und trat für Verhandlungen und Dialog unter den Kriegsgegnern ein.61
Energisch gegen die Aufteilung Bosnien-Herzegowinas wandten sich ebenfalls
die serbischen orthodoxen Bischöfe, jedoch wurde dieser Schritt von den nichtorthodoxen Kirchen sehr kontrovers diskutiert. In einem Appell vom 5. Juli 1994
riefen nämlich die serbischen Geistlichen die gesamte serbische Nation dazu auf,
sich für die Verteidigung ihrer jahrhundertealten Rechte und Freiheiten in Bosnien selbst aufzuopfern, um zu verhindern, daß das serbische Volk und seine geistige Existenz erneut dezimiert werde.62
Die Kriegsdarstellung in „Glas Koncila"
Der Krieg mit allen Folgen und Begleiterscheinungen ist das beherrschende
Thema in den letzten Jahren in GK. Innerhalb Kroatiens begannen die ersten
59
60
61
62
Aufruf von Kardinal Kuharic, in: Glaube in der 2. Welt 21 (1993) Nr. 6, S. 5.
R. PERIC Sveta Stolica priznala drzavu Bosnu i Hercegovinu, in: GK (1992) Nr. 35, S. 1.
Vatikan stützt Einheit, in: Glaube in der 2. Welt 21 (1993) Nr. 7/8, S. 3.
A.H.: Reaktionen auf orthodoxen Appell, in: Glaube in der 2. Welt 22 (1994) Nr. 9, S. 10.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
23
militanten Handlungen, als sich im Jahr 1990 die serbische Bevölkerung in der
Krajina bewaffnete und Straßensperren errichtete. Bereits anläßlich dieser Vorgänge wurden von kroatischen Geistlichen wiederholt Appelle für den Frieden
und für einen gemeinsamen Dialog zur Konfliktbeilegung unternommen.
Nachdem die Parlamente Sloweniens und Kroatiens am 26. Juni 1991 die Unabhängigkeit ihrer Länder erklärt hatten, erfolgte die Intervention der jugoslawischen Volksarmee in Slowenien. Bischöfe aus ganz Jugoslawien erklärten
auf einer Versammlung in Zagreb, daß das bewaffnete Vorgehen gegen demokratische Kräfte die Menschenrechte und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung verletze.63 Nach dem Referendum vom 19. Mai 1991, in dem die
Einwohner Kroatiens den Wunsch nach kroatischer Eigenstaatlickeit demjenigen
nach einer Konföderation innerhalb Jugoslawiens den Vorzug gaben, fielen die
ersten Opfer: 13 kroatische Polizisten in Borovo Selo.
In der weiteren Berichterstattung ist in GK eine bestimmte Entwicklung zu
beobachten: Bei Ausbruch der Kämpfe in Slawonien (Vukovar), in der Krajina
und in Plitvice findet man noch eingermaßen ausführliche Berichte über die
Kriegshandlungen selbst. Zu diesem Zeitpunkt war die Zahl der Opfer noch gering, teilweise waren sie sogar noch namentlich bekannt. Dann eskalierte der
Krieg in Bosnien, die Situation wurde immer unüberschaubarer. Damit verloren
auch die Berichte über den militärischen Verlauf an Präzision, eine andere Perspektive wurde immer stärker herangezogen, nämlich diejenige der Opfer. Die
Darstellung wurde insgesamt auf ein abstrakteres Niveau gehoben.
Ein ähnlicher Vorgang ist in einer zunehmenden Abstrahierung der Sprache in
GK zu beobachten: Anfangs war der Schrecken noch größer, die Vorgänge waren
rational und logisch nicht erfaßbar, wofür eindeutige, radikale und emotionale
Worte verwendet wurden. Anfangs fanden sich manchmal noch an die Leidensgeschichte Jesu erinnernde Ausdrücke wie das „Kalvarien der Kroaten", ihr
„Golgotha" oder auch „Genozid", aber mit der Zeit wurde die Berichterstattung
vorsichtiger und dieses Vokabular wurde weitgehend aufgegeben. Festgesetzt
haben sich hingegen die aus dem sonst üblich gewordenen Sprachgebrauch
übernommenen Bezeichnungen wie „die Aggressoren", „cetnici" (Freischärler)
usw., die aus der Tradition der balkanischen Partisanenkämpfe stammen.
Das in GK abgedruckte Bildmaterial ist nicht brutal oder auf Schockierung der
Leser aus. Oftmals beschränkt es sich auf zerstörte Kirchen. Photos von Verletzten oder Leichen wie in anderen Zeitungen finden sich nicht. Wünschenswerte
Kriegsziele werden ebensowenig aufgelistet wie Aufrufe zu militärischen Eroberungen oder Durchhalteparolen für die kämpfenden Einheiten. Zu deren Unterstützung wird nur über Aktivitäten kirchlicher Vertreter berichtet, die Messen für
Soldaten halten und Besuche im Kampfgebiet durchführen.
Allerdings tritt ein anderes Moment in den Vordergrund: Die Kriegsopfer kom63
Nemoral vojnoga nasilja, in: GK (1991) Nr. 27, S. 1
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
24
men selbst zu Wort. Sie schildern ihre Erlebnisse während serbischer Angriffe in
Bosnien oder ihre Haft in Konzentrationslagern. In einem solchen Bericht stellte
beispielsweise ein katholischer Geistlicher, der einige Wochen in einem serbischen Lager eingesperrt war und mißhandelt wurde, seine Erlebnisse sehr emotionslos und sachlich dar. Er predigte keinen Haß auf seine Peiniger, gab sich nicht
als Märtyrer und erklärte, daß er nicht wegen seines Glaubens verfolgt worden
sei, sondern aus einem handfesteren Beweggrund heraus: Er sollte einerseits strategisch-militärisch relevante Informationen liefern, andererseits als Geisel fungieren, um gegen kriegsgefangene Serben eingetauscht zu werden.64
Allgemein wird der Krieg im ehemaligen Jugoslawien von Kardinal Kuharic als
ein Krieg gegen die Menschheit und gegen jegliche menschliche Zivilisation
charakterisiert. Er werde geführt aus einem blinden Haß, der sich über lange Zeit
angestaut habe. Verstärkt werde dieser durch die politische Propaganda. Der
Teufelskreis könne nur im Sinne des Evangeliums überwunden werden, nämlich
durch das Verzeihen auch demjenigen gegenüber, der Leid verursacht habe.
Einzig durch das Verzeihen könne die Kette des Todes unterbrochen werden.65
Insgesamt finden sich in GK keine Haßtiraden gegen die serbischen Eroberer,
keine Kollektivbeschuldigung gegen das serbische Volk. Es werden sogar Vergehen auch der eigenen Seite eingeräumt. Rache wird nie gefordert, hingegen werden Aufrufe von Geistlichen zur Hoffnung, aber auch zum Verzeihen abgedruckt.
Gerade dieser Punkt ist bemerkenswert, denn die Zeit und die Umstände, unter
denen GK publiziert, sind keinesweg normal: Kroatien befindet sich in einem
Krieg, der dem Volk und den Gläubigen nach wie vor große Opfer abverlangt. In
einer solchen Situation auf jegliche Aggressivität im Ausdruck zu verzichten und
im Gegenteil sogar zu Mäßigung und zum Verzeihen aufzurufen, ist ein Zeichen
davon, daß sich die Zeitung ihrer Verantwortung bewußt ist und ihr gerecht
wird.66
Schlußbewertung
Als Fazit ist zur Haltung von GK insgesamt folgendes zu sagen: GK versteht als
kirchliche Zeitung ihre Aufgabe in erster Linie darin, christliches Gedankengut zu
verbreiten. Daß sie dabei als katholisches Organ insbesondere katholische Interessen vertritt, ist legitim. Was ihre Einbettung in das politische Umfeld in Kroatien
angeht, so wehrt sie sich entschieden dagegen, einerseits von der Politik verein64
65
66
„Stavite ga pred zid i strijeljajte ga", in: GK (1992) Nr. 5, S. 8.
Oprastanje prekida lanac smrti, in: GK (1995) Nr. 13, S. 13.
Zu einer positiven Einschätzung der kirchlichen Berichterstattung in Kroatien über den Krieg
kommt auch: ANNE HERBST Tod und Verklärung. Die Orthodoxe und die Katholische Kirche
im südslawischen Konflikt, in: Glaube in der 2. Welt 21 (1993) Nr. 4, S. 14-18, hier S. 16.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
25
nahmt zu werden, andererseits selbst politische Standpunkte zu formulieren, es sei
denn, wenn christliche Werte, die Menschenrechte oder die Würde des Menschen
bedroht werden.
Ein Beleg für den politisch-unabhängigen Standpunkt von GK ist die Auseinandersetzung mit der Presse und den Politikern im Land. Dies ist einerseits ein Zeichen dafür, daß die Kirche unbequeme Positionen einnimmt, aber andererseits ein
Beleg dafür, daß in Kroatien politische Diskussionen möglich sind und offen
geführt werden können. Dies darf also auch als positives Signal gewertet werden,
daß Regierung, Presse und Kirche in Kroatien keine einheitliche Front bilden,
sondern interagieren und aufeinander Bezug nehmen. Für die kirchliche Presse hat
dies ebenfalls nicht nur den negativen Effekt, daß sie dauernd mit Argusaugen beobachtet wird. Positiv ist, daß sie somit gezwungen wird, ihre eigenen Positionen
und diejenigen der Politik ständig zu prüfen und zu überdenken. Dies mag in
einem pluralistischen Staat grundsätzlich schwerer sein als zu Zeiten des
Kommunismus, als zwar der staatliche Druck auf GK ungleich größer als heute
war, dafür aber auch klar war, wer der Gegner war und wo er stand.
Der eigentliche Gewinner dieser Auseinandersetzung ist - und dies wird im
Interesse von GK sein - die Leserschaft. Dieser kann es selbst überlassen bleiben,
für welche Position sie sich entscheidet, oder ob sie von einem absoluten Standpunkt abrückt und eine differenziertere Haltung annimmt.
Eine Aufgabe von GK ist, in der kroatischen Presselandschaft den katholischen
Standpunkt zu vertreten. Die weitere, nicht weniger wichtige Aufgabe besteht in
der Auseinandersetzung mit Falschmeldungen anderer Medien, die es zu widerlegen gilt. Dies erscheint GK vor allem deshalb wichtig, weil verhindert werden
soll, daß die Weltöffentlichkeit von serbischer Propaganda überfrachtet wird, wie
GK befürchtet.
In der Art der Darstellung ist GK auf einen moderaten Ton bedacht. Dies zeigt
sich auch in der Beschreibung des derzeitigen Krieges: Er wird nicht als Religionskrieg dargestellt, auch nicht als Krieg, der nur und ausschließlich gegen die
Kroaten und Katholiken geführt wird. Dabei ist in GK nicht nur die Rede davon,
daß man Kriegsverbrechen insgesamt verurteilt, sondern man ist auch bereit, zuzugestehen, daß von allen Seiten, auch von den Kroaten, Verbrechen begangen
wurden. Es wird also kein einseitiges Schwarz-Weiß-Klischee aufgestellt, wie es
derzeit oftmals anzutreffen ist.
Kriegsberichterstattung gibt es keine. Dafür kommen in vielen Reportagen individuelle Schicksale zum Tragen. Hier wird in erster Linie die Not und Verfolgung
Einzelner dargestellt, vielleicht als Trost für die unzähligen anderen Leidtragenden. GK geht also in der Berichterstattung wie schon zu Zeiten des Kommunismus auf die Gläubigen ein, nicht auf die Bedürfnisse des Staates. Insgesamt
vermeidet GK jegliche Konfliktdarstellung, dies betrifft auch die Diskussion mit
anderen Konfessionen.
Zwar kann GK vom christlichen Selbstverständnis her eigentlich nicht anders,
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
26
als auf Toleranz zu verweisen. Dies ist aber dennoch nicht ganz selbstverständlich, weil GK in einer Zeit publiziert, in der Kroatien einen Krieg führen muß,
dessen Folgen nicht nur von der politischen, sondern auch von der geistigen bzw.
geistlichen Führung große Entbehrungen abverlangt und in dem gezielt kirchliche
Vertreter die Opfer militärischer Gewalt werden. Der eigentliche Feind der
Katholiken aber, das betont GK immer wieder, sei der Haß, das Ziel aller Katholiken könne nur ein gerechter Friede und zwar für alle Menschen guten Willens
sein.
Zusammengefaßt ist sich GK der Verantwortung bewußt, die es als Presseorgan
besitzt, und diese Verantwortung ist sicher nicht gering, wenn man bedenkt, daß
sich die Menschen in Notzeiten immer auf den Glauben und auf die Kirche zurückbesonnen haben und auch jetzt wohl auf deren Publikationen verstärkt zurückgreifen.
Insgesamt wird die Kirche bei der Beendigung des militärischen Konfliktes nur
eine schwache Rolle einnehmen können. Zudem steht sie ständig in der Gefahr,
für Kriegsziele propagandistisch ausgenützt zu werden. Der Ansicht von Kardinal
Kuharic kann man sich sicherlich anschließen, wenn er sagt, die Kirchen im ehemaligen Jugoslawien hätten einander den Krieg nicht erklärt, deshalb könnten sie
ihn auch nicht beenden. Der Krieg werde aus politischen Gründen geführt. Die
gemeinsamen Zusammenkünfte mit dem serbischen Patriarchen hätten keinerlei
Wirkung in der Politik gezeigt. Für die Landeroberungen seien Menschen verantwortlich, die dem Rat der Kirche nicht zugänglich seien.67
Die eigentliche Aufgabe der Kirchen während des militärischen Konfliktes liegt
im Bereich der allgemeinen Seelsorge und der Fürsorge für die Kriegsopfer. Hier
ist ihre Hilfe weiter unentbehrlich.
67
BREMER AUS der Römisch-Katholischen Kirche in Kroatien [vgl. Anm. 1], S. 118.
Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 6/1995
2,1
OSTEUROPA-INSTITUT
MÜNCHEN
Mitteilungen
Bisher erschienen:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
FREDDY LITTEN Britische und amerikanische Aktenpublikationen zu Ostasien im 19. und
20. Jahrhundert. Ein Führer zu Mikroform-Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek und
der Staatsbibliothek zu Berlin.
BENEDIKT PRAXENTHALER Aktenbestände über die Wolhyniendeutschen im Gebietsarchiv
Zytomyr.
GESINE-FRUNDER-OVERKAMP In Vorbereitung befindliche Universitätsschriften aus der
Geschichte Osteuropas- und Südosteuropas. Verzeichnis 1994 (33. Ausgabe).
HERMANN BEYER-THOMA International Bibliography on Pre-Petrine Russia for 1993.
BERNHARD KOTSCH Reaktionen der EG und der NATO auf die Transformationsprozesse
in Mittel- und Osteuropa am Beispiel der Tschechoslowakei/Tschechischen Republik. Das
Europa-Abkommen und die Partnerschaft für den Frieden.
KATRIN BOECKH Die „Stimme des Konzils". Die kirchliche Presse in Kroatien und der
Jugoslawienkonflikt.
Bayerische
J
Staatsbibliothek I
München
I
In Vorbereitung:
- REINHARD FRÖTSCHNER, MARKUS OSTERRIEDER Das Bild des Krieges in Altrußland und PolenLitauen im 16. Jahrhundert.
- Eine Bibliographie der neuesten Literatur zur Entwicklung in den ehemaligen Ostblockstaaten
von REINHARD FRÖTSCHNER.
- Ein Verzeichnis der bisher am Osteuropa-Institut München in eine Datenbank aufgenommenen
Personen aus dem Amburger-Archiv (etwa 60.000 Namen).