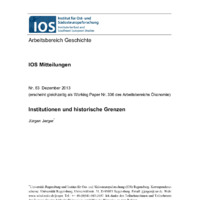Institutionen und historische Grenzen
Item
- Title
- Identifier
- Creator
- has publication year
- Is Part Of
- volume
- has URL
- extracted text
-
Institutionen und historische Grenzen
-
BV041567478
-
Jerger, Jürgen
-
2013
-
IOS-Mitteilungen
-
63
-
https://www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_63.pdf
-
https://langzeitarchivierung.bib-bvb.de:443/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE578866
-
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63248-8
-
Arbeitsbereich Geschichte
IOS Mitteilungen
Nr. 63 Dezember 2013
(erscheint gleichzeitig als Working Paper Nr. 336 des Arbeitsbereichs Ökonomie)
Institutionen und historische Grenzen
Jürgen Jerger*
* Universität Regensburg und Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg. Korrespondenz-
adresse: Universität Regensburg, Universitätsstr. 31, D-93053 Regensburg. Email: j.jerger@ ur.de. Web:
www.wiwi.uni-r.de/jerger. Tel.: ++ 49-(0)941-943-2697. Ich danke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Tagung für eine lebhafte Diskussion und hilfreiche Hinweise zu dem Referat.
Beitrag zur Jahrestagung 2013 des Ausschusses für Institutionenökonomik des Vereins für Socialpolitik,
22. – 24. 9. 2013.
Landshuter Straße 4
D-93047 Regensburg
Telefon: (09 41) 943 54-10
Telefax: (09 41) 943 54-27
E-Mail: info@ios-regensburg.de
Internet: www.ios-regensburg.de
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung .................................................................................................................. v
Abstract ......................................................................................................................... v
A Einleitung ................................................................................................................. 1
B Zur Bedeutsamkeit von Grenzen und historischen Entwicklungen in der
(ökonomischen) Literatur .......................................................................................... 4
I Überblick ............................................................................................................... 4
II Zur Bedeutung von Grenzen ................................................................................ 5
III Zur Rolle der Geschichte in der ökonomischen Forschung ................................. 8
C Historische Grenzen und unscharfe Grenzen ......................................................... 13
I Ein konzeptioneller Rahmen ............................................................................... 13
II Empirische Befunde ............................................................................................ 17
D Fazit ........................................................................................................................ 22
Literatur........................................................................................................................ 23
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1
Historie, Institutionen und unscharfe Grenzen ...................................... 3
Abbildung 2
Das Krugman (1991b)-Modell ............................................................... 9
Abbildung 3
Aktuelle und historische Grenzen ......................................................... 13
Abbildung 4
Formelle Institutionen, informelle Institutionen und historische Grenzen ... 15
Abbildung 5
Habsburg und die heutigen Staaten Mittel- und Osteuropas ................ 19
Kurzfassung
Die Wirksamkeit aktueller (politischer) Grenzen einerseits und historischer Ereignisse für
aktuelle Aspekte der gesellschaftlichen und ökonomischen Realität andererseits ist in den
Wirtschaftswissenschaften und anderen Disziplinen sowohl in der theoretischen als auch
in der empirischen Forschung unbestritten und in zahlreichen konkreten Kontexten belegt.
Etwas überraschender sind hingegen einige Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass historische Grenzen langanhaltende und bis in die Gegenwart wirksame Einflüsse ausüben. In
diesem Beitrag wird argumentiert, dass die Erklärung dieser Befunde eine ebenso anspruchsvolle wie potentiell lohnende Herausforderung für die institutionenökonomische
Forschung im Speziellen und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Allgemeinen ist.
Abstract
The relevance of (political) borders on the one hand and of historical conditions on the
other hand for some of today’s aspects of economic and social reality is well established
in both theoretical and empirical research in economics as wel as in other disciplines.
More surprising are empirical results that point to a long-lasting relevance of historical
borders that may still exert causal on effects on present conditions and observations.
This paper argues that the explanation of these effects is a demanding, albeit potentially
very rewarding challenge for institutional economics in particular and an interdisciplinary research program in general.
v
Institutionen und historische Grenzen
A Einleitung
Wo immer wir an eine Grenze zu geraten
und festen Fuß zu fassen vermeinen, gerät
sie in Bewegung und entgleitet uns.
Blaise Pascal, Gedanken
Das einleitende Zitat von Blaise Pascal bezieht sich auf gedankliche Grenzen, auf Beschränkungen, denen Denkprozesse vermeintlich oder tatsächlich ausgesetzt sind, die
aber undeutlich und fließend werden, sich also verändern, sobald man an sie stößt. Es
wird in diesem Beitrag nicht um Betrachtungen zu Denkvorgängen gehen. Das Zitat
ist aber deswegen so passend, weil Grenzen in der (nicht nur für Ökonomen) alltäglicheren Bedeutung der Demarkationslinie zwischen zwei souveränen Staaten – oder
anderweitig regional abgegrenzten geographischen Einheiten – in der empirischen
Forschung eine ganz ähnliche Eigenschaft gezeigt haben. Sobald man sich näher mit
Grenzen bzw. den durch sie definierten Gebieten befasst, werden diese als empirischkonzeptionelles Gebilde recht elusiv, und es zeigen sich einerseits überraschende und
nicht einfach zu erklärende Unterschiedlichkeiten innerhalb von Grenzen und andererseits Ähnlichkeiten über Grenzen hinweg. Anders gesagt: Politische Grenzen bzw.
Staatsgrenzen sind je nach Untersuchungsgegenstand nicht notwendigerweise die empirisch relevante(ste)n Linien. Dieses Phänomen sei im Folgenden der Einfachheit
halber als „unscharfe Grenze“ bezeichnet.1
Eine Hypothese dieses Beitrags ist, dass institutionelle Faktoren – was hier zunächst
bewusst so breit gefasst sein soll – zur Erklärung unscharfer Grenzen beitragen können,
oder – anders gewendet –, dass unscharfe Grenzen ein interessantes und potentiell ertragreiches Forschungsfeld für die empirische Analyse von Institutionen und deren
Wirksamkeit darstellen. Diese Hypothese bedingt natürlich, dass jedenfalls bestimmte
1
Der Verwendung des Begriffs „unscharfe Grenze“ (englisch: „blurred boundary“) ist in den Geisteswissenschaften und in der Rechtswissenschaft verbreitet, wird dort allerdings in aller Regel nicht mit
geographischen Konstruktionen in Verbindung gebracht, siehe z. B. Reckwitz (2008). Erst kürzlich
wurde ein von der VW-Stiftung finanziertes interdisziplinäres Forschungsprojekt mit dem Thema
„Vernünftiger Umgang mit unscharfen Grenzen – Vagheits- und Unbestimmtheitsphänomene als Herausforderung für Philosophie und Recht“ zum Abschluss gebracht, siehe dazu: http://unscharfegrenzen.de/node/1396
1
IOS Mitteilung Nr. 63
Aspekte institutioneller Qualität innerhalb heutiger Staaten heterogener sind als über die
Grenzen hinweg. Genau dafür gibt es aber empirische Evidenz, deren weitere
Beforschung hier propagiert werden soll.
Mit der letzten Überlegung ist der relativ offensichtliche Punkt geklärt, dass Grenzen
ein Potential zur Analyse von Institutionen bieten. Die Präzisierung „historische Grenzen“ ist jedoch noch erläuterungsbedürftig. Zunächst ist hier die Feststellung zu treffen,
dass gerade in Europa – und ganz besonders in Mittel- und Osteuropa – politische
Grenzen in der Geschichte starken Änderungen unterworfen waren. Viele Regionen
oder Städte gehörten im Laufe der Geschichte unterschiedlichen politischen Gebilden
an. Diese Tatsache führte einerseits dazu, dass sich heutige Staaten aus Gebieten zusammensetzen, deren historische Entwicklung teilweise sehr unterschiedlich war. Andererseits entstanden dadurch auch Regionen, die heute unterschiedlichen Staaten angehören, die aber – jedenfalls über bestimmte Zeiträume – eine vergleichsweise homogene
historische Entwicklung aufweisen.
Bringt man das Phänomen der unscharfen Grenze mit dieser Beobachtung zusammen, so ergibt sich sofort eine weitere Hypothese: Unterschiede innerhalb heutiger
Staaten und Ähnlichkeiten zwischen Regionen in verschiedenen Staaten können als
Ergebnis historischer Entwicklungen und Gegebenheiten verstanden werden. Der Begriff „historische Gegebenheiten“ ist natürlich sehr umfassend; eine – wenn auch sicherlich nicht die einzige – Möglichkeit der Konkretisierung ist der Blick auf historische Grenzen. Historische Grenzen – genauer: politische Grenzen in der Vergangenheit – gehen üblicherweise einher mit in der Vergangenheit unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen, deren Wirksamkeit jedenfalls potentiell nicht mit dem
Ende eines politischen Gebildes aufhört. Damit sind historische Grenzen eine mögliche Ursache für das Phänomen der unscharfen Grenzen, wobei die (jedenfalls auch)
historisch bedingten Ausprägungen und Qualitäten von Institutionen als Übertragungsmechanismus wirksam sein können.
2
Institutionen und historische Grenzen
Abbildung 1 fasst diese Überlegungen zusammen.
Historische Gegebenheiten
(Grenzen)
Institutionelle Qualität/
Ausprägungen
Unscharfe Grenzen
Abbildung 1 Historie, Institutionen und unscharfe Grenzen
Der Rest des Beitrags gliedert sich wie folgt: In Abschnitt B wird zunächst die ökonomische Literatur zur Relevanz von Grenzen und historischer Entwicklung aufgearbeitet. Abschnitt C behandelt dann den möglichen Zusammenhang zwischen dem Phänomen unscharfer Grenzen einerseits und historischen Grenzen andererseits. Ein kurzes
Fazit wird in Abschnitt D gezogen.
3
IOS Mitteilung Nr. 63
B Zur Bedeutsamkeit von Grenzen und historischen Entwicklungen
in der (ökonomischen) Literatur
I Überblick
Vor allem zwei Bestandteile der in der Einleitung genannten Zusammenhänge sind
empirisch wie theoretisch bestens abgesicherte Wissensbestandteile, sowohl innerhalb
der ökonomischen Literatur als auch in sozial- und geisteswissenschaftlichen Nachbardisziplinen. Die beiden zentralen Beobachtungen können in ihrer knappsten Form
als 3-Wort-Sätze zusammengefasst werden:
1) Grenzen sind relevant.
2) Geschichte ist relevant.
Es wurde hier bewusst jede einschränkende Charakterisierung weggelassen, welche
Aspekte von Grenzen und Geschichte wofür genau relevant sind, um die in der Tat sehr
breite empirische Basis für die Richtigkeit dieser Statements zu betonen, die so wenig
strittig sind, wie dies für sozialwissenschaftliche Befunde überhaupt denkbar ist. Die
beiden Beobachtungen sind überdies disziplinenübergreifend von Interesse, neben den
Wirtschaftswissenschaften trifft dies insb. für Politik- und Geschichtswissenschaft zu.
In beiden Disziplinen ist der Erkenntnisgegenstand „Grenze“ sehr wichtig, historische
Entwicklungen und deren Wirksamkeit über die Zeit sind dies ohnehin.
Die in Abb. 1 zusammenfasste Kausalkette verbindet letztlich nur die Bestandteile 1)
und 2) zu einer weitergehenden Behauptung, nämlich
3) Historische Grenzen sind relevant.
Selbstverständlich ist 3) kein logisch zwingendes Implikat von 1) und 2). Allerdings
braucht es für die Gültigkeit der Aussage 3) „nur“ Befunde und Wirkungskanäle, die
zeigen und erklären, dass bzw. warum historische Gegebenheiten innerhalb einer früheren Grenze langfristig und insb. über den Wegfall dieser Grenze hinaus wirksam sein
können. Ohne schon konkrete Kanäle zu benennen, reicht hier der Hinweis darauf, dass
das Konzept der „Pfadabhängigkeit“ in der ökonomischen Analyse bestens etabliert ist.
Dabei geht es aber genau um die langfristige Wirksamkeit von zeitlich möglicherweise
weit zurückliegenden Determinanten heute zu beobachtender Phänomene; diese Wirk-
4
Institutionen und historische Grenzen
samkeit kann insb. auch dann noch anhalten, wenn die ursprünglichen Determinanten
für diese Zustände gar nicht mehr gegeben sind.2
In den beiden folgenden Abschnitten wird nun jeweils über die Bedeutung von Grenzen und historischer Gegebenheiten etwas genauer berichtet.
II Zur Bedeutung von Grenzen
Die Bedeutung von Grenzen ist aus ökonomischer Sicht eine schlichte Selbstverständlichkeit. Andernfalls würden ganze Subdisziplinen wie die Außenhandelstheorie, die
Währungs- und Wechselkurstheorie und auch die Regionalökonomie in Ermangelung
eines Erkenntnisgegenstandes nicht einmal existieren. Die eine Grenze konstituierenden Merkmale werden in diesen Feldern typischerweise qua Annahme gesetzt bzw.
sind in empirischen Anwendungen ein exogenes politisches Datum. So wird in Außenhandelsmodellen häufig angenommen, dass es über Grenzen hinweg keine Faktor-,
wohl aber Güterströme geben kann – was jedenfalls so lange gerechtfertigt ist, wie
grenzüberschreitende Faktorströme relativ zu den entsprechenden Güterströmen von
untergeordneter Bedeutung sind. Und abgesehen von den Überlegungen zu optimalen
Währungsräumen wird die Existenz einer nationalen Währung durchweg als weiter
nicht erklärungsbedürftiges institutionelles Faktum im Rahmen der Wechselkurstheorie behandelt. Im Kontext der Analyse unscharfer Grenzen sind jedoch weniger diese
theoretischen Zugänge relevant als die Forschung zur empirischen Bedeutsamkeit von
Grenzen.
Bevor auf diese Literatur kurz eingegangen wird, soll darauf hingewiesen werden,
dass viele ökonomische und andere Größen auf der staatlichen Ebene einfach wahrgenommen werden, was den nationalen Grenzen bereits dann eine eigene Relevanz
gäbe, wenn sie keinerlei faktischen Auswirkungen hätten. Mit Blick auf das Phänomen unscharfer Grenzen ist dies auch deshalb wichtig, weil die auf staatlicher Ebene
2
Die Idee der Pfadabhängigkeit fand in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre sehr prominente Beachtung
in der Beschäftigungstheorie, siehe z.B. die Beiträge in Cross (1988) sowie die Aufsätze von Blanchard/Summers (1986), Franz (1987) und Alogoskoufis/Manning (1988), wird aber auch in ganz anderen
Feldern benutzt, so z.B. – und naheliegenderweise in der Investitionstheorie (Dixit 1992) – , aber auch in
der Theorie institutioneller Entwicklungen (Dopfer 1991).
5
IOS Mitteilung Nr. 63
gemessenen Größen einen „unechten“, d. h. wenig aussagekräftigen Durchschnitt
heterogener substaatlicher Regionen darstellen können – was häufig auch tatsächlich
der Fall ist.
Eine der klassischen Studien für die Bedeutsamkeit nationaler Grenzen für ökonomische Interaktionen ist das Papier von John McCallum (1995). Er konnte zeigen, dass zwischen den USA und Kanada, d.h. recht ähnlichen Länder mit Blick auf
Kultur, Sprache und institutionelles Umfeld, die Grenze einen ganz erheblichen
Einfluss auf die Handelsströme hat, und dies trotz der Tatsache, dass es zwischen
diesen Ländern keine nennenswerten politisch gesetzten Handelshemmnisse gibt
und gab. Er vergleicht dazu die intranationalen Handelsströme in Kanada, konkret:
Handel zwischen den kanadischen Provinzen, mit internationalen Handelsströmen
zwischen diesen Provinzen und den amerikanischen Bundesstaaten. In einer Gravitationsgleichung, die in der Erklärung des Werts bilateraler Handelsströme für die
regionalen Wertschöpfungen sowie die geographischen Entfernungen kontrolliert,
kommt McCallum (mit Daten für das Jahr 1988) zu dem Ergebnis, dass die zwischen kanadischen Provinzen nicht bestehende nationale Grenze ceteris paribus die
Handelsströme um einen Faktor 22 gegenüber dem Handel zwischen einer kanadischen Provinz und einem amerikanischen Bundesstaat erhöht. Im Vergleich zu anderen Studien mit der gleichen Fragestellung für andere Zeiträume und Untersuchungsregionen – so enthält Krugman (1991a) eine entsprechende Untersuchung für
Europa – ist die Größenordnung des von McCallum gefundenen Effekts am oberen
Rand; dennoch finden alle entsprechenden Studien einen sowohl statistisch signifikanten als auch ökonomisch bedeutenden handelshemmenden Effekt von Grenzen.3
Auch im Zeitalter der Globalisierung sind nationale Grenzen daher von Bedeutung.
Dies wurde zuletzt besonders deutlich, als in der Finanz- und Wirtschaftskrise
3
Vgl. dazu die Studie von Anderson/van Wincoop (2003), die relativ zu McCallum einen deutlich kleineren Grenzeffekt ausweist sowie den Überblick in Feenstra (2004), p. 149 ff. Ein Sonderheft der CESifo
Economic Studies (June 2013) befasst sich mit der Frage der Messung ökonomischer Integration.
Cheptea (2013) widmet sich insb. der Handelsintegration von zentral- und osteuropäischen Ländern mit
der EU. Sie zeigt, dass ein EU-15-Land ceteris paribus 11,2 mal mehr intranationalen betreibt als Handel
mit den neuen (zentral- und osteuropäischen) Mitgliedsstaaten (NMS), und dass gleichzeitig die
intranationalen Handelsströme der NMS um einen Faktor 22,6 höher sind als Handelsströme zwischen
den NMS.
6
Institutionen und historische Grenzen
2008/9 die Handelsströme auch relativ zu den Maßen für die Wertschöpfung massiv
gesunken sind – und entsprechende protektionistische Tendenzen sichtbar wurden,
auch wenn diese sich nicht nachhaltig durchsetzen konnten.
Für das Phänomen unscharfer Grenzen ist nicht nur die jedenfalls für Handelsströme
unstrittige hemmende Wirkung staatlicher Grenzen wichtig, sondern auch die Heterogenität bestimmter Merkmale innerhalb von Grenzen. Natürlich kommt es hier sehr auf
den konkreten Untersuchungsgegenstand an, aber intranationale regionale Unterschiede
können sehr groß ausfallen und sind gut dokumentiert. Nur als Beispiele seien die nach
wie vor signifikanten Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland genannt oder
das Gefälle zwischen Norditalien und dem Mezzogiorno. Als kurze empirische Illustration kann eine andere zentrale ökonomische Größe, die Arbeitslosenquote, dienen. Der
Variationskoeffizient der Arbeitslosenquoten auf der Ebene der 16 Bundesländer beträgt
0,31 – was fast exakt dem Wert für die EU-27-Staaten ohne die Krisenländer Griechenland, Spanien, Portugal und Zypern entspricht.4 Auch wenn dies nur eine sehr punktuelle Evidenz ist, so wird doch deutlich, dass intranationale Differenzen nicht weniger ausgeprägt sein müssen als internationale Differenzen. Geppert/Stephan (2008) zeigen,
dass eine – seit den 1990er Jahren sogar beschleunigte – Reduktion des Einkommensgefälles innerhalb der EU zwar für die Ebene der Gesamtstaaten beobachtet werden kann,
nicht aber für die Ebene der Regionen. Eine neuere Studie von Tvrdon (2012), zeigt,
dass die regionalen Disparitäten (auf NUTS-2-Ebene) im Kontext der EUKohäsionspolitik nur unwesentlich zurückgegangen sind und innerhalb der neuen Mitgliedsländer aus Mittel- und Osteuropa sogar zugenommen haben.
Die hier nur kurz angerissene Literatur zu inter- und intranationalen Konvergenzen
und Divergenzen ist zwar recht ausführlich in der Beschreibung der Daten und versucht auch durchaus die Wirkungen von Politikmaßnahmen wie beispielsweise der
EU-Kohäsionspolitik empirisch zu erfassen. Wenig beforscht ist jedoch die Frage
nach tiefergehenden Erklärungen dieser Entwicklungen. Gerade innerhalb eines Landes sind die formalen Institutionen weitgehend homogen – wenn man einmal von den
4
Verwendet wurden dazu die jeweils aktuellsten Daten, konkret August 2013 für die Arbeitslosenquoten
der 16 Bundesländer und Mai 2013 für die EU-27 Länder. Quelle: Arbeitsagentur, Eurostat, eigene Berechnungen.
7
IOS Mitteilung Nr. 63
(typischerweise recht engen) Spielräumen föderaler Differenzierungen absieht. Die in
Abschnitt C. zu diskutierende Literatur wird hier auf die Rolle informeller Institutionen zurückkommen.
III Zur Rolle der Geschichte in der ökonomischen Forschung
Historische Prozesse oder Gegebenheiten haben zumindest in theoretischen Modellen
lange Zeit keine wirklich prominente Rolle gespielt. Und es ist sicherlich fair zu sagen,
dass trotz der nachfolgend zu berichtenden Ansätze eine detaillierte und auf konkrete
Fragestellungen bezogene Berücksichtigung historischer Gegebenheiten und Entwicklungen auch in der empirischen Forschung kaum gegeben ist.5
In der ökonomischen Theorie konnte eine explizite Rolle für „Geschichte“, wenn
auch in einem recht abstrakten Sinne, erst dann modelltheoretisch abgebildet werden,
als mit der Möglichkeit der Berücksichtigung steigender Skalenerträge multiple Gleichgewichte denkbar und modellierbar wurden.6 Wenn nun aber unterschiedliche Gleichgewichte in einem konsistenten Modellrahmen mit rationalen Akteuren resultieren,
dann stellt sich sofort die Frage, welche Kräfte – notwendigerweise außerhalb des Modells – für die Auswahl des Gleichgewichts verantwortlich sind. Und die „Geschichte“,
d.h. ein aus Sicht des Modells arbiträrer – eben historisch bestimmter – Wert einer Größe, kann (muss aber nicht notwendigerweise) dafür eine entscheidende Rolle spielen.
Paul Krugman (1991b) zeigte dies in einem einfachen Modell, in dem die in einer
Ökonomie vorhandenen (homogenen und intersektoral perfekt mobilen) Arbeitskräfte
für die Produktion von zwei Gütern eingesetzt werden können, wobei Gut 1 mit konstanten, Gut 2 mit steigenden Skalenerträgen produziert wird. Die Annahme, dass die
Produktivität bei der Herstellung von Gut 2 geringer (höher) ist, wenn für Gut 1 alle
(keine) Arbeitskräfte eingesetzt werden, reicht aus, um zwei stabile Gleichgewichte zu
generieren. Konkret werden im Gleichgewicht dieses Modells alle Arbeitskräfte in ei-
5
In der empirischen Wachstumsforschung werden in Länderpanels bisweilen „historische Variablen“
aufgenommen, so bspw. die Religionszugehörigkeit eines Gebiets, eine mögliche Kolonialvergangenheit
und andere Aspekte. Zu den Ergebnissen dieser Literatur siehe Sala-i-Martin (1997).
6
Die Idee und mögliche Relevanz steigender Skalenerträge war teilweise auch schon vorher klar adressiert worden, aber eben nicht stringent im Kontext eines konsistenten Modells dargestellt worden. Siehe
dazu z.B. Graham (1927) oder Young (1928).
8
Institutionen und historische Grenzen
nem der beiden Sektoren konzentriert sein – in welchem ist offen bzw. hängt von der
Verteilung der Arbeitskräfte in einem initialen Zeitpunkt ab. Unter den genannten Annahmen gibt es auch ein klares Pareto-Ranking der beiden stabilen Gleichgewichte. Gesellschaftlich ist es wünschenswert, alle Arbeitskräfte in Sektor 2 zu haben, da dort die
Produktivität höher ist als im alternativen Gleichgewicht, bei dem alle Arbeitskräfte in
Sektor 1 gebunden sind.
In Abb. 2 wird die Produktivität in beiden Sektoren in die vertikale Richtung als
Funktion der Verteilung der Arbeitskräfte, die auf der horizontalen Achse abgetragen
sind, dargestellt. L1 wird dabei vom Ursprung nach rechts gemessen, L2 von der rechten
Begrenzung, die durch die insg. zur Verfügung stehende Menge an Arbeitskraft definiert ist, nach links. In den Punkten A und B haben Arbeitskräfte keinen individuellen
Anreiz, in den jeweils anderen Sektor zu wechseln, da dort die Produktivität jeweils
niedriger ist. Also sind A und B stabile Gleichgewichte. C ist ein weiteres, allerdings
instabiles, Gleichgewicht, da beliebig geringe Abweichungen von C Anpassungsprozesse nach A oder B auslösen. Interessant ist nun, wie diese Anpassungsprozesse aussehen
bzw. aussehen können.
B
Produktivität Gut 2
C
L1
A
Produktivität Gut 1
L2
a)
b)
overlap
Abbildung 2 Das Krugman (1991b)-Modell
9
IOS Mitteilung Nr. 63
Die Anpassungsprozesse sind unterhalb des Quadranten skizziert. Möglichkeit a)
ist die „unspektakuläre“ Variante, in der sich die Arbeitskräfte ausgehend von einer
initialen Verteilung uniform in Richtung eines der beiden stabilen Gleichgewichte
bewegen.7 Die eingezeichneten Pfeile sind intuitiv sofort verständlich, da die Bewegung immer in Richtung des Sektors erfolgt, in dem die Produktivität vergleichsweise
höher ist. In diesem Fall wird also die Selektion zwischen den Gleichgewichten eindeutig und ausschließlich bestimmt durch die initiale Verteilung der Arbeitskräfte. Da
diese als „historisch bedingt“ angesehen werden kann, ist in diesem Fall Geschichte
die entscheidende Kraft.
Anders sieht es aus in den beiden Fällen, die in Abb. 2 als Möglichkeit b) eingezeichnet sind. Hier oszillieren die Beschäftigungsanteile um das instabile Gleichgewicht. In dem von Krugman als „overlap“ bezeichneten Bereich kann das System ausgehend von jedem Punkt in jedes der beiden Gleichgewichte kommen. Entscheidend ist
nun nicht mehr die initiale Lage, d.h. die Geschichte, sondern es kommt auch auf die
Erwartungen an. Insb. wird es dann möglich, dass die Ökonomie in das Gleichgewicht
konvergiert, das allgemein erwartet wird, d.h. dass sich Erwartungen selbst erfüllen. Der
Mechanismus ist recht einfach zu verstehen: Selbst wenn in einem Punkt die Produktivität in Sektor 1 höher ist als in Sektor 2, kann es sich auch aus der Perspektive einer
einzelnen Arbeitskraft lohnen, aufgrund der zukünftig höheren Produktivität dort in
Sektor 2 zu wechseln, jedenfalls dann wenn diese Produktivität aus heutiger Sicht hinreichend wünschenswert und hinreichend hoch ist sowie hinreichend schnell erreicht
wird. Damit bestimmen genau drei Parameter über die Möglichkeit sich selbst erfüllender Erwartungen, nämlich die zeitliche Abdiskontierung, das Ausmaß der steigenden
Skalenerträge in Sektor 2 sowie die Anpassungsgeschwindigkeit.8 In diesem Fall muss
also nicht die Vergangenheit – die Geschichte – die einzige relevante Größe sein, son-
7
Streng genommen gibt es im Modell so wie hier dargestellt keinen Grund dafür, dass der Übergang zum
stabilen Gleichgewicht nicht sofort erfolgt. Allerdings würden kleine Anpassungskosten genügen, um
eine graduelle Anpassung als optimal auszuweisen. Krugman (1991b) spezifiziert eine endliche Anpassungsgeschwindigkeit ad hoc.
8
Je weniger die Zukunft abdiskontiert, je ausgeprägter die steigenden Skalenerträge sind und je schneller
die Anpassungsgeschwindigkeit ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich selbst erfüllende Erwartungen
eine Rolle spielen können.
10
Institutionen und historische Grenzen
dern es ist jedenfalls möglich, dass die in die Zukunft gerichteten Erwartungen die entscheidende Rolle spielen.9
Krugman (1991b, p. 666) selbst kommentiert am Ende seines Papiers, dass es keine
systematische Diskussion darüber gab, wann welche der beiden Möglichkeiten eher
zutrifft. Wenn nun aber historische Grenzen rein deskriptiv als relevant für bestimmte
Phänomene erkannt werden, so wäre dies ein Indiz für die Dominanz von Geschichte
gegenüber der Rolle von Erwartungen, während eine konvergente Entwicklung innerhalb eines Staates nahelegt, dass mit der gemeinsamen institutionellen Struktur auch die
Erwartungen nachhaltig beeinflusst werden konnten.
Konkrete Anwendungen der grundlegenden Idee von Krugman (1991b) sind sehr
rar – obgleich diese von ihm explizit angedacht werden. Schäfer / Steger (2010) formulieren basierend auf Krugman’s Idee ein Modell mit etwas mehr Struktur, um die divergente Entwicklung in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung zu
erklären. Da in ihrem Modell steigende Skalenerträge durch die Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur erreicht werden, wird es möglich, die quantitative Bedeutung von
sich selbst erfüllenden optimistischen Erwartungen direkt wirtschaftspolitisch zu beeinflussen. Sengupta /Okamura (1995) versuchen in einer empirischen Modellierung
des Wachstumsprozesses in Japan von 1965 bis 1990 die relativen Rollen von forward
looking („expectations“) und backward looking („history“) Komponenten in den
Faktornachfragen voneinander zu trennen und kommen zu dem Schluss, dass erstere
eine größere Bedeutung haben. Allerdings bietet ihr Modell keine Anhaltspunkte für
eine mögliche wirtschaftspolitische Beeinflussbarkeit der Relevanz der beiden Alternativen.
Im Kontext des Nachdenkens über die Relevanz historischer Grenzen ist die von
Krugman beschriebene Denkmöglichkeit von Gleichgewichten, die eher vergangenheits- bzw. eher zukunftsgetrieben sind, deswegen so wichtig, weil damit erklärt werden
kann, warum einerseits (nicht nur) ökonomische Entwicklungen von der Vergangenheit
abhängen können, andererseits dies aber auch nicht denknotwendig ist. Anders gesagt:
9
Die entgegengesetzte Erwartung einer Konzentration in Sektor 1 ist natürlich ebenfalls möglich, da die
Erwartung, dass dieses Gleichgewicht erreicht wird, es für einen individuellen Beschäftigten attraktiv
macht, sich genau so zu verhalten, dass es erreicht wird.
11
IOS Mitteilung Nr. 63
Es kann sein, dass sich zwei identische Strukturen in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Deutliche Änderungen der Rahmenbedingungen (z.B. durch die Verschiebung
einer Grenze und die dadurch wirksam werdenden Veränderungen institutioneller Natur) können die Erwartungen für die Zukunft und damit das Gleichgewicht deutlich beeinflussen und damit wirksam werden, müssen dies aber nicht. Es können mithin entweder die Ausgangslage – die historischen Gegebenheiten – oder die Erwartungen, die
bspw. durch institutionelle Reformen getrieben werden, entscheidend sein. Damit wird
bspw. nicht nur wichtig, dass und welche Institutionen eingeführt werden, sondern dass
mit der Einführung auch ein Versuch unternommen wird, die betroffenen Akteure von
der Erreichbarkeit der positiven Konsequenzen dieser Reformen zu überzeugen.
An dieser Stelle trifft sich Wirkungsanalyse von Institutionen mit der Forschung
über die Bedeutung der Akzeptanz institutioneller Reformen.10 Denn Reformen, deren
positive Wirksamkeit vermittelt werden kann, können genau deswegen auch wirksam
sein und daher auf Akzeptanz stoßen, während in der genau gleichen Situation die
gleichen Reformen, deren Wirksamkeit eben nicht glaubhaft vermittelt werden kann,
aus diesem – und nur aus diesem – Grund scheitern können. Die Akzeptanz von Reformen politischer Maßnahmen bzw. Institutionen ist insofern ein potentiell entscheidender Schlüssel zum Verständnis der Möglichkeit multipler Gleichgewichte und sich
selbst erfüllender Erwartungen.
10
Siehe dazu Jerger (2012).
12
Institutionen und historische Grenzen
C Historische Grenzen und unscharfe Grenzen
Kapitel B diente im Grunde lediglich der Plausibilisierung des Nachdenkens über die Rolle historischer Grenzen vor dem Hintergrund des empirischen Phänomens unscharfer
Grenzen. In diesem Abschnitt soll nun ein einfacher Rahmen für das Nachdenken über
die potentielle Wirksamkeit historischer Grenzen für Entwicklungen, die innerhalb aktueller Grenzen beobachtet werden können, eingeführt werden (Abschnitt C.I). Danach wird
in Abschnitt C.II über die Literatur zur Rolle historischer Grenzen kurz berichtet.
I Ein konzeptioneller Rahmen
Für die Etablierung eines gedanklichen Rahmens genügt es völlig – eine Verallgemeinerung auf beliebig viele Länder wäre unproblematisch –, zwei aktuell existierende Länder A und B zu unterstellen. Diese sind in Abb. 3 mit durchgezogenen Linien gegeneinander abgegrenzt – wobei es nicht notwendigerweise wichtig ist, dass diese nun wie in
Abbildung 3 skizziert eine gemeinsame Grenze aufweisen.
Nehmen wir weiterhin an, dass Teile von Land A und Land B dem nicht mehr (bzw.
nicht mehr in dieser Abgrenzung) existierenden (historischen) Land H angehörten, konkret die Areale A2 und B2, während A1 und B1 nicht Teil von H waren.
Die Frage nach der Bedeutsamkeit und langfristigen Wirksamkeit historischer Grenzen läuft dann darauf hinaus, ob es zwischen den Gebieten A2 und B2, die eine gemeinsame Vergangenheit haben, größere Ähnlichkeiten gibt als zwischen A1 und A2 sowie
B2 und B1.
Land B
Land A
A1
B1
A2
B2
Land H
Abbildung 3 Aktuelle und historische Grenzen
13
IOS Mitteilung Nr. 63
Es ist klar, dass Ähnlichkeiten zwischen A2 und B2 auf der einen Seite sowie Unterschiede zwischen A1 und A2 bzw. B1 und B2 auf der anderen Seite auf viele Faktoren
zurückgeführt werden können. So könnten sich die Regionen beispielsweise hinsichtlich
geographischer Bedingungen, Rohstoffvorkommen, dem Zugang zum Meer und Wasserstraßen oder klimatischer Bedingungen deutlich unterscheiden. Alle diese Faktoren
sind ohne Zweifel relevant für viele Variablen, deren Streuung zwischen verschiedenen
Regionen zu erklären ist. Gerade in Analysen über lange Zeiträume stellt sich dabei das
zusätzliche Problem, dass die Bedeutung dieser natürlichen Voraussetzungen im Zeitablauf sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Dies gilt nicht nur, aber insbesondere,
für die Bedeutung von Rohstoffvorkommen. Diese eröffnen ja zunächst einmal ein
Wertschöpfungspotential und eine Möglichkeit der wirtschaftlichen Spezialisierung
einer Region; es gibt aber eine breite Literatur dazu, warum v.a. aufgrund von Verteilungskämpfen (rent seeking), die durch das Vorhandensein von Rohstoffen ausgelöst
werden können, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung auch leiden kann,
und es zu dem sog. „resource curse“ kommt. Wenn man den Einfluss der historischen
Grenze von diesen Dingen separieren will und für das zu erklärende Phänomen diese
Dinge potentiell wichtig sind, müssen empirische Studien dafür natürlich kontrollieren.
Ist dieses – nicht triviale – Problem gelöst, so kann ein Evaluationsrahmen für die
Rolle historischer Grenzen wie nachfolgend skizziert aussehen. Die zentrale Idee dabei
ist die Unterscheidung zwischen formellen und informellen Institutionen im Sinne von
North (1990). Ein ganz wesentliches Merkmal von Ländern oder anderen politischen
Gebilden ist es, dass sie einen formalen institutionellen Rahmen vorgeben, der in diesem Land überall gültig ist. Bezeichnen wir diese formalen Institutionen im historischen
Land H mit
Ländern als
.11 Analog werden die formalen Institutionen in den beiden aktuellen
≠
≠
bezeichnet. Die formellen Institutionen werden sich
plausiblerweise im Laufe der Zeit auch auf informelle Institutionen – nennen wir sie ,
11
Auch wenn der hier vorgestellte Modellrahmen dies nicht abbildet, ist es völlig unstrittig, dass gerade
in großen Ländern/Imperien durchaus regional angepasste institutionelle Regelungen vorliegen können
bzw. konnten. Dennoch muss es denknotwendigerweise einen gemeinsamen institutionellen Kern
geben, wenn die historischen Grenzen auch nur potentiell eine Rolle spielen sollen. Die empirische Frage
nach deren Bedeutung lässt sich dann aufspalten in die beiden Teilfragen, ob ein solcher Kern existiert
und wenn ja, ob dieser langfristige Auswirkungen hatte. Ein negatives empirisches Resultat kann dann
nicht notwendigerweise identifizieren, welche dieser Teilfragen mit „nein“ zu beantworten ist.
14
Institutionen und historische Grenzen
∈
, ,
– auswirken, d.h. soziale Normen und Interaktionsmuster bestimmen. So
kann bspw. ein formelles Zinsverbot die Ausprägung von Familien- und Clanstrukturen
zur Finanzierung von Geschäftsvorhaben zur Folge haben und die Absenz einer funktionierenden öffentlichen Verwaltung die Verbreitung von Korruption begünstigen. Da
sich solche informellen Institutionen typischerweise nicht leicht ändern lassen, können
diese auch dann fortbestehen, wenn die sie verursachenden formellen Institutionen
bspw. durch den Sturz eines politischen Systems geändert werden. Damit können sich
die informellen Institutionen zwischen A1 und A2 bzw. B1 und B2 unterscheiden, was
wiederum zu unterschiedlichen Ausprägungen einer Beobachtung einer Variablen X
führen kann. Selbstverständlich werden auch die formellen Institutionen in den Ländern
A und B ebenfalls Einfluss auf die Ausprägung der informellen Institutionen haben.
Abbildung 4 fasst diese Überlegung grafisch zusammen. Die gestrichelten Linien deuten dabei die Möglichkeit an, dass die aktuell gültigen formellen Institutionen in einem
Land dort auch die informellen Institutionen beeinflussen können und damit den Einfluss von
(mit der Zeit) zurückdrängen.
Formelle Institutionen in H
Beobachtung
Informelle Institutionen in A2, B2
Formelle Institutionen in B
Formelle Institutionen in A
Abbildung 4 Formelle Institutionen, informelle Institutionen und historische Grenzen
Die folgenden Gleichungen beschreiben, wie die Beobachtungen von X in den vier
Teilen der Länder A und B modelliert werden können:
=
( ,
( ))
=
( ,
( ,
=
(
,
(
))
=
(
,
(
,
))
))
15
IOS Mitteilung Nr. 63
Die Wirksamkeit einer historischen Grenze ist dann gegeben, wenn in den ehemals H
angehörenden Regionen (A2, B2) Einflüsse auf die informellen Institutionen gegeben
sind und diese wiederum wirksam sind für die Ausprägung von X. Die Schätzung solcher Effekte ist eine lohnende Herausforderung für die empirische Institutionenökonomik in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann damit ein Beitrag geleistet werden zu
der Verbindung formeller und informeller Institutionen, zum anderen können die Auswirkungen institutioneller Bedingungen auf Ergebnisvariablen sichtbar gemacht werden. Bei beiden Fragestellungen kann die Existenz historischer Grenzen zur Identifikation beitragen, da quasi ein „Kontrollgebiet“ zur Verfügung steht, von dem bekannt ist,
dass dort die formalen Institutionen von H nicht wirksam waren. Die Beobachtung unscharfer Grenzen, insb. die Existenz von Ähnlichkeiten zwischen benachbarten Gebieten, die heute unterschiedlichen Ländern angehören, kann also ggf. mit historischen
Grenzen erklärt werden, die wiederum die empirische Analyse der Wirkung von Institutionen ermöglichen.
Formal lässt sich der Effekt formaler Institutionen des Landes H auf eine Beobachtung in einer Region, die früher Teil von H war, wie folgt zerlegen:
=
∙
, ∈
,
.
Der erste Faktor auf der rechten Seite der Gleichung bringt zum Ausdruck, wie sich
informelle Institutionen auf Ergebnisvariablen auswirken, der zweite Faktor drückt aus,
wie formelle Institutionen der Vergangenheit auf aktuelle informelle Institutionen wirken. Selbstredend ist der Anspruch an die Daten sehr hoch, wenn man diese Dinge voneinander trennen will.12 Wichtig ist außerdem, dass eine empirische Diagnose statistisch
signifikanter Effekte unbefriedigend bleibt, wenn nicht entsprechende theoretische Wirkungskanäle benannt werden können. Gerade für diese Aufgabe kann eine qualitative
12
Darüber hinaus können sowohl der Gesamteffekt als auch die beschriebenen Teileffekte von weiteren
Kontextfaktoren abhängen. Damit wäre der hier eingeführte gedankliche Rahmen schlicht zu grob. Mendelski/Libmann (2011) zeigen bspw. für rumänische Daten, dass heute in diesem Land eine habsburgische
Vergangenheit in (heute) relativ reichen Regionen eine höhere Prozessfreudigkeit nach sich zieht als in
Gebieten mit osmanischem Erbe, während für vergleichsweise arme Regionen genau das Gegenteil zutrifft. Anders gesagt: Die Geschichte hat in dieser Studie messbare und relevante Auswirkungen auf die
Ergebnisvariable Prozesshäufigkeit, diese Auswirkungen sind aber kontextabhängig.
16
Institutionen und historische Grenzen
Analyse des historischen Hintergrunds, konkreter: der Entwicklung und Wirksamkeit
formeller und informeller Institutionen, eine wichtige Ergänzung quantitativ empirischer Forschung sein.
Die Probleme der Anwendung bzw. Anwendbarkeit des skizzierten Modellrahmens
werden bei jeder denkbaren Fragestellung im Detail stecken. Abgrenzung und
Beobachtbarkeit der relevanten Daten, die theoretische Rechtfertigung von Wirkungskanälen, die Multikausalität bzw. Kontextabhängigkeit der Beobachtungsvariablen X
sowie die Endogenität der Grenzziehungen und Grenzänderungen selbst sind hierbei nur
die wichtigsten der potentiellen Problemfelder. Die Liste macht aber deutlich, dass ein
entsprechendes Forschungsvorhaben nicht nur Kompetenz in empirischen Methoden
erfordert, sondern auch ein profundes Wissen über historische Zusammenhänge und
insb. über den institutionellen Wandel erfordert. Die Forschungsagenda bedingt daher
geradezu ein interdisziplinäres Vorgehen.
II Empirische Befunde
In der Geschichtswissenschaft gehören historische Grenzen ganz selbstverständlich auf
die Forschungsagenda und werden in zahlreichen Beiträgen, so z.B. in Gehler/Pudlat
(Hrsg., 2009) oder speziell zu Mittel- und Osteuropa in Haslinger (Hrsg., 1999) sowie
Lemberg (Hrsg., 2000), behandelt. Auch wenn in dieser Literatur zahlreiche konzeptionelle und faktische Facetten historischer Grenzziehungen aufgearbeitet werden, so
ergibt sich daraus kein konsistentes Bild über die langfristige Wirksamkeit von Grenzen. Seit 2011 gibt es jedoch ein Verbundprojekt mit dem Namen „Phantomgrenzen in
Ostmitteleuropa“, dessen Fragestellung direkt an der langfristigen Wirksamkeit historischer Grenzen ansetzt.13 Als „Einstiegsbeispiel“ auf dem Flyer dieses Projekts dient die
Tatsache, dass sich das Wahlverhalten bei der polnischen Präsidentschaftswahl im Jahr
13
Auf der Website des Projekts (http://phantomgrenzen.eu/) findet sich die folgende Beschreibung;
„Phantomgrenzen sind frühere, zumeist politische Grenzen, die den heutigen Raum strukturieren. In vielen Fällen wirken die historischen Räume (Habsburger Reich, Osmanisches Reich, Teilung Deutschlands,
Teilung Polens u.a.) fort oder tauchen erneut auf: im Wahlverhalten, in Infrastrukturnetzwerken oder auch
in sozialen Praktiken. Diese Remanenz-Phänomene werden von allen Projekten, die im Kompetenznetzwerk zusammenarbeiten, in verschiedenen Facetten für die Region Ostmitteleuropa und Südosteuropa
untersucht.“ Leider finden sich jedoch auf der Website derzeit (September 2013) nur sehr wenige konkrete Ergebnisse dieser interessanten Agenda.
17
IOS Mitteilung Nr. 63
2010 auf den beiden Seiten der ehemaligen polnischen Grenze bis 1918 erkennbar unterscheidet – d.h. eine entsprechend eingefärbte Karte der Wahlergebnisse auf kleinräumiger Ebene diese Grenze deutlich erkennbar werden lässt.
Eine in der Geschichtswissenschaft viel beforschte Grenze ist die des ehemaligen
Habsburgerreichs. In der Arbeit von Becker et al. (2011) werden Daten aus dem
Life in Transition Survey (LITS) herangezogen, um der Frage nachzugehen, ob und
inwieweit die unter Habsburger Herrschaft eingeführten Institutionen auch heute
noch Wirksamkeit entfalten. Insb. könnten die relativ effizienten und funktionalen
und daher akzeptierten Habsburger Verwaltungsstrukturen einen auch noch nach
mehreren Generationen – und mehreren abrupten Drehungen der politischen Windrichtung – spürbaren Vertrauensvorsprung in staatliches Handeln und staatliche
Institutionen zur Folge haben. Die Analyse nutzt wie schon die genannte Studie von
Mendelski/Libman (2011) die Tatsache, dass die Grenze des ehemaligen Habsburgerreichs quer durch eine ganze Reihe mittel- und osteuropäischer Staaten geht. Die
Karte in Abb. 5 zeigt diese Grenze zusammen mit den aktuellen Ländergrenzen. Die
kleinen offenen Kreise beziehen sich auf konkrete Orte, in denen der LITS durchgeführt wurde, die ausgefüllten Kreise auf die („Grenz-“)Orte entlang der ehemaligen
habsburgischen Grenze.
Im Rahmen des LITS werden unter anderem auch Fragen gestellt, aus deren Beantwortung Schlüsse gezogen werden können für die Funktionalität staatlicher Einrichtungen
und das in sie gesetzte Vertrauen. Dies sind zunächst Fragen zum Vertrauen in Parlament,
Regierung, Parteien, Gerichte und Armee aber auch nach der Relevanz von Korruption,
konkret: von Seitenzahlungen und Geschenken im Umgang mit Personen aus dem öffentlichen Sektor.
Das Ergebnis der Untersuchung ist, dass in der Tat ein signifikanter „HabsburgEffekt“ existiert. Das Vertrauen in öffentliche Institutionen ist höher und die Korruption
niedriger in Gebieten, die einmal habsburgisch waren. Dieser Befund, der sich als solcher auch rein deskriptiv aus den Daten ermitteln lässt, kann insofern den Anspruch auf
Kausalität erheben, als für zahlreiche Variablen sowohl auf individueller als auch auf
regionaler und Länderebene kontrolliert wurde. Der besondere Erkenntniswert einer
18
Institutionen und historische Grenzen
historischen Grenze, die durch heutige Staaten verläuft, liegt darin, dass eben auch Beobachtungen vorliegen, für die die aktuellen institutionellen Rahmenbedingungen identisch sind und daher dafür nicht kontrolliert werden muss.
Quelle: Becker et al. (2011)
Abbildung 5 Habsburg und die heutigen Staaten Mittel- und Osteuropas
Das berichtete Ergebnis ist zwar per se interessant und weist eine persistente Rolle institutioneller Regelungen aus. Allerdings ist damit erst gezeigt, dass es diesen Effekt gibt, und
noch nicht warum. In Kategorien des konzeptionellen Rahmens in Abschnitt C.I wurde
auch „nur“ gezeigt, wie früher relevante formelle Institutionen auf informelle Institutionen
heute wirken, d.h. es wurde ein Effekt
gemessen, wobei die Variable
in diesem Fall
auch „nur“ eine Dummy ist dafür, ob eine Antwort aus einem ehemals habsburgischen Gebiet stammt oder nicht. Die Forschungsfrage in dieser Studie erstreckt sich nicht auf den
weiteren Teileffekt, nämlich wie informelle Institutionen auf weitere Ergebnisvariablen
19
IOS Mitteilung Nr. 63
wirken.14 Um hier einen Schritt voranzukommen, bieten sich prinzipiell zwei Vorgehensweisen an: Zum einen können Ergebnisvariablen X auf regionaler Ebene gemessen werden
(Output pro Kopf, Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten, Art und Stabilität politscher
Präferenzen wären hier eine kleine Auswahl potentiell interessanter Masse), zum anderen
können auch diese auf individueller Ebene, d.h. aus Mikrodatensätzen, erfasst werden. Damit ist also auch denkbar, dass bei der Erfassung des oben eingeführten Gesamteffekts die
Messung der beiden Teileffekte auf unterschiedlicher Ebene angegangen werden kann.
Noch anspruchsvoller als die reine Messung der (Teil-) Effekte dürfte allerdings die
Identifikation konkreter Wirkungskanäle werden, über die formale Institutionen der Vergangenheit über lange Zeit hinweg wirksam bleiben. Neben theoretischen Modellen, in
welchen die Wirksamkeit von Institutionen bzw. die Pfadabhängigkeiten informeller Institutionen endogen erklärt wird, können an dieser Stelle auch „anekdotische Evidenzen“
sehr nützlich sein. Als ein kleines Beispiel sei hier genannt, dass es recht zahlreiche Hinweise auf die Relevanz der „stattlichen“ Natur gut sichtbarer öffentlicher Bauten (z.B.
Verwaltungen, Postämter, Bahnhöfe und Krankenhäuser) im Habsburger Reich gibt. Solche Bauten haben – jedenfalls teilweise – in der Tat Reiche und Generationen überdauert,
und werden offenbar zeitübergreifend als Symbol und Indiz funktionierender staatlicher
Institutionen wahrgenommen. Ein solcher Wirkungskanal würde übrigens auch das empirische Rätsel lösen, dass in manchen Regionen langfristige Effekte der territorialen Zugehörigkeit bei der heutigen Bevölkerung gemessen werden können, obgleich es in der Region aufgrund von Flucht und Vertreibungen zu einem weitgehenden Austausch der Bevölkerungen gekommen ist. Auch wenn ein solcher Befund zunächst merkwürdig klingt,
muss die Tradierung informeller Institutionen ja nicht über Personen und Familien erfolgen, sondern kann eben bspw. auch über die Qualität und Sichtbarkeit (historischer) staatlicher Infrastruktur erklärt werden. Um solche Befunde zu erheben, kann aber bspw. eine
Auswertung von Archivmaterialien zur Bedeutung und Wahrnehmung dieser Einrichtungen relevante und instruktive Antworten liefern, auch wenn diese einer quantitativen statistisch-ökonometrischen Analyse nicht zugänglich sein mögen.
14
Es ist selbstredend völlig legitim, die Forschungsfrage auf den genannten Teileffekt zu beschränken,
allerdings kann damit eben nicht oder nur sehr begrenzt gezeigt werden, welche konkreten Auswirkungen
ein historisches Erbe hat.
20
Institutionen und historische Grenzen
Eine Studie, die dem hier vorgestellten konzeptionellen Rahmen sehr weitgehend
entspricht, ist die Analyse der langfristigen Folgen des Vertrags von Karlowitz, der im
Jahr 1699 die Grenze zwischen dem Osmanischen und dem Habsburgischen Reich festlegte, in Karaja (2013). Im Osmanischen Reich kam es kurz vor dieser Grenzziehung zu
einer bedeutsamen institutionellen Änderung, konkret: zur Einführung eines Steuersystems, das auf der Versteigerung von Steuereintreibungsrechten beruhte. Damit wurde
eine formelle Institution geschaffen, die plausiblerweise besonders anfällig für Bestechung und Korruption ist. Damit ist eine Kausalität zwischen einer formellen und einer
informellen Institution etabliert, die in dem Papier auch modelltheoretisch formalisiert
wird. Mit Hilfe von Individualdaten (wiederum des LITS) wird dann gezeigt, dass sich
die Perzeption und die Relevanz von Korruption auf den beiden Seiten der in Karlowitz
gezogenen Grenze auch heute noch deutlich und signifikant unterscheiden. Die Ausprägung informeller Institutionen ist damit ist damit offensichtlich sehr langlebig, auch
wenn ein Persistenzmechanismus für die Erklärung dieser Langlebigkeit nicht explizit
genannt bzw. empirisch validiert wird. Als letzten Schritt zeigt Karaja, dass diese Perzeptionen einen signifikanten Einfluss auf ökonomisch relevante Ergebnisvariablen,
welche die wirtschaftliche Entwicklung beschreiben, haben.15
An weiteren Beispielen für die Relevanz von ehemaligen Grenzen, die mit institutionellen Innovationen einhergingen, die sich als langfristig wirksam herausstellten, besteht kein Mangel, ein vollständiger Literaturüberblick kann hier nicht angestrebt werden. Explizit genannt sei aber noch der Beitrag von Acemoglu et al. (2011) zu den langfristigen Konsequenzen des code civile durch Kaiser Napoleon in einigen westlichen
Regionen Deutschlands. Hier konnte gezeigt werden, dass diese sehr tiefgreifende Änderung formaler Institutionen jeweils regional wirksam war und damit deutliche Entwicklungsdifferentiale zwischen den dadurch betroffenen bzw. nicht betroffenen Regionen Deutschlands bedingt wurden.
15
Als proxies für wirtschaftliche Entwicklung werden Haushaltskonsum und die Nutzungsintensität
künstlichen Lichts herangezogen.
21
IOS Mitteilung Nr. 63
D Fazit
Dieser Beitrag geht aus von dem empirischen Befund „unscharfer Grenzen“ und interpretiert dieses Phänomen als Indiz für die Relevanz historischer Grenzen. Diese sind
schon seit einiger Zeit Gegenstand institutionenökonomischer Forschung, weil sie als
Quasi-Experiment für die Wirksamkeit von Institutionen verstanden und benutzt werden
können. Es wird gezeigt, dass und wie gerade auch ökonomische Prozesse Pfadabhängigkeiten unterworfen sind bzw. sein können; es versteht sich fast von selbst, dass dies
auch auf nicht-ökonomische Entwicklungen zutrifft.
Der Beitrag bietet auch einen groben konzeptionellen Rahmen für die empirische
und/oder theoretische Untersuchung der Relevanz historischer Grenzen. Die Erfüllung
dieser Aufgabe wird erleichtert bzw. ermöglicht durch die Tatsache, dass unterschiedliche Regionen in heutigen Staatsgebilden teilweise sehr verschiedene historische Entwicklungen genommen haben, was sich dann in empirischen Analysen zur Identifikation kausaler Effekte verwenden lässt.
Ein m. E. wichtiger Punkt für dieses Forschungsfeld ist die Tatsache, dass sich die Forschung hier ganz unterschiedliche Ebenen von Informationen bzw. Daten zunutze machen
kann. Neben Daten für kleine regionale Einheiten eignen sich hier auch Mikrodaten, wobei hier neben den Ergebnissen von Befragungen auch Verwaltungsdaten eine potentiell
große Rolle spielen können. Darüberhinaus sind aber auch historische Archivarbeiten von
potentiellem Interesse, insb. für den Versuch, empirische Befunde durch Überlegungen
und Evidenz zu entsprechenden Wirkungskanälen für formale historische Institutionen zu
ergänzen. Insofern ergibt sich hier eine Komplementarität zwischen der Ausbeutung großer quantitativer Datensätze einerseits und Fallstudien andererseits. Damit wird auch
deutlich, dass sich dieses Feld sehr gut für die interdisziplinäre Zusammenarbeit eignet,
insb. einer Zusammenarbeit zwischen Ökonomie und Geschichte, wobei je nach konkreter Fragestellung Nachbardisziplinen wie bspw. Politikwissenschaft und Soziologie oder
Kulturwissenschaft auch eingebunden werden können bzw. müssen. Die konzeptionellen
Überlegungen in diesem Beitrag können daher auch als Plädoyer für eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit angesehen werden – wobei die Beforschung der Bedeutung
historischer Grenzen hier sicherlich nur eines von zahlreichen Feldern ist.
22
Institutionen und historische Grenzen
Literatur
Acemoglu, Daron, Davide Cantoni, Simon Johnson und James A. Robinson (2011): The Consequences of Radical Reform: The French Revolution, in: American Economic Review,
vol. 101, p. 3286–3307.
Alogoskoufis, George S. and Alan Manning (1988): Unemployment Persistence, in: Economic
Policy, vol. 7, p. 427–469.
Anderson, James E. und van Wincoop, Eric (2003): Gravity with Gravitas: A Solution to the
Border Puzzle, in: American Economic Review, vol. 93, p. 170–192.
Becker, Sascha O., Katrin Boeckh, Christa Hainz und Ludger Woessmann (2011): The Empire
Is Dead, Long Live the Empire! Long-Run Persistence of Trust and Corruption in the Bureaucracy, University of Warwick Working Paper No. 40.
Blanchard, Olivier J. und Larry H. Summers (1986): Hysteresis and the European Unemployment Problem, in: Fischer, Stanley (ed): NBER Macroeconomics Annual, Cambridge/Mass.,
p. 15–78.
Cheptea, Angela (2013): Border Effects and European Integration, in: CESifo Economic Studies,
vol. 59, p. 277–305.
Cross, Rod (ed.) (1988): Unemployment, Hysteresis and the Natural Rate Hypothesis, Oxford
1988.
Dixit, Avinash (1992): Investment and Hysteresis, in: Journal of Economic Perspectives, vol. 6,
p. 107–132.
Dopfer, Kurt (1991): Toward a Theory of Economic Institutions: Synergy and Path Dependency, in: Journal of Economic Issues, vol. 25, p. 535–550.
Feenstra, Robert C. (2004): Advanced International Trade. Theory and Evidence, Princeton
University Press.
Franz, Wolfgang (1987): Hysteresis, Persistence, and the NAIRU: An Empirical Analysis for
the Federal Republic of Germany, in: Layard, Richard and Lars Calmfors (eds.): The Fight
Against Unemployment, Cambridge, p. 91–122.
Gehler, Michael und Andreas Pudlat (Hrsg., 2009): Grenzen in Europa, Georg-Olms Verlag,
Hildesheim.
Geppert, Kurt und Andreas Stephan (2008): Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration, in: Papers In Regional Science, vol. 87, p. 193–217.
Graham, Frank (1927): Some Aspects of Protection Further Considered, in: Quarterly Journal of
Economics, vol. 37, p. 199–227.
Haslinger, Peter (Hrsg., 1999): Grenze im Kopf. Beiträge zur Geschichte der Grenze in Ostmitteleuropa, Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main.
Jerger, Jürgen (2012): Zur Akzeptanz politischer und marktwirtschaftlicher Reformen in Osteuropa: Empirische Befunde und Erklärungsansätze, Beitrag zur Jahrestagung 2012 des Wirtschaftspolitischen Ausschusses des Vereins für Socialpolitik, erscheint demnächst
Karaja, Elira (2013): The Rule of Karlowitz. Fiscal Change and Institutional Persistence, February
2013, mimeo.
Krugman, Paul R. (1991a): Geography and Trade, MIT Press
23
IOS Mitteilung Nr. 63
Krugman, Paul R. (1991b): History Vs. Expectations, in: Quarterly Journal of Economics, vol. 106,
p. 651–667.
Lemberg, Hans (Hrsg., 2000): Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle
Forschungsprobleme. Verlag Herder-Institut, Marburg.
McCallum, John (1995): National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns, in: The
American Economic Review, vol. 85, p. 615–623.
Mendelski, Martin und Alexander Libman (2011): History Matters, but How? An Example of
Ottoman and Habsburg Legacies and Judicial Performance in Romania, Frankfurt School
Working Paper No. 175.
North, Douglass (1990): Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press.
Reckwitz, Andreas (2008): Unscharfe Grenzen. Perspektiven der Kultursoziologie, transcript Verlag,
Bielefeld.
Sala-i-Martin, Xavier (1997): I Just Ran Two Million Regressions, in: American Economic Review,
vol. 87, p. 178–183.
Schäfer, Andreas und Thomas Steger (2010): History, Expectations, and Public Policy, CESifo
Working Paper No. 3184, September 2010.
Sengupta, Jati K. und Kumiko Okamura (1995): History versus Expectations: Test of New
Growth Theory, in: Applied Economics Letters, vol. 2, p. 491–494.
Tvrdon, Michal (2012): Cohesion Policy, Convergence and Regional Disparities: The Case of
the European Union, in: WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 9, p. 89–99.
Young, Allyn A. (1928): Increasing Returns and Economic Progress, in: Economic Journal,
vol. 38, p. 527–542.
24
- Item sets