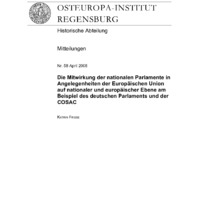Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in Angelegenheiten der Europäischen Union auf nationaler und europäischer Ebene am Beispiel des deutschen Parlaments und der COSAC
Item
- Title
- Identifier
- Creator
- has publication year
- Is Part Of
- volume
- has URL
- extracted text
-
Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in Angelegenheiten der Europäischen Union auf nationaler und europäischer Ebene am Beispiel des deutschen Parlaments und der COSAC
-
BV041754962
-
Friese, Katrin
-
2008
-
Mitteilungen OEI
-
58
-
https://www.dokumente.ios-regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_58.pdf
-
OSTEUROPA-INSTITUT
REGENSBURG
Historische Abteilung
Mitteilungen
Nr. 58 April 2008
Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in
Angelegenheiten der Europäischen Union
auf nationaler und europäischer Ebene am
Beispiel des deutschen Parlaments und der
COSAC
KATRIN FRIESE
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Masterarbeit in den Osteuropastudien (Master)
Hauptfach Rechtswissenschaft
Universität Regensburg
Manuskript fertiggestellt am 16. August 2006
Gutachter: Prof. Rainer Arnold, Prof. Jan Barcz
Redaktion: Hermann Beyer-Thoma
Satz: Larissa Schulz und Hermann Beyer-Thoma
OSTEUROPA-INSTITUT
REGENSBURG
Historische Abteilung
Landshuter Straße 4
D-93047 Regensburg
Telefon: 0941 / 943-5410
Telefax: 0941 / 943-5427
E-Mail: oei@osteuropa-institut.de
Internet: www.osteuropa-institut.de
ISBN 798-3-938980-16-3
2
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung.......................................................................................................................5
1.1 Gegenstand der Untersuchung.................................................................................5
1.2 Forschungsstand und Methodik...............................................................................8
2. Nationale Ebene: Mitwirkung der nationalen Parlamente in der Europapolitik...........9
2.1 Grundsätze...............................................................................................................9
2.2 Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten am Beispiel
Deutschlands........................................................................................................12
2.2.1 Die rechtlichen Voraussetzungen................................................................12
2.2.2 Mitwirkung des Deutschen Bundestages in EU-Angelegenheiten.............14
2.2.3 Mitwirkung des Bundesrates in EU-Angelegenheiten................................18
2.3 Überblick über die Mitbestimmung der nationalen Parlamente der EUMitgliedstaaten.....................................................................................................19
2.3.1 Variationen der parlamentarischen Mitbestimmung...................................19
2.3.2 Verbesserungspotentiale der parlamentarischen Mitbestimmung..............21
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente...................................................23
2.4.1 Funktionen und Unterschiede der Europa-Gremien....................................23
2.4.2 Das deutsche Parlament..............................................................................25
2.4.3 Das französische Parlament........................................................................29
2.4.4 Das polnische Parlament.............................................................................31
2.4.5 Das tschechische Parlament........................................................................33
2.4.6 Überblick über die Europa-Gremien der EU-Mitgliedstaaten....................34
3. Europäische Ebene: Mitwirkung und Zusammenarbeit der Parlamente.....................37
3.1 Regelungen im Primärrecht...................................................................................37
3.2 Zusammenarbeit des Europäischen Parlaments mit den nationalen Parlamenten. 39
3.2.1 Zur Notwendigkeit der Zusammenarbeit....................................................39
3.2.2. Rechtliche Bestimmungen des EP zur Zusammenarbeit mit
den nationalen Parlamenten........................................................................39
3.2.3 Entwicklungsphasen der Zusammenarbeit zwischen EP und
nationalen Parlamenten...............................................................................40
3.2.4 Instrumente und Aktivitäten des EP............................................................41
3.3 Zusammenarbeit der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene...................44
3.3.1 Überblick.....................................................................................................44
3.3.2 Konferenz der Parlamentspräsidenten.........................................................45
3.3.3 Zusammenarbeit der Fachausschüsse und Delegationsbesuche..................46
3.3.4 Verbindungsbüros der nationalen Parlamente in Brüssel...........................47
3.3.5 Zusammenarbeit im Bereich der Dokumentation und Information............47
3.3.6 Beziehungen zwischen den Parlamentsverwaltungen.................................49
3.3.7 COSAC – Die Konferenz der Europa-Gremien der
nationalen Parlamente.................................................................................49
3.4 Derzeitige interparlamentarische Kooperationen des deutschen Bundestages......50
4. Die COSAC – Ein Beispiel der parlamentarischen Kooperation auf
europäischer Ebene................................................................................................51
4.1 Organisation...........................................................................................................51
4.1.1 Entwicklung und Rechtsgrundlagen............................................................51
4.1.2 Struktur und Arbeitsweise entsprechend der Geschäftsordnung................54
3
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
4.1.3 Themen und Ergebnisse..............................................................................56
4.2 Die Rolle der COSAC als Demokratisierungsinstrument......................................59
4.2.1 Kompetenzen entsprechend der unionsrechtlichen Regelungen.................59
4.2.2 Die Wahrnehmung der Kompetenzen in der Praxis....................................60
4.2.3 Grenzen der Wirksamkeit............................................................................62
4.2.4 Ansätze der zukünftigen Rolle....................................................................64
4.3 Die COSAC und der Deutsche Bundestag............................................................65
5. Perspektiven der Mitwirkung nationaler Parlamente in EU-Angelegenheiten...........67
5.1 Bewertung der derzeitigen Mitwirkung.................................................................67
5.2 Perspektiven der Mitwirkung der nationalen Parlamente auf nationaler Ebene....68
5.2.1 Verbesserungspotentiale .............................................................................68
5.2.2 Perspektiven der Mitwirkung des Bundestages in EU-Angelegenheiten. . .70
5.3 Perspektiven der Mitbestimmung der nationalen Parlamente auf europäischer
Ebene....................................................................................................................73
5.3.1 Neue Rechte der nationalen Parlamente im Vertrag über
eine Verfassung für Europa........................................................................73
5.3.2 Weitere Vorschläge zur Erweiterung der parlamentarischen
Mitbestimmung...........................................................................................77
5.3.3 Perspektiven der interparlamentarischen Kooperation einschließlich
der COSAC.................................................................................................79
Anhang.............................................................................................................................81
A) Thesen.....................................................................................................................81
I. Nationale Ebene: Die aktuelle Situation und Verbesserungsvorschläge
für die parlamentarische Mitbestimmung in der EU..................................81
II. Situation im Deutschen Bundestag und Ansätze zur Verbesserung................82
III. Europäische Ebene: Zur aktuellen Situation und Perspektiven
der parlamentarischen Mitbestimmung in der EU......................................83
IV. Aufwertung der Rolle der nationalen Parlamente durch den Vertrag
über eine Verfassung für Europa................................................................84
V. Die Rolle der COSAC als wichtige Form der interparlamentarischen
Kooperation................................................................................................84
B) Tabellen..................................................................................................................86
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen...................................................................104
I. Rechtsgrundlagen Deutschland.......................................................................104
II. Rechtsgrundlagen der Europa-Gremien .......................................................113
III. Rechtsgrundlagen auf europäischer Ebene..................................................118
Abkürzungsverzeichnis.................................................................................................125
Literatur- und Quellenverzeichnis.................................................................................126
Literatur.....................................................................................................................126
Quellen.......................................................................................................................132
4
1. Einleitung
1. Einleitung
1.1 Gegenstand der Untersuchung
Durch die Besonderheiten der Rechtsordnung der Europäischen Union wurde es im
Rahmen der Europäischen Integration möglich, dass Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten
auf die supranationale Ebene übertragen werden können. Im Verfassungsrecht der ein
zelnen Mitgliedstaaten der EU bewirkt dies eine als „Europäisierung“ bezeichnete Ent
wicklung. Dies betrifft insbesondere die nationalen Parlamente1, die dadurch einen
Großteil ihrer ursprünglichen Funktionen auf die supranationale Ebene abgeben und so
mit ihre legislativen Kompetenzen mindern. Konkret bedeutet dies, dass das nationale
Parlament Kompetenzen an die jeweilige im Rat der EU (folgend Rat) vertretene Regie
rung abgibt. Die Vertreter der Regierungen im Rat, die legislativ tätig werden, erfahren
ihre demokratische Legitimation dadurch, dass das nationale Parlament eine Kontroll
funktion gegenüber der Regierung hat. Außerdem überwacht das Europäische Parla
ment (folgend EP) das Handeln des Rates bzw. es bestimmt mit ihm gemeinsam über
neue Gesetzgebungsakte der EU, verstärkt im Rahmen des Mitentscheidungsverfah
rens.2
Durch die nicht öffentlichen Sitzungen des Rates und die nur indirekte Rechen
schaftspflicht der Mitglieder des Rates gegenüber den Bürgern ist jedoch eine tatsächli
che, effektive Überwachung der Regierungen kaum gegeben. Eben dadurch sinkt das
demokratische Legitimationsniveau der EU ab. Der politische Prozess scheint immer
weniger durch nationale Parlamentswahlen oder die Wahlen zum EP für den Bürger
steuerbar.3
Außerdem wird von vielen Experten bemängelt, dass im Verhältnis mehr Rechte von
der nationalen auf die supranationale Ebene (und damit von den nationalen Parlamenten
an die Regierungen) übertragen wurden, als dass dies durch den Kompetenzzuwachs
des Europäischen Parlaments bzw. der nationalen Parlamente ausgeglichen werden
konnte. Viele Experten beklagen, dass auch dadurch die Handlungen der EU nicht aus
reichend demokratisch legitimiert seien.
Die Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen im Rat vermindert den Einfluss der
nationalen Parlamente noch zusätzlich, da somit Entscheidungen im Rat gänzlich ohne
1
2
3
Mit den in dieser Arbeit als nationale Parlamente bezeichneten Gremien sind die einzelstaatlichen
Parlamente der Mitgliedstaaten der EU gemeint.
Vgl. HUBER, PETER M. Die Rolle der nationalen Parlamente bei der Rechtssetzung der Europäischen
Union. Zur Sicherung und zum Ausbau der Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages. Mün
chen 2001, S. 7 (= aktuelle Analysen / Akademie für Politik und Zeitgeschehen, Hanns Seidel Stif
tung, Nr. 24); KIETZ, DANIELA Der Bundestag in der Europapolitik. Bestehende Potentiale und vom
Verfassungsvertrag eröffnete Möglichkeiten besser nutzen. SWP-Aktuell 19, Mai 2005, S. 1;
TOORNSTRA, DICK / ECPRD (Hg.) European Affairs Committees. The influence of national parliaments
on European policies. Brussels 2003, S. 10; KABEL, RUDOLF Die Mitwirkung des Deutschen Bundesta
ges in Angelegenheiten der Europäischen Union. Gedanken zur Umsetzung der Art. 23 und 45 GG in
die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, in: RANDELHOFER, ALBRECHT / SCHOLZ, RUPERT /
WILKE, DIETER Gedächtnisschrift für Eberhard Grabitz. München 1995, S. 245; MAURER, ANDREAS
Mehrebenenparlamentarismus: Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente als Quel
len demokratischer Legitimität im Vorfeld des Konvents. In: BUSEK, ERHARD / HUMMER, WALDEMAR
(Hg.): Etappen auf dem Weg zu einer europäischen Verfassung. Wien u.a. 2004, S. 205.
Vgl. PÖHLE, KLAUS Europäische Union à la Maastricht. Eine ernste Herausforderung für die Parlamen
te in der EG, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 24 (1993), S. 54; HUBER 2001, S. 7; KABEL 1995,
S. 245.
5
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
ihren Einfluss getroffen werden können, wenn eine Entscheidung von dem kontrollier
baren Vertreter ihrer Regierung im Rat abgelehnt wurde. Auch wenn also eine Regie
rung durch das jeweilige nationale Parlament beeinflussbar ist, kann diese vielleicht ih
re Meinung im Rat nicht durchsetzen.4 Den nationalen Parlamenten wird somit auf den
Politikfeldern, die durch die EU geregelt werden, die Möglichkeit zu einer eigenen poli
tischen Gestaltung entzogen. Die Gestaltungsspielräume, die bei der Umsetzung der
Richtlinien oder der Operationalisierung der Verordnungen bleiben, sind eher gering.
Demzufolge stehen die nationalen Parlamente als Verlierer im Prozess der Europäi
schen Integration da; in den Europäischen Verträgen wurden sie bisher kaum berück
sichtigt.5
Ein anderer Standpunkt zur Legitimation und zur Rolle der nationalen Parlamente in
der EU besagt, dass die Rechtssetzung der EU hinreichend legitimiert sei, da die Verträ
ge von den Mitgliedstaaten geschlossen und folglich auch von den nationalen Parlamen
ten ratifiziert worden seien. Zwar gäben die nationalen Parlamente einen Teil ihrer Auf
gaben ab, doch sie hätten dieser Veränderung zugestimmt und dadurch die folgenden
Rechtssetzungsprozesse legitimiert. Diese Besonderheiten müsse man zusätzlich unter
dem Aspekt betrachten, dass dieser Prozess der Europäischen Integration einzigartig,
ohne Vorbild oder Beispiel auf dieser Welt sei. Die nationalen Parlamente erführen so
mit keinen Bedeutungsverlust, sondern einen Bedeutungswandel; sie hätten bewusst auf
ihre Rechte verzichtet.6 Dennoch muss man eingestehen, dass die nationalen Parlamente
bei der Ratifizierung der Europäischen Verträge nicht automatisch die Möglichkeit ha
ben, inhaltlichen Einfluss auf die Verträge auszuüben und ihnen meistens nur die Mög
lichkeit bleibt, zuzustimmen oder abzulehnen.7
Die demokratische Legitimation der EU beruht auf zwei Pfeilern, zum einen auf dem
Europäischen Parlament und zum anderen auf den nationalen Parlamenten (duales Legi
timationsmodell).8 Das EP kann im Laufe der europäischen Integration auf ständig
wachsende Kompetenzen zurückblicken. Die nationalen Parlamente dagegen wurden
lange nicht als wichtige Akteure der Europapolitik angesehen; das änderte sich erst An
fang der 1990er Jahre.
Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten läuft wiederum
auf zwei Ebenen ab, nämlich auf nationaler und europäischer.9 Zum einen ist es ihre
Aufgabe auf nationaler Ebene, ihre Regierungen im Rat zu kontrollieren, und zum ande
ren können sie die Europapolitik selbst gestalten.
Alle Parlamente der Mitgliedstaaten der EU haben auf diesen Prozess der Europäi
sierung reagiert und bestimmte für Europa zuständige Gremien geschaffen (folgend Eu
ropa-Gremien), die die europapolitische Mitbestimmung der nationalen Parlamente ef
fektivieren sollen. Besonders wichtig ist dabei deren Rolle als Informations- und Koor
dinationsstellen. Sie sind Schlüsselstellen für die Reduzierung des Demokratiedefizits,
4
5
6
7
8
9
6
Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 10 f.
Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 10; RANGE, TATJANA Europäische Verfassung: Neue EU-Kom
petenzen für den Deutschen Bundestag. Befugnisse und Handlungsoptionen. Sankt Augustin 2004,
S. 3; HUBER 2001, S. 7; KABEL 1995, S. 245.
Interview mit Steffen Reiche, MdB, Berlin 19.6.2006.
Vgl. TÖLLER, ANNETTE ELISABETH Dimensionen der Europäisierung – das Beispiel des Deutschen Bun
destages, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 35 (2004), 1, S. 34 f.; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 11.
Vgl. TÖLLER 2004. S. 26; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 13.
Das Attribut „europäisch“ bezieht sich in dieser Arbeit auf die Europäische Union.
1.1 Gegenstand der Untersuchung
denn sie spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Transparenz und Demokra
tie bezüglich der EU-Aktivitäten.10
Eine weitere Möglichkeit des Wirkens der nationalen Parlamente in der EU ist ihre
Vernetzung auf europäischer Ebene. Diese Vernetzung findet derzeit schon in zahlrei
chen Kooperationsformen statt, auch oft in Zusammenarbeit mit dem EP. Eine dieser
Kooperationen ist die COSAC, die Konferenz der Europa-Gremien der nationalen Par
lamente der EU-Mitgliedstaaten.
Damit die nationalen Parlamente die „europäischen Aufgaben“ so effektiv wie mög
lich erfüllen können, bedarf es vielfältiger Voraussetzungen. Neben der Schaffung
rechtlicher Grundlagen auf europäischer und nationaler Ebene müssen auch die perso
nell-organisatorischen Voraussetzungen in den nationalen Parlamenten geschaffen wer
den. Genauso wichtig ist es, dass die neue Rolle der nationalen Parlamente von allen
Akteuren angenommen wird, also von den Regierungen, den europäischen Institutionen
und vor allem von den nationalen Parlamenten selbst.
Trotz der vielen Ansätze, die Mitbestimmung der nationalen Parlamente in EU-An
gelegenheiten zu stärken, weisen viele Studien nach11, dass die Mitwirkung der nationa
len Parlamente an der europäischen Politik bisher nur unzureichend ist. Ihre Rechte
bzw. deren effektive Anwendung seien nicht ausreichend und oftmals eher wirkungslos.
Bisher hätten die nationalen Parlamente auf die Europäisierung zwar auf formal-rechtli
cher und institutioneller Ebene reagiert, aber zu häufig noch nicht in der Praxis. Damit
werden sie ihrer neuen politischen Verantwortung in Europa noch nicht gerecht. Noch
immer sind sie auf der Suche nach ihrer Rolle im politischen System der EU und müs
sen verstärkt, neben der Konzentration auf die nationale Politik, die EU als wichtiges
Thema wahrnehmen, ein Umdenken aller Abgeordneten ist notwendig.
Abbildung 1: Untersuchungsgegenstand12
10 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 12 f.
11 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003; HUBER 2001; JANOWSKI, CORDULA AGNES Die nationalen Parlamente
und ihre Europa-Gremien. Legitimationsgarant der EU? Baden-Baden 2005.
12 Eigene Darstellung.
7
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
In dieser Arbeit werden die vorherrschenden Möglichkeiten der Mitbestimmung der na
tionalen Parlamente auf nationaler wie auf europäischer Ebene im europäischen Ent
scheidungsprozess untersucht sowie Potenziale der Verbesserung aufgezeigt (siehe Ab
bildung 1). Es werden am Beispiel des deutschen Parlaments die Prozesse der Mitbe
stimmung in EU-Angelegenheiten auf nationaler Ebene dargestellt. Insbesondere wird
die Sonderrolle des Europaausschusses des Deutschen Bundestages in diesem Prozess
erläutert sowie die Europa-Gremien weiterer Parlamente der EU-Mitgliedstaaten vorge
stellt und wichtige Unterschiede der Gremien herausgearbeitet. Außerdem werden For
men der Kooperation der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene untersucht,
u. a. mit dem Europäischen Parlament. Eine Möglichkeit der Zusammenarbeit der natio
nalen Parlamente auf europäischer Ebene wird anhand der COSAC detaillierter darge
stellt.
Ein Ausblick zeigt Entwicklungsrichtungen der einzelnen Ebenen und weitere Mo
delle der Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten auf.
Damit wird ein Pfeiler des dualen Legitimationsmodells genauer untersucht, nämlich
die Mitbestimmung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten und deren Per
spektiven sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Auf die Rolle des EP
als zweiter Pfeiler wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.
1.2 Forschungsstand und Methodik
Die Forschung befasst sich verstärkt seit Anfang der 1990er Jahre mit den nationalen
Parlamenten in der EU. Vorher stand vor allem das EP und seine Bedeutung für die Le
gitimation der EG im Vordergrund.13 Insbesondere nach der Unterzeichnung des Maas
trichter Vertrages wurden die nationalen Parlamente zu einem Forschungsobjekt. Viele
der Analysen blieben allerdings national orientiert; länderübergreifende Forschung ist
noch recht selten und öfter binational als multinational ausgerichtet. Auch wenn das In
teresse an der Rolle der nationalen Parlamente bei der Mitbestimmung in der EU seit
Anfang der 1990er Jahre gestiegen ist, bleibt es noch immer ein Nischenthema. Gerade
wegen der Erweiterung um zehn neue Mitgliedstaaten der EU im Mai 2004 wäre eine
verstärkte Forschung zu den nationalen Parlamenten und ihren Europa-Gremien sowie
deren Europatauglichkeit im Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten angebracht. In der
Wissenschaft wird dieses Thema bisher jedoch kaum aufgegriffen. Vereinzelt findet
man Studien, in denen einige wenige Mitgliedstaaten verglichen werden. Einzig im
Rahmen der COSAC werden Vergleichsstudien unter allen nationalen Parlamenten zu
verschiedenen Aspekten der Mitbestimmung in EU-Angelegenheiten durchgeführt. Au
ßerdem entstanden einige Studien zu Legitimationsmodellen der EU, die jenseits der
parlamentarischen Mitwirkung begründet liegen.14
Für die vorliegende Arbeit wurden neben einer umfassenden Analyse deutscher wie
internationaler Sekundärliteratur zu dieser Thematik die europäischen und nationalen
Gesetzestexte sowie die offiziellen Dokumente der relevanten Gremien untersucht. Da
zu gehören u. a. das Grundgesetz, weitere deutsche Gesetze sowie Dokumente des Bun
destages und des Bundesrates, rechtliche Regelungen anderer EU-Mitgliedstaaten zu ih
13 Vgl. NEUNREITHER, KARLHEINZ The European Parliament and National Parliament: Conflict or Coopera
tion, in: Journal of Legislative Studies, 11 (2005), 3–4, S. 466.
14 Zu nicht-parlamentarischen Legitimationsmodellen siehe JANOWSKI 2005, S. 236 ff.; auch MAURER
2004, S. 260 ff.
8
1.2 Forschungsstand und Methodik
ren Europa-Gremien oder zur parlamentarischen Mitbestimmung, Regelungen der EU
sowie Rechtsgrundlagen und Beiträge bestimmter Gremien der interparlamentarischen
Kooperation. Bedeutend dabei sind die Quellen der COSAC, u. a. ihre Geschäftsord
nung sowie die Schlussfolgerungen der einzelnen Sitzungen, die Dokumente und Ar
beitspapiere.
Eine weitere wichtige Informationsquelle war das Internet, besonders die Webseiten
der einzelnen nationalen Parlamente, des Europäischen Parlaments sowie anderer EUInstitutionen, der COSAC oder anderer europäischer Treffen. Zahlreiche Dokumente
sind über diese Internetseiten zugänglich.
Ergänzend zu der Literaturanalyse und Quellenarbeit wurden durch die Autorin In
terviews mit Experten geführt. Dies sind zum einen Bundestagsabgeordnete, die Mit
glieder des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen
Bundestag sind. Besonders zu erwähnen sind die persönlichen Interviews mit Michael
Roth, MdB, stellvertretender europapolitischer Sprecher, Berichterstatter zur COSAC
sowie Vorsitzender der Arbeitsgruppe Europäische Verfassung einer Bundestags-Frak
tion, und mit Steffen Reiche, MdB, sowie das schriftliche Interview mit Michael Link,
MdB. Zum anderen wurden Gespräche mit Mitarbeitern der Verwaltung des Bundesta
ges geführt. Diese sind u.a. für die Organisation und Vorbereitung von interparlamenta
rischen Treffen und Konferenzen zuständig. Dies ist besonders interessant, da Deutsch
land in der ersten Jahreshälfte 2007 die Ratspräsidentschaft inne hat und damit auch ei
ne COSAC, d.h. eine Konferenz der Europa-Gremien der Parlamente der EU-Mitglied
staaten, ausrichten wird. Des weiteren wird die Arbeit bereichert durch die von der Au
torin gesammelten Eindrücke und Erfahrungen eines Praktikums im Deutschen Bundes
tag und die dort geführten Gesprächen u.a. mit Mitarbeitern des Fachbereichs Europa
des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages.
2. Nationale Ebene: Mitwirkung der nationalen Parlamente in der Eu
ropapolitik
2.1 Grundsätze
Durch das Demokratieprinzip wird die Notwendigkeit der parlamentarischen Mitwir
kung in der EU begründet. Dieses Prinzip wird sowohl in den europäischen Verträgen
und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) als auch im Grundge
setz und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt. Dieses Prinzip
beinhaltet, dass die Demokratie, also die Herrschaft des Volkes, mit Hilfe der gewähl
ten, zu Parlamenten vereinigten Abgeordneten ausgeübt wird. Die Messung des demo
kratischen Standards eines Landes oder einer Organisation erfolgt demnach insbesonde
re durch die Messung des Einflusses der jeweiligen Parlamente. Für den demokrati
schen Standard in der EU heißt das, dass dieser an dem Einfluss des EP, der nationalen
Parlamente oder beider zusammen auf die Geschehnisse in der EU gemessen werden
kann.15
15 Vgl. HÖLSCHEIDT, SVEN Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der Euro
päischen Union, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“,
2000, 28, S. 31; dazu auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Maastricht-Urteil 1993: Bundes
9
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Die einzelstaatlichen Parlamente wirken derzeit bei der Annahme verschiedener Vor
schriften des Primär- und des Sekundärrechts der EU unmittelbar mit. Zur Mitwirkung
im Bereich des Primärrechts gehören die Ratifizierung der Verträge, auf denen die Uni
on beruht (auch bei Änderungen), die Assoziation von Staaten oder der Beitritt neuer
Mitgliedstaaten zur Union sowie die Ratifizierung von Vertragsänderungen aufgrund ei
nes internationalen Abkommens. Außerdem spielen die nationalen Parlamente eine Rol
le bei der Annahme bestimmter Beschlüsse des Sekundärrechts oder bei der Wahl der
Form und des Verfahrens für die Umsetzung der Zielvorgaben der EG-Richtlinien in in
nerstaatliches Recht.16
In den Gründungsverträgen der EU/EG gibt es keinerlei Bestimmungen zu einer di
rekten Mitwirkung der nationalen Parlamente im Gesetzgebungsprozess der EU/EG.
Die spezifischen Fragen der Kontrolle und Beteiligung der einzelstaatlichen Parlamente
an der EU-Gesetzgebung sind in erster Linie in der innerstaatlichen verfassungsrechtli
chen Gestaltung der einzelnen Mitgliedstaaten geregelt. Dadurch üben die verschiede
nen nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten ihre Kontrollaufgaben in unter
schiedlicher Intensität aus.
Die nationalen Parlamente haben Mechanismen eingeführt, um Einfluss auf die Ent
scheidungsfindung auf EU-Ebene zu nehmen und damit zu deren demokratischer Legi
timation beizutragen. Diese Mechanismen ähneln sich in den Grundzügen in den meis
ten Mitgliedstaaten. Sie bestehen aus den folgenden Hauptkomponenten: Zunächst
übermittelt die Regierung ihrem Parlament legislative EU-Dokumente, aus verfassungs
rechtlicher oder gesetzlicher Pflicht. Anschließend können alle nationalen Parlamente
über ihr Europa-Gremium oder das Plenum Stellung zu den Gesetzesentwürfen der EU
nehmen. Dadurch sind die Regierungen bei den Verhandlungen und Abstimmungen im
Rat der EU mehr oder weniger (politisch, meist nicht rechtlich) an die Stellungnahme
der nationalen Parlamente gebunden. Die Differenzierung der Beteiligung der nationa
len Parlamente ist zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten derzeit jedoch recht groß.17
In Abbildung 2 wird die Mitbestimmung der nationalen Parlamente der EU-Mit
gliedstaaten in EU-Angelegenheiten verallgemeinert dargestellt.
verfassungsgericht: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 89, 155. Urteil des Zweiten Senats
vom 12. Oktober 1993. Mehr dazu unter Punkt 2.2.1 (S. 12) dieser Arbeit.
16 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union: Bericht des
Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union (22. Ausschuss) gemäß § 93 a Abs. 4
der Geschäftsordnung zu den Schlussfolgerungen der XV. COSAC (Konferenz der Sonderorgane für
EU-Angelegenheiten) am 16. Oktober 1996 in Dublin – CONF/3973/96 – und zum Beratungsdoku
ment der Regierungskonferenz zur Revision des Maastrichter Vertrages – Aufzeichnung des irischen
Vorsitzes vom 19. November 1996 – CONF/3985/96 – Drucksache 13/6357 Nr. 3.1 und 3.2. – 13.
Wahlperiode. Drucksache 13/6891, 3. Februar 1997, S. 3; vgl. auch PÖHLE, KLAUS Das Demokratiede
fizit der Europäischen Union und die nationalen Parlamente. Bietet COSAC einen Ausweg? In: Zeit
schrift für Parlamentsfragen, 29 (1998), S. 86; MAURER, ANDREAS Parlamentarische Demokratie in der
Europäischen Union. Der Beitrag des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente. Ba
den-Baden 2002, S. 214; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 32.
17 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 3;
auch RANGE 2004, S. 3; CYGAN, ADAM JAN National Parliaments in an Integrated Europe. An AngloGerman Perspective. The Hague 2001, S. 11; KIETZ 2005, S. 2; WEBER-PANARIELLO, PHILIPPE A. Natio
nale Parlamente in der Europäischen Union. Eine rechtsvergleichende Studie zur Beteiligung natio
naler Parlamente an der innerstaatlichen Willensbildung in Angelegenheiten der Europäischen Union
im Vereinigten Königreich, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland. Baden-Baden 1995,
S. 306.
10
2.1 Grundsätze
Über die bisherigen Mitbestimmungsrechte der nationalen Parlamente hinaus werden
immer wieder verschiedene Forderungen laut, die unmittelbare Mitwirkung der nationa
len Parlamente zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit, sich kollek
tiv auf EU-Ebene zu Themen zu äußern. Dazu wurden verschiedene Modelle vorge
schlagen, u. a. auch eine Veränderung der Struktur und Arbeitsweise der COSAC, die
später näher erläutert wird.18
Abbildung 2: Darstellung der Mitbestimmung der nationalen Parlamente in der EU bei
der Entstehung von Sekundärrecht19
18 Siehe Punkt 3 (europäische Ebene, S.37) und 4 (COSAC, S.51) dieser Arbeit. Vgl. Deutscher Bun
destag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 4.
19 Entnommen aus MAURER 2002, S. 217.
11
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
2.2 Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten am
Beispiel Deutschlands
2.2.1 Die rechtlichen Voraussetzungen
Das Grundgesetz der BRD beschreibt Deutschland als parlamentarische Demokratie.
Demnach kommt dem Parlament die Rolle des zentralen Organs der Staatsleitung zu.
Außerdem erhält der Bund durch das Parlament seine demokratische Legitimation. Im
Grundgesetz (GG), der Verfassung Deutschlands, sind auch Demokratie und Volkssou
veränität bindend für die Staatsorganisation festgelegt. Der wichtige Artikel 20 GG be
sagt weiterhin, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, und hält damit fest, dass für
alle Äußerungsformen öffentlicher Macht in Deutschland eine konkrete demokratische
Legitimation durch das deutsche Volk notwendig ist.20
Die Erteilung demokratischer Legitimation und dadurch politischer Macht muss
durch in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Wahlen erfolgen. Da zunächst das
Parlament aus den demokratischen Wahlen hervorgeht, fällt ihm eine Schlüsselrolle als
zentrales Leitungs- und Steuerungsorgan des Staates zu. Im Grundgesetz wird dies
durch den Parlamentsvorbehalt sowie durch den rechtsstaatlichen Grundsatz des Vor
rangs und Vorbehalts des Gesetzes konkretisiert.21
Durch die Europäisierung des nationalen Verfassungsrechts werden nun Hoheits
rechte des Staates auf die EU übertragen. Bundesrat und Bundestag verlieren somit ihre
Entscheidungs- und Kontrollbefugnisse in dem Maße, in dem diese an die EU abgege
ben werden. Das demokratische Legitimationsniveau sinkt nun eben dadurch, dass da
mit jeder einzelne Wahlberechtigte an Einfluss auf den politischen Willensbildungsund Entscheidungsprozess verliert. Die Beteiligung der nationalen Parlamente in euro
päischen Angelegenheiten ist in erster Linie Sache der innerstaatlichen Rechtsord
nung.22
Für den Bundestag bedeutet dies, dass er seine Macht an die im Rat vertretene Bun
desregierung abgeben muss. Demokratisch legitimiert ist dies dadurch, dass die im Rat
vertretene Bundesregierung parlamentarisch verantwortlich ist. Bedenklich ist jedoch,
dass die Mehrheitsentscheidungen im Rat immer weiter ausgebaut werden (Art. 205
EGV). Das bedeutet, dass die demokratische Legitimation der Entscheidungen im Rat,
und damit der Rechtssetzung der EU, geringer wird. Denn es ist somit immer wieder
möglich, dass die Vertreter der Bundesregierung im Rat überstimmt werden und damit
Akte öffentlicher Gewalt entstehen, denen nicht die vom deutschen Volk legitimierten
Volksvertreter zugestimmt haben.23 Diese innerstaatliche Gewichtsverlagerung ist in
Deutschland erst Ende der 1980er Jahre ins allgemeine Bewusstsein gedrungen.
Die weitgehende Beteiligung von Bundestag und Bundesrat an EU-Angelegenheiten
ist gemäß den Artikeln 23 und 45 GG, die nach dem Vertrag von Maastricht (1992) in
das GG eingeführt wurden, in dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregie
rung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union
(EUZBBG; vom 12.3.1993) sowie in dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund
und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBLG; vom 12.3.1993)
20 Vgl. HUBER 2001, S. 8.
21 Vgl. HUBER 2001, S. 7 ff.
22 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 3;
auch RANGE 2004, S. 3; HUBER 2001, S. 10; BVerfGE 89, 155/182.
23 Vgl. KABEL 1995, S. 245; HUBER 2001, S. 11.
12
2.2 Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten am Beispiel
Deutschlands
festgehalten.24 Die Europapolitik ist der einzige Politikbereich, in dem das Verhältnis
zwischen Regierung und Bundestag bzw. Bundesrat in Form eines Bundesgesetzes ge
regelt ist.25
Im Bezug auf das Primärrecht wirken Bundestag und Bundesrat im Verfahren der
Vertragsänderung nach Art. 48 EUV mit. Somit macht jede inhaltliche Änderung des
EUV, EGV oder EAGV ein verfassungsänderndes deutsches Gesetz notwendig. Diese
Integrationsgesetze bedürfen weiterhin der Zustimmung des Bundesrates (gem. Art. 23
II Satz 2 GG) und sind als zustimmungspflichtige Gesetze zu behandeln. Man muss al
lerdings bemerken, dass das Parlament nicht bei der Aushandlung der Vertragsänderun
gen beteiligt ist, sondern einzig und allein bei der Ratifizierung.26
Die Mitwirkung des Parlaments hinsichtlich der sekundärrechtlichen Rechtssetzung
der EU wird in den Bestimmungen der Art. 23 und 45 GG geregelt. Es wird festgelegt,
dass die Bundesregierung den Bundestag und den Bundesrat umfassend und frühest
möglich unterrichten muss. Die Unterrichtungspflicht erstreckt sich auf alle Vorhaben
der EU, die für Deutschland von Interesse sein könnten, und bezieht sich speziell auf
die Übersendung von Entwürfen von Richtlinien und Verordnungen der EU, auf die Un
terrichtung über den wesentlichen Inhalt, das Ziel sowie das Verfahren zum Erlass des
Rechtsaktes sowie über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Befassung im Rat und der
dortigen Beschlussfassung. Außerdem beinhalten die genannten Artikel die Pflicht zur
Unterrichtung über die Willensbildung der Bundesregierung (Ergebnis) und über den
Stand der Verhandlungen auf europäischer Ebene.27 Problematisch ist jedoch, dass die
Bundesregierung bei der Zusendung von Informationen eine Selektion vornehmen kann,
wodurch die umfassende Unterrichtung des Bundestages und auch des Bundesrates
nicht gewährleistet ist. Man muss jedoch anmerken, dass das in der Praxis bestehende
Problem häufig darin besteht, dass aus der Fülle der zugeleiteten Informationen das
qualitativ und politisch Wichtige herausgefiltert werden muss.28
Bundesrat und Bundestag werden bezüglich der Unterrichtungspflicht der Bundesre
gierung und der darauf folgenden Stellungnahmen von der Bundesregierung unter
schiedlich behandelt. Während die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesta
ges berücksichtigen muss, muss sie die Stellungnahme des Bundesrates maßgeblich in
24 Bundesgesetzblatt: Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag
in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12.3.1993. Bundesgesetzblatt 1993 I, S. 311
[EUZBBG]; Bundesgesetzblatt: Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angele
genheiten der Europäischen Union vom 12.3.1993. Bundesgesetzblatt 1993 I, S. 313 [EUZBLG]. Das
Gesetz wurde im Hinblick auf die Unterrichtungsverfahren konkretisiert durch eine Vereinbarung
zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder über die Zusammenarbeit in EU-An
gelegenheiten vom 29.10.1993, Bundesanzeiger Nr. 226/1993, S. 10425.
25 Vgl. Deutscher Bundestag / FUCHS, MICHAEL Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union. Parlamentarische Behandlung der Europapolitik. Berlin 2002, S. 1.
26 Vgl. RANGE 2004, S. 4, HUBER 2001, S. 18.
27 EUZBBG § 1, 3, 4.
28 Vgl. HÖLSCHEIDT 2000, S. 32 f.; FUCHS, MICHAEL Art.23 GG in der Bewährung – Anmerkungen aus der
Praxis. In: Die Öffentliche Verwaltung 6/2001, Stuttgart 2001, S. 234, 238; Deutscher Bundestag /
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: Der Aktuelle Begriff. Behandlung von Uni
onsvorlagen im Deutschen Bundestag. Nr. 01/05, Berlin 22.12.2004, S. 1; MAURER, ANDREAS /
WESSELS WOLFGANG (Hg.): National Parliaments in their Ways to Europe: Losers or Latecomers? Ba
den-Baden 2001, S. 123; KABEL 1995, S. 242, 256; PFLÜGER, FRIEDBERT Die fortschreitende europäi
sche Integration und der Europaausschuss des Deutschen Bundestages, in: Integration 2000, 4,
S. 233; MAURER 2002, S. 237; JANOWSKI 2005, S. 92; FUCHS, MICHAEL Der Ausschuss für die Angele
genheiten der Europäischen Union des Deutschen Bundestages, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen,
35 (2004), Heft 1, S. 7; RANGE 2004, S. 4 ff.; HUBER 2001, S. 18 f.; CYGAN 2001, S. 117 f.
13
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
ihre Entscheidung einbeziehen.29 Auch bei der Informationsübermittlung ist der Bundes
rat gegenüber dem Bundestag besser gestellt. Derzeit laufen Verhandlungen, diese Un
gleichbehandlung abzuschaffen und den Bundestag auf gleiche Höhe mit dem Bundes
rat zu stellen.30 Das Informationsdefizit ist dabei nicht in erster Linie dadurch begründet,
dass dem Bundestag die europäischen Legislativvorschläge nicht vorliegen. Es besteht
vornehmlich darin, dass der Bundestag nicht umfassend und frühzeitig informiert wird
im Bezug auf die Aufbereitung der Vorlagen aus Brüssel und auf Berichte der Regie
rung, ob die Vorlagen relevant sind.31
Eine weitere wichtige rechtliche Grundlage zur Mitwirkung des Parlaments in EUAngelegenheiten wurde durch das Bundesverfassungsgericht gelegt. Es äußert sich in
seinem Maastricht-Urteil vom 12. Oktober 1993 in dem Sinne, dass die Aufwertung der
parlamentarischen Kontroll- und Mitwirkungsrechte des Parlamentes bei der Gestaltung
der Europapolitik notwendig sei. Die EU sei eine Union der Völker und als solche ein
auf eine dynamische Entwicklung angelegter Verbund demokratischer Staaten. Wenn
dieser Staatenverbund hoheitliche Aufgaben wahrnehme und hoheitliche Befugnisse
ausübe, seien es „zuvörderst die Staatsvölker der Mitgliedstaaten, die dies über die na
tionalen Parlamente demokratisch zu legitimieren haben. Mithin erfolgt demokratische
Legitimation durch die Rückkopplung des Handelns europäischer Organe an die Parla
mente der Mitgliedstaaten [...].“32 Das Bundesverfassungsgericht äußert sich in seiner
Maastricht-Entscheidung weiterhin zu dem Verhältnis von deutschem nationalen Ver
fassungsrecht und dem Verfassungsrecht der EU-Ebene und hält fest, dass „[...] mit dem
Ausbau der Aufgaben und Befugnisse der Gemeinschaft die Notwendigkeit [wachse],
zu der über die nationalen Parlamente vermittelten Legitimation und Einflussnahme ei
ne Repräsentation der Staatsvölker durch ein Europäisches Parlament hinzutreten zu
lassen, von der ergänzend eine demokratische Abstützung der Politik der Europäischen
Union ausgeht.“33 Mit diesem Urteil wandelte sich das Verständnis der Rolle des EP und
der nationalen Parlamente in der EU deutlich. Dieses duale Legitimationsmodell ent
spricht heute der herrschenden Meinung. Demnach stützt die EU ihre demokratische
Legitimation in erster Linie auf die nationalen Parlamente, die den Rat der EU durch ih
re Kontrolle demokratisch legitimieren, und nur ergänzend auf das EP.34
2.2.2 Mitwirkung des Deutschen Bundestages in EU-Angelegenheiten
Kompetenzen gemäß den Rechtsgrundlagen
Die Kernvorschrift des Artikel 23 GG regelt die Beteiligungsrechte des Parlaments zu
Fragen der EU und schreibt in Absatz II Satz 1 fest, dass der Bundestag „in Angelegen
heiten der Europäischen Union mitwirkt“.35 Die Angelegenheiten der EU umfassen alle
29 Vgl. KABEL 1995, S. 244; PFLÜGER 2000, S. 233; auch HÖLSCHEIDT 2000, S. 33; FUCHS 2001, S. 234,
239.
30 Genauer dazu Punkt 5.2.2 (S. 70) dieser Arbeit.
31 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin.
32 BVerfGE 89, 155/ 184 ff.
33 BVerfGE 89, 155/ 184 ff.
34 Vgl. HUBER 2001, S. 42; CYGAN 2001, S. 125; KABEL 1995, S. 241 und 247; HÖLSCHEIDT 2000, S. 31;
PFLÜGER 2000, S. 232 f.; FUCHS 2004, S. 7; JANOWSKI 2005, S. 18; WEBER-PANARIELLO 1995, S. 224, S.
240 ff.
35 Art. 23 GG.
14
2.2 Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten am Beispiel
Deutschlands
Vorhaben wie Richtlinien und Verordnungen, den Verlauf von Beratungen im Rat und
im Europäischen Parlament, die Mitteilungen der Kommission, ihre Stellungnahmen,
die Grün- und Weißbücher, Abkommen der EG mit Drittstaaten sowie Maßnahmen im
Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der polizeilichen und jus
tiziellen Zusammenarbeit, d.h. die parlamentarische Mitwirkung umfasst alle drei Säu
len des EU-Vertrages.36
Art. 23 III GG i. V. m. § 5 EUZBBG hält fest, dass der Bundestag gegenüber der Re
gierung Stellung nehmen kann, bevor die Bundesregierung in den Organen der EU
einen verbindlichen Standpunkt einnimmt. Folgend muss die Bundesregierung die Stel
lungnahme des Bundestages bei den Verhandlungen berücksichtigen. Dies bedeutet
aber nicht, dass die Bundesregierung an die Stellungnahme gebunden ist, da auch aus
reichend Gestaltungsspielraum bei der endgültigen Entscheidung im Rat gesichert wer
den muss. Wenn nun die Bundesregierung bei ihren Verhandlungen im Rat von der
Stellungnahme des Bundestages abweicht, so muss sie gegenüber dem Bundestag eine
höhere Begründungs- und Rechenschaftspflicht erfüllen. Die Stellungnahme des Bun
destages ist politisch, nicht rechtlich verbindlich. Dennoch kann der Bundestag durch
das Verfassen von Stellungnahmen eine Öffentlichkeit für EU-Angelegenheiten erzeu
gen.37
Anlässlich wichtiger internationaler Entscheidungen sowie europäischer Gipfeltref
fen werden im Bundestag und seinen Ausschüssen regelmäßig Debatten geführt. Im
Vorfeld der Treffen des Europäischen Rates fasst der Bundestag häufig einen Beschluss
zu den anstehenden Themen, wodurch die Verhandlungen der Regierung bei dem euro
päischen Treffen an das Mandat des Parlaments gebunden sind.38
Man muss allerdings festhalten, dass der Bundestag bislang keine Möglichkeit hat,
sich im Rahmen eines formellen Verfahrens an der Gesetzgebung der EU auf europäi
scher Ebene zu beteiligen.39
In Art. 45 GG wird die Einrichtung eines Ausschusses für die Angelegenheiten der
Europäischen Union (folgend Europaausschuss) in jeder Legislaturperiode geregelt. Auf
die Arbeit, Mitwirkung und Rolle des Ausschusses wird später detaillierter eingegan
gen.40 In Paragraph 93 und 93 a der Geschäftsordnung des Bundestages (GO-BT) wer
den alle Befugnisse geregelt, die allein dem Europaausschuss zustehen (93a). Außerdem
wird die Behandlung von Unionsvorlagen im Bundestag festgeschrieben (93).41
Das Beratungsverfahren der EU-Vorlagen im Bundestag
Das Zuleitungsverfahren beginnt damit, dass der Rat der EU die EU-Vorlagen an die
Bundesregierung übermittelt. Folgend werden diese der Bundestagsverwaltung durch
36 Vgl. PFLÜGER 2000, S. 233; HÖLSCHEIDT 2000, S. 32; KABEL 1995, S. 242; HUBER 2001, S. 17,19; FUCHS
2001, S. 234 f.; Deutscher Bundestag / Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2004,
S. 1.
37 Vgl. HÖLSCHEIDT 2000, S. 32 f., 38; FUCHS 2001, S. 234, 239; MAURER 2002, S. 237; RANGE 2004,
S. 6 f.; KABEL 1995, S. 242, 244; HUBER 2001, S. 19 f.; PFLÜGER 2000, S. 233.
38 Vgl. Deutscher Bundestag: Unterrichtung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages. Bericht
über die internationalen Aktivitäten und Verpflichtungen des Deutschen Bundestages. 15. Wahlperi
ode, Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 3; FUCHS 2001, S. 238.
39 Vgl. RANGE 2004, S. 3.
40 Dazu siehe Punkt 2.4.2 (S.25) dieser Arbeit.
41 Deutscher Bundestag: Geschäftsordnung des Bundestages; genauer zum Ablauf der Behandlung der
Unionsvorlagen und zum Europaausschuss in den Punkten 2.2.2 (S. 14) und 2.4.2 (S. 25) dieser Ar
beit.
15
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
das Bundesministerium für Finanzen, das die wesentlichen Koordinierungsaufgaben für
die Bundesregierung in EU-Angelegenheiten wahrnimmt, zugeleitet. Zusätzlich zu dem
jeweiligen Dokument enthält das Zuleitungsschreiben Angaben über die Notwendigkeit
einer europäischen Regelung, inhaltliche Schwerpunkte, das deutsche Interesse, finanzi
elle Auswirkungen sowie Angaben, wann der Ministerrat voraussichtlich den Kommis
sionsvorschlag berät und entscheidet.
Abbildung 3: Prozess der Behandlung von EU-Vorlagen im Deutschen Bundestag42
Nachdem die EU-Vorlagen eingegangen sind, schlägt das Europabüro, das innerhalb
der Verwaltung des Bundestages für EU-Dokumente verantwortlich ist, über ein kom
pliziertes Verfahren die jeweils zur federführenden bzw. mitberatenden Behandlung zu
ständigen Ausschüsse vor. Anschließend werden die Vorschläge im Namen des Vorsit
zenden des Europaausschusses an den Bundestagspräsidenten übermittelt, der sie im
Benehmen mit dem Ältestenrat an die Ausschüsse zur Beratung überweist.43 Nach der
Behandlung der EU-Vorlagen in den Ausschüssen verfassen die jeweiligen federführen
42 Angelehnt an RANGE 2004, S. 5.
16
2.2 Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten am Beispiel
Deutschlands
den Ausschüsse unter Einbeziehung der Berichte der mitberatenden Ausschüsse eine
Beschlussempfehlung für das Bundestagsplenum (nur ca. 5 % der EU-Vorlagen) bzw.
die Ausschüsse nehmen in den meisten Fällen die EU-Vorlagen ohne ausführliche Bera
tung zur Kenntnis. Das Bundestagsplenum wiederum folgt bei der Abstimmung meist
ohne Aussprache den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse und stimmt i.d.R. über
mehrere EU-Vorlagen gleichzeitig ab. Wenn allerdings schon die Ausschüsse die EUVorlagen nur zur Kenntnis nehmen, werden diese Vorlagen ohne Verlesung in einer
Anlage zum Plenarprotokoll veröffentlicht.44
Die Behandlung von EU-Vorlagen unterscheidet sich nach deren Inhalt. So werden
die Vorlagen, die europäische „Alltagsangelegenheiten“ betreffen, den jeweiligen be
treffenden Fachausschüssen zugeleitet. Grundsätzliche europapolitische Fragen werden
dagegen an den Europaausschuss gerichtet.45 Der erläuterte Ablauf wird in Abbildung 3
dargestellt. (Die speziellen Kompetenzen des Europaausschusses werden in Punkt 2.4.2
dieser Arbeit (S. 25) detaillierter erläutert.)
Das Zuleitungsverfahren der EU-Dokumente innerhalb des Bundestages dauert im
Durchschnitt zwei Wochen, kann aber auch durchaus länger dauern. Da auch schon die
Übermittlung der Vorlagen durch die Bundesregierung in der Regel ein bis zwei Wo
chen in Anspruch nimmt, kam es schon vor, dass der Bundestag EU-Vorlagen im Ple
num behandelte, als die entsprechenden EU-Rechtsakte bereits in Kraft getreten waren.
Aus dieser Tatsache erwächst die Gefahr, dass die Behandlung der EU-Vorlagen im
Bundestag politisch irrelevant wird. Es wird somit deutlich, dass eine effektivere Ein
flussnahme des Bundestages auf den europäischen Rechtssetzungsprozess nur möglich
ist, wenn er in einem deutlich früheren Stadium der Beratungen Einfluss nehmen kann.
Weiterhin müsste die Bundesregierung verstärkt über die Behandlung europäischer An
gelegenheiten im Bundestag informiert werden, um die Meinung der Parlamentarier zu
erfahren. Daraus sollte sich nicht nur ein informeller Meinungsaustausch entwickeln,
sondern die Bundesregierung sollte verstärkt verpflichtet werden, diese Meinungen
auch zu berücksichtigen, z.B. in Form von bindenden Stellungnahmen.46
Die Notwendigkeit der inhaltlichen Einflussnahme auf die europäische Rechtsset
zung durch den Bundestag ist dadurch begründet, dass derzeit ca. 35 % des deutschen
Rechtes auf EU-Initiativen zurückgeht47.
Ein positives Beispiel für die Mitwirkung der nationalen Parlamente ist die EUDienstleistungsrichtlinie, bei der durch den Bundestag über die EP-Parlamentarier und
über die Regierung (Arbeitsgruppe) verstärkt Einfluss auf die Rechtssetzung genommen
wurde.48 Noch nie zuvor war eine so große Zahl an Bundestagsabgeordneten während
der Beratungen zu einem Kommissionsvorschlag in Brüssel. Die intensiven Diskussio
43 GO-BT § 93, genauer dazu vgl. Deutscher Bundestag / Wissenschaftliche Dienste des Deutschen
Bundestages 2004, S. 1; KABEL 1995, S. 252 f.; Hölscheidt 2000, S. 37; JANOWSKI 2005, S. 95; FUCHS
2004, S. 19.
44 Vgl. Deutscher Bundestag / Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2004, S. 1; KABEL
1995, S. 254; HÖLSCHEIDT 2000, S. 37; WEBER-PANARIELLO 1995, S. 248, 254.
45 Vgl. KABEL 1995, S. 251.
46 Vgl. KABEL 1995, S. 253, 258; Hölscheidt 2000, S. 36 f.; MAURER / WESSELS2001, S. 136 ff.; SATTLER,
KARL-OTTO Abgeordnete wollen Gras wachsen hören, in: das Parlament, Nr. 13, 27.03.2006.
47 Offizielle Statistik des Bundestages zur 15. Wahlperiode des Deutschen Bundestages.
48 Interview mit Steffen Reiche, MdB, Berlin am 19.05.2006., Interview mit Michael Roth, MdB,
20.06.2006.
17
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
nen in Arbeitsgruppen, Fraktionen und Ausschüssen des Bundestages zeitgleich mit den
Beratungen des EP sollten Vorbild für die zukünftige Herangehensweise sein.49
2.2.3 Mitwirkung des Bundesrates in EU-Angelegenheiten
Im Art. 50 GG ist festgehalten, dass die Länder durch den Bundesrat in den Angelegen
heiten der EU mitwirken. Ergänzt wird dies durch die näheren Bestimmungen in Art. 23
II, IV bis VI GG sowie in dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern
in den Angelegenheiten der EU (EUZBLG).50
Die Beteiligung des Bundesrates in EU-Angelegenheiten drückt sich zum einen
durch Stellungnahmen des Bundesrates an die Bundesregierung aus und zum anderen
dadurch, dass die Ländervertreter ihre Interessen in verschiedenen Gremien wahrneh
men können. Zur Anfertigung einer Stellungnahme werden die EU-Vorlagen auch im
Bundesrat in Ausschüssen beraten, wobei in europapolitischen Angelegenheiten der
Ausschuss für Fragen der Europäischen Union federführend ist. Der Bundesrat kann
sich mehrmals zu einem Sachverhalt bzw. zu einem Dokument äußern, solange, bis es
die EU beschlossen hat. Dabei können die Stellungnahmen unterschiedliche Bindungs
wirkung haben. Der Bundesrat wird insoweit an der Willensbildung des Bundes in EUAngelegenheiten beteiligt, wie er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme
mitzuwirken hätte bzw. die Länder zuständig wären. Die Mitwirkung des Bundesrates
richtet sich dementsprechend nach dem Bereich der Gesetzgebung und den entsprechen
den Mitwirkungsrechten des Bundesrates auf der Ebene des Bundes. Die Bundesregie
rung muss die Stellungnahme des Bundesrates „maßgeblich“ berücksichtigen, wenn es
um Materien geht, die im Schwerpunkt die Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betref
fen, wenn möglich soll ein Einvernehmen zwischen Bundesrat und Bundesregierung
hergestellt werden. Zusätzlich liegt für Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebungsbe
fugnisse der Länder eine gesonderte Regelung vor.51 So besteht in diesen Fällen die
Möglichkeit (Soll-Regelung), die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte Deutsch
lands im Rat der EU auf einen Vertreter der Länder im Ministerrang, der vom Bundes
rat benannt wird, zu übertragen.52 Diese Soll-Regelung gilt unter dem Vorbehalt, dass
die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte im Rat unter Beteiligung und in Abstim
mung mit der Bundesregierung erfolgt, und sie ist außerdem in der Hinsicht problema
tisch, dass es dem Landesminister an demokratischer Legitimation und einzufordernder
parlamentarischer Verantwortung fehlt. Deshalb ist in begründeten Fällen von dieser
Regelung abzusehen. In allen anderen Politikbereichen, in denen die ausschließliche
Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz beim Bund liegt, berücksichtigt die Bun
desregierung die Stellungnahme des Bundesrates (Art. 23 Abs. 5 Satz 1 GG), sie ist
aber nicht daran gebunden.53
Zur Mitwirkung der Ländervertreter des Bundesrates ist zu erwähnen, dass sie auch
bei Beratungen der Kommission hinzugezogen werden. Sie sind weiterhin zusammen
mit der Bundesregierung an Arbeitsgruppen u.a. Gremien beteiligt.
49 Vgl. Frankfurter Rundschau: Axel Schäfer: Der Deutsche Bundestag sollte europäisch werden.
17.06.2006.
50 Vgl. HUBER 2001, S. 21.
51 Ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder siehe Art. 70 GG.
52 Nähere Regelungen dazu in § 6 Abs. 2 bis 4 EUZBLG.
53 Vgl. HUBER 2001, S. 21 ff.
18
2.2 Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten am Beispiel
Deutschlands
2.3 Überblick über die Mitbestimmung der nationalen Parlamente der EUMitgliedstaaten
2.3.1 Variationen der parlamentarischen Mitbestimmung
Der Einfluss und die Mitbestimmung in EU-Angelegenheiten variiert zwischen den ein
zelstaatlichen Parlamenten sehr stark, was vor allem auf die unterschiedlichen verfas
sungsrechtlichen Bestimmungen und parlamentarischen Traditionen zurückzuführen ist.
In den meisten Parlamenten ist ein Europaausschuss oder ein anderes Europa-Gremium
der Hauptakteur bei der Mitbestimmung in EU-Angelegenheiten, wobei meist auch die
Fachausschüsse mitwirken. Auf die einzelnen Europa-Gremien wird später genauer ein
gegangen.54
Es gibt verschiedene Kategorien, nach denen man die Parlamente einordnen kann.
Bezüglich der Überwachung von EU-Angelegenheiten haben sich in den 37 parlamenta
rischen Kammern der Parlamente der EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich zwei Systeme
herausgebildet. Während einige Kammern mit einem Dokumenten-basierten System ar
beiten, d.h. sie untersuchen EU-Dokumente, entwickelten andere Kammern Verfahrens
weisen, die sie ermächtigen, der Regierung ein Verhandlungsmandat für den Rat der EU
zu erteilen (Mandats-System). Eine kleine Gruppe von Parlamenten bzw. Kammern las
sen sich nicht diesen beiden Systemen zuordnen und haben eher informellere Wege der
Beeinflussung geschaffen. In der Praxis überlappen sich die dargestellten Systeme oft
mals.55
Die Parlamente, die verstärkt mit einem Dokumenten-basierten System arbeiten,
nutzten oftmals das Mittel des Parlamentsvorbehaltes. Hauptsächlich sind die Parlamen
te und ihre Ausschüsse darauf fokussiert, EU-Vorlagen zu untersuchen und deren recht
liche und politische Bedeutung zu überprüfen. Unterschiede gibt es darin, wie stark die
Minister bei ihren Verhandlungen im Rat formell oder informell an die Stellungnahmen
des Parlaments gebunden sind. Beispiele dieses Systems sind die beiden Kammern des
britischen Parlaments, das irische Oireachtas, die beiden Kammern des französischen
Parlamentes, die beiden Kammern des Tschechischen Parlaments, der Senat der Nieder
lande, das maltesische Parlament sowie die beiden Kammern des italienischen Parla
ments. Überlappende Modelle findet man in Finnland, Ungarn und Litauen.56
Vertreter des Mandats-Systems, bei dem die Regierungen für ihre Verhandlungen im
Rat die Stellung ihrer Parlamente bedeutend berücksichtigen müssen, sind das dänische
Parlament, die Parlamente Finnlands, Schwedens, Österreichs, Polens, Estlands, Lett
lands, Litauens, Ungarns, der Slowakei und Sloweniens. Zwischen diesen Parlamenten
bestehen nochmals deutliche Unterschiede. Prinzipiell arbeiten die Parlamente von Dä
nemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen (Sejm), Slowakei, Slowenien und
Schweden regelmäßig mit diesem System. In Österreich oder auch Ungarn wird es sel
tener verwendet. In den meisten Mitgliedstaaten, in denen das Mandats-System ange
wandt wird, ist die Regierung politisch gebunden und wird prinzipiell stark überwacht.
54 Genauer zu den Europa-Gremien siehe Punkt 2.4 (S.23) dieser Arbeit; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 8.
55 Vgl. COSAC: Models of scrutiny in national parliaments [http://www.cosac.eu/en/info/scrutiny/scru
tiny; Zugriff am 4.5.2006]; COSAC: Third bi-annual Report: Developments in European Union Pro
cedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Luxembourg, May 2005b, S. 7, 10, 14.
56 Vgl. COSAC 2005b, S. 10 f.
19
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
In Finnland, Ungarn und Polen können die Regierungen unter speziellen Umständen
vom Verhandlungsmandat abweichen, sie müssen dies jedoch gegenüber dem Parla
ment bzw. seinem Europa-Gremium begründen.57
Maurer teilt die gegenwärtig praktizierten Mitwirkungsverfahren der Parlamente in
zwei Hauptgruppen ein. Die eine Gruppe umfasst Parlamente, die sich durch einen dy
namischen, auf aktive Mitgestaltung am innerstaatlichen Entscheidungsprozess ausge
richteten Typ auszeichnen. Die andere Gruppe zielt eher auf die fallweise Sicherstel
lung der Rechenschaftspflicht der Regierungen und ihrer Vertreter ab und weist daher
weniger systematische Organisationsmerkmale auf. Die Parlamente der ersten Gruppe
zeichnen sich meist dadurch aus, dass ihre Europa-Gremien im innerparlamentarischen
System eine relativ starke Stellung einnehmen, dass die Mitwirkungsverfahren meist
frühzeitig einsetzen und dass die Frequenz der Ausschusssitzungen relativ hoch ist. Zu
dieser Gruppe zählen nach Maurer die Parlamente der nordischen Staaten, Deutsch
lands, Österreichs, der Niederlande, Großbritanniens und Frankreichs. Auch die meisten
osteuropäischen Staaten sind hier zuzuordnen. Auch die zweite Gruppe der nationalen
Parlamente verfügt über Europa-Gremien, jedoch ist deren Stellung im innerparlamen
tarischen Gefüge eher schwach ausgeprägt. Zu diesen Parlamenten gehört Belgien, Lu
xemburg, Irland und die südlichen Mitgliedstaaten (Spanien, Portugal, Italien, Grie
chenland). Frequenz und Erträge der Arbeiten dieser Parlamente in EU-Angelegenhei
ten sind daher vergleichsweise niedrig. Bezeichnend ist in diesen Ländern die relativ
stark ausgeprägte pro-europäische Haltung der Öffentlichkeit und der Mehrheit der po
litischen Parteien.58
Im Vergleich nutzt das dänische Parlament die durch das Amsterdamer Protokoll
eingeführten Mindestregeln der Beteiligung der nationalen Parlamente am umfassends
ten aus. Zentrales Merkmal ist, dass der Europaausschuss des dänischen Parlaments sei
ner Regierung Verhandlungsmandate für die Sitzungen des Ministerrates erteilt und so
mit erheblichen Einfluss auf die dänische Position im Rat hat. Ähnlich weitgehende
Einflussmöglichkeiten besitzt auch der Bundesrat gegenüber der Bundesregierung und
er nutzt diese auch tatsächlich aus.
Das finnische Parlament, der schwedische Reichstag, der österreichische Nationalrat
und der deutsche Bundestag sind hinsichtlich Mitwirkungsumfang, Mitwirkungsmana
gement und Wirkung auf die Regierung formal als relativ starke Parlamente einzustu
fen. Allerdings werden die vorhandenen Rechte weniger intensiv genutzt.59
Maurer stellt fest, dass sich die Parlamente Frankreichs und Großbritanniens nicht
eindeutig in eine der beiden Gruppen einordnen lassen. Beide Parlamente sind geprägt
von einer Dominanz von Fraktionen und Parteien, einer Orientierung der europapoliti
schen Grundhaltung am nationalen Nutzen sowie von einer eher von Konkurrenz ge
prägter Beziehung zum EP, und sie plädieren daher mehr für eine Stärkung der nationa
len Parlamente auf EU-Ebene.60
57 Vgl. COSAC 2005b, S. 10 f.; COSAC: Models of scrutiny in national parliaments [http://www.co
sac.eu/en/info/scrutiny/scrutiny; Zugriff am 4.5.2006].
58 Vgl. MAURER 2004, S. 241; MAURER 2002, S. 320.
59 Vgl. MAURER 2004, S. 243.
60 Vgl. MAURER 2004, S. 244.
20
2.3 Überblick über die Mitbestimmung der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten
2.3.2 Verbesserungspotentiale der parlamentarischen Mitbestimmung
Die Mitwirkung der nationalen Parlamente in der EU erstreckt sich, wie gezeigt, pri
märrechtlich auf die Ratifizierung von Änderungen oder Neuerungen der Verträge,
meist jedoch erst, nachdem im Rat Verhandlungsergebnisse erzielt worden sind. Auch
sekundärrechtlich sind die inhaltlichen Einflussmöglichkeiten der Parlamente eher ge
ring. Die Parlamente können zwar gegenüber ihren Regierungen Stellungnahmen für
die Verhandlungen im Rat abgeben, diese sind jedoch meist nicht bindend. Außerdem
ergibt sich aus der zu späten oder selektierten Information der Parlamente über europäi
sche Rechtssetzungsvorhaben, dass die Parlamente die Vorlagen oftmals zu spät bera
ten, um ihre Beratungsergebnisse noch in die Verhandlungen einfließen lassen zu kön
nen. Folglich müsste entweder die Information der Parlamente verbessert und die parla
mentarische Kontrolle sowie die Bindung der Regierungen an die Parlamente bei den
Verhandlungen im Rat erhöht werden oder man müsste einen Weg finden, auf dem die
Parlamente direkter in die europäischen Entscheidungsprozesse eingebunden würden.
Bezüglich der Mitbestimmung der nationalen Parlamente in der EU muss man wei
terhin darauf hinweisen, dass die Entscheidungen im Rat der EU zu 70 % auf eine poli
tische Einigung zurückgehen, die bereits auf einer unteren Arbeitsebene in einer Ar
beitsgruppe oder einem Ad-hoc-Ausschuss erzielt wurde. Weitere 15–20 % der Ent
scheidungen fallen im Ausschuss der Ständigen Vertreter, so dass im Rat selbst als BPunkte maximal 15 % aller EU-Vorlagen verhandelt werden. Fast 90 % werden hinge
gen in der Schlussabstimmung im Rat nur noch formal angenommen. Wenn sich die na
tionalen Parlamente nun an den Sitzungstagen des Rates orientieren und ihre Stellung
nahmen erst entsprechend spät vorlegen, können sie nur noch maximal 15 % der Ent
scheidungen beeinflussen.61
Weiterhin sind die Parlamente angehalten, ihre bisher schon bestehenden Rechte bes
ser zu nutzen, z.B. frühzeitig Informationen stärker einzufordern, die in Deutschland
u.a. durch das EUZBBG in großem Umfang schon zugesichert sind. Zu diesem Problem
zählt weiterhin, dass die Anzahl der Kommissions-Rechtsakte und anderer Dokumente
der EU-Organe enormen Umfang angenommen hat; zahlreiche Gesetzesvorschläge wer
den täglich auf den Weg gebracht und es ist für ein nationales Parlament derzeit kaum
möglich, sich mit jedem einzelnen Vorschlag intensiv zu beschäftigen. Oftmals sind die
vorhandenen personellen und organisatorischen Ressourcen in den Parlamenten einfach
nicht ausreichend, um die Stadien der EU-Entscheidungsprozesse effektiv zu kontrollie
ren.62
Bei dem Problem des Informationsdefizits der nationalen Parlamente geht es nicht
nur um die Quantität der Informationen, sondern auch um ihre Qualität, den Zeitpunkt
des Informationsaustausches sowie um die tatsächliche Möglichkeit der Parlamente,
diese Informationen zu nutzen, um die EU-Gesetzgebung zu beeinflussen.63 Die durch
den Verfassungsvertrag festgelegte frühzeitige Zuleitung von EU-Dokumenten durch
die Kommission wird als großer Fortschritt gelobt, da sich daraus anscheinend neue
Möglichkeiten einer frühzeitigen Befassung mit EU-Vorlagen für die Parlamente erge
ben. Eine wichtige Rolle spielt dabei z.B. das jährliche Legislativ- und Arbeitspro
gramm der Kommission, das eine Übersicht über die Planung der Gesetzesvorlagen für
das aktuelle bzw. das kommende Jahr liefert.
61 Vgl. MAURER 2004, S. 206; JANOWSKI 2005, S. 191.
62 Vgl. MAURER 2004, S. 206; JANOWSKI 2005, S. 52.
63 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 20 f.
21
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
An dieser Stelle muss auch etwas Kritik an der bisherigen Arbeitsweise der Parla
mente angefügt werden. Man muss klar stellen, dass ein großer Teil dieser Dokumente
schon jetzt öffentlich über die Homepage der Kommission oder andere EU-Organe zu
gänglich sind. Man findet so legislative Initiativen, das aktuelle Legislativ- und Arbeits
programm der Kommission für 2006, ausführliche Durchführungsberichte des vergan
genen halben Jahres sowie die genaue Vorausplanung für das nächste halbe Jahr – Do
kumente, die monatlich aktualisiert werden –, oder auch schon die jährliche Strategie
planung für 2007.64
Außerdem steht den Parlamenten im Internet das Legislative Observatory des EP mit
der OEIL-Datenbank zur Verfügung, über welche die Entwicklung der Legislativvorla
gen beobachtet werden kann und die eine Vorausschau für folgende Phasen liefert.65 Des
weiteren sind die Datenbanken des EP EPOQUE (vergangene legislative Verfahren)
und OVIDE (Informationen zu den Tagesordnungen des Plenums und der Ausschüsse
des EP u.a.) wichtige Informationsquellen für die nationalen Parlamente.66
Auch die Datenbanken von PreLex und EurLex auf der Homepage der EU folgen
den Hauptstationen des Entscheidungsprozesses von EU-Legislativvorlagen und verfol
gen die Arbeit der involvierten Institutionen.67
Man erkennt, dass die nationalen Parlamente grundsätzlich vielfältige Möglichkeiten
haben, an Informationen über den Stand der EU-Gesetzgebung zu gelangen. Trotz die
ses relativ einfachen Zuganges nutzen nur wenige Parlamente diese Möglichkeit. Bei
spielsweise beraten im litauischen Parlament die Fachausschüsse über das Legislativund Arbeitsprogramm der Kommission und unterbreiten anschließend dem EU- und
dem Auswärtigen Ausschuss die Legislativvorschläge entsprechend ihrer Relevanz. Das
litauische Parlament weiß somit schon jetzt lange im Voraus, welche Gesetzentwürfe im
Laufe des Jahres behandelt werden müssen.68
Obwohl nicht ausschließlich alle Dokumente der Kommission frei zugänglich sind,
sind schon jetzt über das Internet viele wichtigen Informationen zugänglich wie das
oben genannte Arbeitsprogramm sowie Grün- oder Weißbücher der Kommission, die
eine Einschätzung der zukünftigen Kommissionsvorschläge möglich machen. Dass dies
bisher noch nicht in allen Parlamenten genutzt wird, ist eigentlich unverständlich.
Wahrscheinlich liegt dies derzeit vor allem an den fehlenden personellen und organisa
torischen Ressourcen der Parlamente, um die riesige Masse an Initiativen der EU-Insti
tutionen kontinuierlich zu überwachen.69
Demzufolge ist dringend eine eigenständigere Befassung der nationalen Parlamente
mit den EU-Dokumenten notwendig, die nicht von den Regierungen zugeleitet werden.
Dazu gehören das oben genannte jährliche Legislativ- und Arbeitsprogramm, Grün- und
Weißbücher der Kommission, die Strategie- und Arbeitsprogramme des Rates, die Pro
tokolle der Sitzungen des Rates, u.a.70 Die Parlamente sind also zur effektiven Wahrneh
mung ihrer Aufgaben eigentlich in den wenigsten Fällen auf die Zuleitung von EU-Do
64 Europäische Kommission: Das Arbeitsprogramm der Kommission. Brüssel 2006 [http://ec.europa.eu/
atwork/programmes/index_de.htm; Zugriff am 24.5.2006]; Toornstra / ECPRD 2003, S. 20.
65 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 21; COSAC: Second bi-annual Report: Developments in
European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. The Hague, Novem
ber 2004a, S. 17 f.
66 Vgl. NEUNREITHER 2005, S. 480.
67 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 20; COSAC 2004a, S. 17 f.
68 Vgl. KIETZ 2005, S. 4.
69 Vgl. MAURER 2004, S. 206.
70 Vgl. KIETZ 2005, S. 5.
22
2.3 Überblick über die Mitbestimmung der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten
kumenten durch die Regierungen angewiesen, sondern eher auf die ergänzenden Be
richte der Regierungen zur Relevanz der jeweiligen Vorlagen. Diese sind für eine effek
tive Ausübung der Mitbestimmungen der nationalen Parlamente dringend notwendig.
Genauso wichtig wie die eigenständige Befassung des Parlaments ist die Information
jedes einzelnen Parlamentariers in europäischen Angelegenheiten. Oftmals sind diese
nur ungenügend über europäische Themen informiert. Ein Großteil der Parlamentarier
ist sich der Mitwirkungsmöglichkeiten beim Gesetzgebungsprozess in der EU über
haupt nicht bewusst, besonders die Mitglieder in den Fachausschüssen neben dem EUoder Auswärtigen Ausschuss.71
Nach der Betrachtung der Prozesse der Mitbestimmung der Parlamente in EU-Ange
legenheiten sollen nun die Gremien innerhalb der nationalen Parlamente betrachtet wer
den, die für die europäischen Themen zuständig sind.
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
2.4.1 Funktionen und Unterschiede der Europa-Gremien
Die Europa-Gremien72 der nationalen Parlamente sind die Organe der Parlamente, die
sich mit den Angelegenheiten der EU beschäftigen und als erste Anlaufstelle dafür gel
ten. Sie sind die formalisierteste und wahrscheinlich die wichtigste Verbindung der na
tionalen Parlamente mit der Entscheidungsfindung in der EU. Der erste Ausschuss für
Europaangelegenheiten wurde 1957 in Deutschland vom Bundesrat eingesetzt.
Heute gibt es in der EU kein einzelstaatliches Parlament, das keinen mit EU-Angele
genheiten betrauten Ausschuss oder ein ähnliches Gremium besitzt. Auch die Beitritts
kandidaten haben derartige Ausschüsse eingerichtet, die vor allem ihre Staaten auf eine
Vollmitgliedschaft vorbereiten sollen und die Aktivitäten ihrer Regierung im Hinblick
darauf überwachen. Insgesamt gibt es heute 34 Europa-Gremien in den 25 Mitgliedstaa
ten der EU.73 In einigen Mitgliedsländern wurde die Behandlung von Europaangelegen
heiten schon bestehenden Ausschüssen, z.B. dem Hauptausschuss des Parlamentes bzw.
dem Auswärtigen Ausschuss anvertraut (Österreich, Finnland, Portugal, Luxemburg),
meist wurde dann die Bezeichnung der Ausschüsse angepasst.74
Die Einrichtung dieser Europa-Gremien in den nationalen Parlamenten ist ein deutli
cher Hinweis auf das wachsende Bewusstsein unter den nationalen Parlamenten, dass
die Europapolitik nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens beeinflusst.75 Die EU-Poli
tik ist mittlerweile auch zur Innenpolitik der Mitgliedstaaten geworden.
71 Vgl. KIETZ 2005, S. 7.
72 In den meisten Parlamenten sind diese Europa-Gremien die Europaausschüsse der Parlamente. Da
die Europa-Gremien zum Teil auch eine andere Bezeichnung tragen, wurde diese verallgemeinerte
Bezeichnung gewählt.
73 Zwar gibt es 37 parlamentarische Kammern (12 Mitgliedsländer haben ein Zweikammerparlament);
zum Teil besitzen einige Parlamente mit einem Zweikammersystem jedoch nur ein gemeinsames Eu
ropa-Gremium (Belgien, Irland und Spanien).
74 Vgl. COSAC: The European affairs Committees of EU-25 [http://www.cosac.eu/en/info/scrutiny/eac;
– Zugriff am 4.5.2006]; COSAC: Fourth bi-annual Report: Developments in European Union Proce
dures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. London, October 2005a, S. 3; TOORNSTRA /
ECPRD 2003, S. 7; JANOWSKI 2005, S. 69.
75 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 7; FUCHS 2004, S. 22.
23
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Derzeit haben fast alle Europa-Gremien übereinstimmend die folgenden Aufgaben:
Ratifizierung (bzw. Vorbereitung der Ratifizierung) von Verträgen und Vertragsände
rungen, Befassung mit dem europäischen Sekundärrecht, die Kontrolle der nationalen
Regierungen und deren Beeinflussung bei ihrem Handeln im EU-Entscheidungsprozess
sowie z.T. die Übernahme der EU-Gesetzgebung oder Anpassung der nationalen Ge
setzgebung.76
Da die Parlamente auch bei der Schaffung eines Europa-Gremiums im Rahmen ihrer
Kompetenzen handeln müssen, ist es nachvollziehbar, dass auch diese Europa-Gremien
unterschiedlich organisiert und mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestattet sind.
Die wichtigste Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren und zu europäischen Themen
zu beeinflussen, kann beispielsweise sehr verschieden erfüllt werden, je nach dem, wel
che Kompetenzen das jeweilige Europa-Gremium hat. Die Regierung kann sowohl
durch einen rechtlich bindenden Beschluss des Ausschusses bzw. des Parlamentes ver
pflichtet werden oder aber auch nur über die Meinung informiert werden, ohne in ir
gendeiner Weise daran gebunden zu sein. Die Unterschiede der Europa-Gremien in den
Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten hängen somit stark von den unterschiedlichen
Strukturen und dem Einfluss des jeweiligen Parlamentes ab, zusammenhängend mit der
politischen Kultur und Geschichte des Landes. Wichtige Unterschiede bestehen in Grö
ße, Zusammensetzung, Kompetenzen, Informationszugang und Sitzungsfrequenz sowie
in der Beziehung zwischen Parlament und Regierung.77
Zu dem oben schon diskutierten Informationsproblem ist zu bemerken, dass auch das
interne Management jedes Parlamentes entscheidend ist, vor allem auch für den Zeit
punkt, wann eine Vorlage das Europa-Gremium letztendlich erreicht. Ein weiterer die
Europa-Gremien unterscheidender Faktor ist die Sitzungsfrequenz. Naheliegend ist,
dass ein Gremium umso effektiver ist, je öfter es tagt.78
Ein weiterer Unterschied ergibt sich daraus, inwieweit die Prozesse in einem EuropaGremium offen und transparent sind, d.h. inwieweit die Arbeit eines Gremiums der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht wird. Meist werden viele Informationen auf den Inter
net-Seiten der Ausschüsse veröffentlicht, regelmäßige öffentliche Sitzungen halten je
doch nur ungefähr die Hälfte der Europa-Gremien der EU-Mitgliedstaaten ab.79
Je nachdem, ob ein Parlament in einer Kammer oder in zwei Kammern organisiert
ist, kann ein Parlament eines EU-Mitgliedstaates ein oder zwei Europa-Gremien haben.
Wichtig für die demokratische Legitimation der EU sind besonders die Europa-Gremien
der Abgeordnetenkammern, da diese direkt von der Bevölkerung gewählt wurden.
Im folgenden werden die Europa-Gremien der Parlamente von vier Mitgliedstaaten
vorgestellt. Dabei erfolgt bewusst eine Konzentration auf die Europa-Gremien der Ab
geordnetenkammern. Der Deutsche Bundestag ist ein Beispiel für ein institutionell star
kes Parlament in Europaangelegenheiten. Die Französische Assemblée Nationale gilt
als ein Sonderfall80. Die polnische und die tschechische Abgeordnetenkammer sind Bei
spiele für die Ausstattung der Parlamente der neuen Mitgliedstaaten mit Europakompe
tenzen, wobei sich das polnische Parlament durch eine relativ starke Macht zur Bindung
76 Vgl. FUCHS 2004, S. 22; COSAC: The European Affairs Committees of EU-25. [http://www.cosac.eu/
en/info/scrutiny/eac; Zugriff am 4.5.2006]; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 10; MAURER 2002, S. 315.
77 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 20 f., 27; MAURER 2002, S. 317 ff.
78 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 21, 26.
79 Vgl. COSAC 2005b, S. 16.
80 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 126.
24
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
der Regierung an die Stellungnahme des Parlamentes auszeichnet, das tschechische Par
lament konzentriert sich mehr auf die Überprüfung von EU-Vorlagen.
2.4.2 Das deutsche Parlament
Das deutsche Parlament besteht aus Bundestag und Bundesrat (Ländervertretung). Bei
de Kammern haben Europa-Gremien eingerichtet.
Der Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union des Deutschen Bundesta
ges (Europaausschuss)
Nachdem oben die Mitbestimmung des Bundestages in EU-Angelegenheiten untersucht
wurde, soll nunmehr auf die Sonderrolle des Europaausschusses eingegangen werden.
Der Europaausschuss ist der zentrale europapolitische Ansprechpartner der Bundes
regierung im Bundestag und der zahlenmäßig größte, mit außerordentlichen Befugnis
sen ausgestattete Ausschuss. Grundsätzlich beschäftigen sich alle Fachausschüsse des
Deutschen Bundestages mit EU-Angelegenheiten, sofern sie ihren Fachbereich betref
fen. Der Europaausschuss ist dahingegen das Entscheidungszentrum der Europapolitik
im Bundestag.81
Zu seinen Aufgaben gehören die Kontrolle der Bundesregierung u.a. durch regelmä
ßige Berichterstattung zum Europäischen Rat und den Ministerräten, die Initiierung von
Debatten zu europäischen Themen im Plenum, die Behandlung von EU-Vorlagen oder
die Zusammenarbeit mit anderen nationalen europäischen Parlamenten in EU-Angele
genheiten (insbesondere mit Frankreich und Polen im Rahmen des Weimarer Drei
ecks).82
Der Art. 45 GG legt fest, dass der Bundestag in jeder Legislaturperiode einen Aus
schuss für die Angelegenheiten der EU schafft; seit der 13. Legislaturperiode (Dezem
ber 1994) ist dies der Fall. Durch die Institutionalisierung des Europaausschusses in der
Verfassung wird die besondere Bedeutung der Europapolitik hervorgehoben. 83 Einzigar
tig ist, dass Art. 45 GG vorsieht, dass die dem Bundestag zustehenden Kontrollkompe
tenzen eben alleine auf diesen Ausschuss übertragen werden können. Der Europaaus
schuss kann somit gemäß Art. 23 GG i.V.m. § 93 a III S. 2 bzw. nach § 93 a II GO-BT
gegenüber der Bundesregierung eine Stellungnahme abgeben, sofern nicht einer der be
teiligten Fachausschüsse widerspricht bzw. wenn das Plenum des Bundestages ihn dazu
ermächtigt.84 Damit kann die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung in Ange
legenheiten der EU ganz und gar an den Europaausschuss delegiert werden.85
81 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union: Europaaus
schuss 2000. Berlin 2001b, S. 3; PFLÜGER 2000, S. 229, 232; ROTH, MICHAEL Aus der Praxis des Deut
schen Bundestages, in: DIERINGER, JÜRGEN / MAUERER, ANDREAS / GYÖRI, ENIKÖ (Hg.): Europapolitische
Entscheidungen kontrollieren. Nationale Parlamente im Ost-West-Vergleich. Dresden 2005, S. 112;
FUCHS 2004, S. 9; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 47; COSAC 2005b, S. 37.
82 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union: Europaaus
schuss 2001. Berlin 2002b, S. 3 f.; Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der
Europäischen Union 2001b, S. 5.
83 Dieser besondere Bestandsschutz wird im Grundgesetz neben dem EU-Ausschuss nur dem Auswärti
gen Ausschuss, dem Verteidigungsausschuss und dem Petitionsausschuss zugesichert.
84 Art. 45 GG i.V.m. § 2 EUZBBG i.V.m. § 93 a Abs. 3 S. 2 GO-BT.
85 Vgl. KABEL 1995, S. 242, 247, 265; HUBER 2001, S. 21; FUCHS 2001, S. 235, 239; Deutscher Bun
destag: Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 2; PFLÜGER 2000, S. 234 f.; HÖLSCHEIDT 2000, S. 33
25
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
In der Parlamentspraxis wurde die Möglichkeit der Einzelermächtigung durch das
Plenum wegen des doch komplizierten Verfahrens der Beschlussfassung im Plenum bis
her nicht angewandt und hat somit keine große Bedeutung. Das Verfahren des plenarer
setzenden Beschlusses, wenn kein beteiligter Fachausschuss widerspricht, ist weitaus
einfacher und wird in der Praxis deutlich öfter angewendet, so z.B. bei der Stellungnah
me zum Konvent und zur Verfassungsdiskussion am 4. Juli 2001. Dieses Verfahren
wird vor allem dafür genutzt, um dem Parlament die Möglichkeit einer effektiven und
zeitnahen Einflussnahme auf die Verhandlungsführung der Regierung zu gewährleis
ten.86
Durch diese Stellungnahmen gibt der Ausschuss der Bundesregierung Richtlinien für
ihre Verhandlungen im Rat mit auf den Weg. Die Regierung muss die Stellungnahmen
des Ausschusses bzw. des Parlaments berücksichtigen, rechtlich wird sie allerdings
nicht gebunden. Trotzdem muss die Regierung nach den Verhandlungen im Rat das Par
lament über den Ausgang informieren und Rechenschaft ablegen, wenn sie sich nicht an
die Stellungnahme des Bundestages gehalten hat.87
Der Europaausschuss besteht in der Struktur des Bundestages zum einen als Integra
tionssausschuss, als Querschnittsausschuss sowie als Fachausschuss für europäische
Angelegenheiten. Als Integrationsausschuss wird hier die grundlegende Entwicklung
der Europäischen Integration federführend beraten, regelmäßig wird er vor und nach
den Ratstagungen unterrichtet. Im Rahmen der Unterrichtung kann der Europaausschuss
nicht selten die Bundesminister oder auch den/die Bundeskanzler/in begrüßen. Weiter
hin nehmen des öfteren Staatsminister, parlamentarische Staatssekretäre oder hochran
gige Beamte sowie auch Vertreter der Kommission oder anderer europäischer Organe,
Vertreter von Wissenschaft, Verbänden sowie auch zivilgesellschaftliche Akteure an
den Beratungen des Ausschusses teil bzw. sie werden zu Anhörungen geladen. Damit
wird deutlich, dass der Europaausschuss entsprechend seiner verfassungsmäßigen Stel
lung auch von der Bundesregierung als hochrangig wahrgenommen wird. Als Quer
schnittsausschuss wird der Europaausschuss tätig, wenn ein bestimmtes europapoliti
sches Vorhaben mehrere Politikbereiche berührt, aber kein klarer sachpolitischer
Schwerpunkt vorliegt. Als Fachausschuss für Europäische Angelegenheiten obliegt ihm
die Behandlung von EU-Vorlagen, wobei der Europaausschuss meistens mitberatend tä
tig wird. Zu diesen Vorlagen zählen insbesondere Vorhaben der EU, die für Deutsch
land von Interesse sein könnten, z.B. Grün- und Weißbücher der Kommission sowie
Entwürfe von Richtlinien und Verordnungen oder auch Unterrichtungen durch das EP.88
Der Europaausschuss setzt sich im Verhältnis der Stärke der Fraktionen des Bundes
tages derzeit aus 33 Bundestagsabgeordneten zusammen. Weitere Mitglieder des Aus
schusses sind 16 mitwirkungsberechtigte EP-Abgeordnete, letztere haben aber kein
f.; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 30; JANOWSKI 2005, S. 83, 90; FUCHS 2004, S. 11, 15; TÖLLER 2004,
S. 39; CYGAN 2001, S. 141; WEBER-PANARIELLO 1995, S. 240; ROTH 2005. S. 112 f., Deutscher Bundes
tag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 3.
86 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 3;
PFLÜGER 2000, S. 235; HÖLSCHEIDT 2000, S. 34; FUCHS 2001, S. 239; Deutscher Bundestag / Ausschuss
für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2002b, S. 11; JANOWSKI 2005, S. 90; FUCHS 2004,
S. 15; CYGAN 2001, S. 142.
87 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2001b, S. 3;
ROTH 2005, S. 112; COSAC 2005b, S. 37.
88 Vgl. HÖLSCHEIDT 2000, S. 34 f.; PFLÜGER 2000, S. 234 ff.; JANOWSKI 2005, S. 89; TOORNSTRA / ECPRD
2003, S. 47; ROTH 2005, S. 112; FUCHS 2004, S. 13, 19; Deutscher Bundestag / Ausschuss für die An
gelegenheiten der Europäischen Union 2001b, S. 4 f., 8; FUCHS 2001, S. 238.
26
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
Stimmrecht. Dennoch ist deren Teilnahme für Anregungen zu Verhandlungen bestimm
ter Themen sowie für einen Meinungs- und Informationsaustausch sehr wichtig. Prak
tisch nehmen die MEPs jedoch nur sehr selten an den Ausschusssitzungen teil, da sie
gleichzeitig im EP arbeiten müssen.89
Der Europaausschuss tagt einmal wöchentlich während der Sitzungsperiode und
kann außerhalb bei Notwendigkeit einberufen werden. Die Sitzungen sind in der Regel
nicht öffentlich. 90
Auffallend ist allerdings, dass der Europaausschuss nicht sehr oft im Rahmen seiner
Ausschussfunktion Beschlussempfehlungen für das Bundestagsplenum formuliert. Au
ßerdem macht er recht selten von seinen formalen Rechten Gebrauch, z.B. die Regie
rung durch eine Stellungnahme politisch zu binden. Die Gründe liegen vor allem in dem
bundestagsinternen komplexen Verfahren, was zu Zeitverzögerung und damit dazu
führt, dass die Beschlüsse ins Leere gehen. Es liegt aber auch daran, dass oftmals die
Ausschussmehrheit kein Interesse daran hat, die Regierung unnötig durch ein formales
Mandat einzuengen. Man sollte versuchen, die zeitliche Verzögerung bei der Bearbei
tung der EU-Vorlagen, die auf organisatorische und strukturelle Defizite schließen lässt,
deutlich zu vermindern, um die Bundesregierung in ihrer Europapolitik tatsächlich be
einflussen zu können. Man müsste weiterhin den Verhandlungsverlauf im Bundestag
stärker an den Verhandlungsverlauf auf der europäischen Ebene koppeln, damit Ent
scheidungen im Bundestag nicht erst nach den Entscheidungen auf europäischer Ebene
fallen. Außerdem müsste der Europaausschuss besser über die Entwicklung auf Rat
sebene informiert sein.91
Man muss außerdem bemerken, dass der Europaausschuss mit der großen Anzahl an
EU-Vorlagen überfordert ist. Oftmals ist es nicht möglich, einzelne Vorlagen intensiv
zu behandeln. Gerade für den einzelnen Abgeordneten ist es unmöglich, sich mit jeder
EU-Vorlage zu beschäftigen. Für die Zukunft wäre es deshalb wünschenswert, wenn
sich der Ausschuss besonders auf die Kontrolle der Regierung im Rat konzentrieren
könnte und die inhaltliche Arbeit zu EU-Vorlagen originär in den anderen Fachaus
schüssen erledigt würde.92 Dafür müsste ein Instrument geschaffen werden, um frühzei
tiger politisch relevante Themen herauszuarbeiten und die Dokumente zweckmäßig zu
selektieren.93
Man ist sich im Bundestag durchaus der Schwierigkeiten bewusst; eine unzureichen
de europapolitische Kontrolle der Regierung wird nicht geleugnet. Man befindet sich je
doch auf dem Weg, eine Rolle in Europa zu finden und Verbesserungen durchzusetzen.
Nicht zuletzt ist dafür notwendig, dass sich jeder einzelne Abgeordnete seiner europäi
schen Verantwortung bewusst wird und nicht nur national, sondern auch europäisch
denkt.94
89 Vgl. HÖLSCHEIDT 2000, S. 34; ROTH 2005, S. 113; FUCHS 2004, S. 9 f.; SATTLER 2006; CYGAN 2001,
S. 134; JANOWSKI 2005, S. 79, 94; MAURER 2002, S. 238; MAURER / WESSELS2001, S. 126; PFLÜGER
2000, S. 230, 236; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 30, 49; COSAC 2005b, S. 37.
90 Vgl. COSAC 2005b, S. 37; TOORNSTRA/ECPRD 2003, S. 49; JANOWSKI 2005, S. 90; FUCHS 2004, S. 18.
91 Vgl. Töller 2004, S. 39 f.; JANOWSKI 2005, S. 207 f., 221.
92 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin.
93 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 222.
94 Mehr zur aktuellen Entwicklung und Verbesserung in Punkt 5.2.2 (S. 70) dieser Arbeit. Vgl.
JANOWSKI 2005, S. 221 f.
27
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Der Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und die Europakammer des Bun
desrates
Seit 1993 hat der Bundesrat laut Art. 23 GG ein verfassungsmäßiges Recht auf die Mit
bestimmung in Angelegenheiten der EU. Genauere Festlegungen werden in dem Gesetz
zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der EU (EUZBLG) ge
troffen.95
Der für Europaangelegenheiten zuständige Ausschuss im Bundesrat ist der Aus
schuss für Fragen der Europäischen Union, der im Jahr 1957 als erster in einem der
EU-Staaten gegründete Ausschuss für Europäische Angelegenheiten. Er wurde mit dem
Ziel geschaffen, größeren Einfluss auf die Bundesregierung in der Europapolitik aus
zuüben.96
Er hat 17 Mitglieder97, wobei jedes Bundesland einen Vertreter entsendet. Oft sind
dies von den Landesregierungen ernannte Beauftragte auf Beamtenebene, zum Teil aber
auch die Ministerpräsidenten. Der Ausschuss tagt während der Sitzungsperiode aller
drei Wochen. Sondersitzungen sind möglich. In der Regel werden die Sitzungen nicht
öffentlich abgehalten.98
Die wichtigste Aufgabe des Ausschusses sind die Auswahl und Diskussion der EUVorlagen, die von der Regierung zugeleitet wurden. Er berät alle Dokumente federfüh
rend, die für die Länder von Interesse sind. Der Ausschuss prüft die Vorlagen nach eu
ropa- und integrationspolitischen Überlegungen und achtet besonders darauf, ob die je
weilige Vorlage eine ausreichende europarechtliche Rechtsgrundlage hat und ob die
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. In Zusam
menarbeit mit den Fachausschüssen formuliert er Beschlussempfehlungen, die an die
Regierung übermittelt werden sollen. Dabei überwacht der Ausschuss weiterhin, ob die
Regierung die Stellungnahme des Bundesrates bei ihren Verhandlungen maßgeblich be
rücksichtigen muss, je nach dem, ob Länderkompetenzen bei einer EU-Vorlage betrof
fen sind. Nach einer Entscheidung im Rat wird geprüft, inwieweit die Stellungnahme
des Bundesrates berücksichtigt wurde. Weiterhin überwacht der Ausschuss, ob das
Mandat zur Verhandlung in Foren der EU an einen Vertreter der Länder übergeben wer
den sollte, wenn Länderinteressen betroffen sind.99
95 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 50.
96 Bei der Gründung im Jahre 1957 wurde er als Sonderausschuss „Gemeinsamer Markt und Freihan
delszone“ eingerichtet und 1965 in einen ständigen Ausschuss für Fragen der EG umgewandelt. Seit
dem Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages trägt er seine heutige Bezeichnung. Vgl. TOORNSTRA /
ECPRD 2003, S. 7; Bundesrat: Ausschuss für Fragen der Europäischen Union. Berlin 2006a [http://
www.bundesrat.de/cln_050/nn_9028/DE/organe-mitglieder/ausschuesse/eu/eu-node.html_nnn=true;
Zugriff am 9.7.2006]; COSAC 2005b, S. 38.
97 Bayern ist derzeit mit zwei Repräsentanten vertreten.
98 Vgl. COSAC 2005b, S. 38; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 30, 51; Bundesrat 2006a; MAURER 2002,
S. 238.
99 Beispielhaft für die Übertragung der Verhandlungsführung auf Ländervertreter sind zu nennen die
Beschlüsse des Bundesrates in BR-Drucksachen 803/94 (Fernsehrichtlinie) oder zu Drucksache
294/94 (Kommunalwahlrecht). Es kommt allerdings auch häufiger vor, dass der Bundesrat eine ent
sprechende Übertragung der Verhandlungsführung gemäß § 6 Abs. 2 EUZBLG fordert und diesem
Anliegen seitens der Bundesregierung widersprochen bzw. nicht Rechnung getragen wird. In der
Praxis verhält es sich so, dass auch in den Fällen, in denen die Verhandlungsführung auf die Vertre
ter der Länder übertragen wurde, die Vertreter der Bundesregierung zumindest als Beobachter eben
falls zugegen waren. (Informationen aus einer E-mail vom Bundesrat vom 28.7.2006); Vgl. TOORN
STRA / ECPRD 2003, S. 50; Bundesrat: Ausschuss für die Fragen der Europäischen Union. Aufgaben.
Berlin 2006b. [http://www.bundesrat.de/cln_050/nn_9076/DE/organe-mitglieder/ausschuesse/eu/eu-
28
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
Auf internationaler Ebene arbeitet der Ausschuss regelmäßig mit den Europa-Gremi
en anderer EU-Mitgliedstaaten oder Beitrittskandidaten zusammen und nimmt an der
COSAC teil.100
Der Bundesrat zählt zu seinen Gremien ein weiteres mit Europaangelegenheiten be
trautes Organ, die seit 1993 existierende Europakammer. Deren Einrichtung ist nach
Art. 52 IIIa GG vorgesehen. Ihre Beschlüsse gelten als Beschlüsse des Bundesrates.101
Da das Bundesratsplenum nur elf- bis zwölfmal im Jahr tagt, und dies nicht ausreichend
ist, um die Rechtssetzungsprozesse in der EU wirkungsvoll zu begleiten, kann die Euro
pakammer eingesetzt werden, wenn schnellere Reaktionen des Bundesrates erforderlich
sind.102
Die Europakammer hat 16 Mitglieder, wobei jedes Bundesland einen Vertreter ent
sendet. In der Regel tagt die Europakammer öffentlich. Bei Abstimmungen werden die
Stimmen wie im Plenum gewichtet. Man muss allerdings bemerken, dass der Bundesrat
die Europakammer nur sehr selten nutzt, seit ihrer Gründung tagte sie erst drei mal.103
Die Instanz bleibt zu oft ungenutzt.
Im Rahmen der Föderalismusreform sind u.a. Veränderungen im Aufgabenbereich
der Europakammer geplant. So ist sie u.a. als ein Instrument für die schnelle Reaktion
im Rahmen des Frühwarnmechanismus vorgesehen.
2.4.3 Das französische Parlament
Das französische Parlament, ein Zweikammerparlament, besteht aus der Nationalver
sammlung (Assemblée Nationale), die direkt vom Volk gewählt ist, und dem französi
schen Senat (Sénat), der die Interessen der einzelnen Départements vertritt.104
Da die Verfassung von 1958 vorsieht, dass es nur sechs Fachausschüsse des Parla
ments auf Verfassungsebene geben darf, konnten die Gremien für Europaangelegenhei
ten nicht als verfassungsrechtlich festgeschriebene Ausschüsse gegründet werden und
erhielten die Bezeichnung „Délegation“. So wurde am 6. Juli 1979 ein Gesetz verab
schiedet, das in der Nationalversammlung und im Senat jeweils einen Ausschuss für die
Europäischen Gemeinschaften vorsieht.105
Die Rechtsgrundlage für die parlamentarische Kontrolle der Regierung in Europäi
schen Angelegenheiten ist Art. 88-4 der Verfassung, der im Juni 1992 im Zuge der Ver
abschiedung des Maastrichter Vertrages eingefügt und 1999 neu gefasst wurde. Die Re
gierung wird verpflichtet, der Nationalversammlung und dem Senat unverzüglich die
EU-Vorlagen weiterzuleiten, die Gesetzescharakter haben. Ob eine Vorlage Gesetzes
inhalt.html; Zugriff am 9.7.2006]; COSAC 2005b, S. 38.
100 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 51.
101 Grundgesetz Art. 52 IIIa; HUBER 2001, S. 24; Bundesrat: Europakammer. Berlin 2006e. [http://www.
bundesrat.de/cln_050/nn_8330/DE/organe-mitglieder/europakammer/europakammer-node.html_nnn
=true; Zugriff am 9.7.2006]; COSAC 2005b, S. 38.
102 Vgl. Bundesrat 2006e.
103 Die Europakammer tagte am 18.8.1993, 8.12.1993 und am 6.12.1995. Sie hat also seit über 10 Jahren
nicht mehr getagt. Vgl. Bundesrat 2006c.
104 Vgl. HUBER 2001, S. 12.
105 Gesetz vom 6. Juli 1979 (Nr. 79–564), erweitert durch die Gesetze vom 10. Mai 1990 (Nr. 90–385)
und 10. Juli 1994 (Nr. 94–476); TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 42; HUBER 2001, S. 30; JANOWSKI 2005,
S. 58, 128; WIEBER, RICHARD GEORG Die Stellung des französischen Parlaments im europäischen
Normsetzungsprozess gemäß Art. 88–4 der französischen Verfassung der V. Republik. Frankfurt
a.M. 1999, S. 63.
29
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
charakter hat, entscheidet der Staatsrat. Weiterhin wird die Regierung ermächtigt, auch
alle anderen Dokumente vorzulegen, bei denen eine Stellungnahme des Parlamentes
zweckdienlich wäre. Damit wurde die Unterrichtungspflicht der Regierung auch auf die
zweite und dritte Säule ausgedehnt, wenn die jeweiligen EU-Dokumente Gesetzescha
rakter haben. Das Parlament wird ermächtigt, Entschließungen im Rahmen dieses Arti
kels zu fassen. Die Beschlüsse des Parlaments haben jedoch keine rechtliche Bindungs
wirkung für die Regierung.106
Die Delegationen haben die Aufgabe, die ihnen zugeleiteten Dokumente systema
tisch zu untersuchen und die Ergebnisse dieser Untersuchungen in sogenannten Infor
mationsberichten zu veröffentlichen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Kontrolle
der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.107
Die Arbeit der Delegationen wird durch den Parlamentsvorbehalt (réserve d'examen
parlementaire) gestärkt, der auf Dokumente angewandt werden kann, die im Rahmen
des Artikel 88-4 der Verfassung weitergeleitet wurden. Dem Parlament, also der Natio
nalversammlung oder dem Senat, ist es somit möglich, in einer Zeitspanne von mindes
tens einem Monat ab der Zuleitung einer legislativen EU-Vorlage seine befürwortende
oder ablehnende Stellungnahme dazu abzugeben, bevor die Regierung eine Entschei
dung im Rat trifft. Dieser Parlamentsvorbehalt wird sehr umfangreich genutzt, d.h. die
Regierung fragt immer nach dem Standpunkt des Parlaments, bevor ein Text im Rat an
genommen wird. Allerdings sind die Stellungnahmen der Delegationen nicht bindend.108
Délégation de l'Assemblée Nationale pour l’Union européenne – Die Delegation der
Nationalversammlung für die Angelegenheiten der EU
Die Delegation der französischen Nationalversammlung hat 36 Mitglieder, mit einer
Sitzverteilung entsprechend den Stärkeverhältnissen der politischen Parteien und einer
ausgeglichenen Repräsentation der ständigen Ausschüsse. Ähnlich wie im Europaaus
schuss des Bundestages können die französischen Mitglieder des EP beratend an den
Sitzungen teilnehmen; sie haben jedoch kein Stimmrecht. Eine kontinuierliche Mitarbeit
ist allerdings nicht vorgesehen. Die Delegation kann Experten, Vertreter von Institutio
nen der EU oder auch die Mitglieder der jeweiligen Fachausschüsse des EP einladen
bzw. anhören. Die Delegation hat außerdem das Recht, Regierungsmitglieder zu Anhö
rungen zu verpflichten. Zusätzlich wird einmal im Monat eine Fragestunde an die Re
gierung speziell zu Europaangelegenheiten durchgeführt. Die Delegation tagt ein- bis
zweimal pro Woche während der Sitzungsperiode der Assemblée Nationale. Während
der sitzungsfreien Zeit trifft sich die Delegation, wenn es notwendig ist. In der Regel
sind die Sitzungen nicht öffentlich.109
Die Aufgaben der Delegation sind zum einen, die Nationalversammlung über die Ar
beit der Institutionen der EU zu informieren, speziell durch die Veröffentlichung der In
formationsberichte, und zum anderen das Handeln der Regierung in Europaangelegen
106 Art. 88-4 der Französischen Verfassung; COSAC 2005b, S. 34; HUBER 2001, S. 29; Assemblée Na
tionale: Die Delegation der Nationalversammlung für die Europäische Union. Paris, November 2003,
S. 19; JANOWSKI 2005, S. 130; HUBER 2001, S. 29; WIEBER 1999, S. 79f., 106.
107 Vgl. HUBER 2001, S. 30.
108 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 43; Assemblée Nationale 2003, S. 22; JANOWSKI 2005, S. 131; CO
SAC 2005b, S. 34.
109 Vgl. COSAC 2005b, S. 8, 17; MAURER 2002, S. 239; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 30, 43 f.; Assem
blée Nationale 2003, S. 8, 11 f.; JANOWSKI 2005, S. 129 ff.; HUBER 2001, S. 30.
30
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
heiten zu überwachen. Sie ist dafür zuständig, die gemeinschaftlichen Rechtsakte vorab
zu kontrollieren, und zwar all die Texte, die ihr nach Art. 88-4 der Verfassung von der
Regierung zugeleitet werden. Die Ergebnisse der Beratung werden anschließend in
Form eines Entschließungsantrages an den zuständigen ständigen Ausschuss der Natio
nalversammlung zur Prüfung überwiesen. Der Ausschuss nimmt zu dem Antrag Stel
lung, er kann ihn unverändert annehmen, abändern oder ablehnen. Außerdem kann der
Entschließungsantrag auf die Tagesordnung der Nationalversammlung gesetzt werden.
Somit nimmt die Delegation Sichtungs-, Selektions- und eigenständige Kontrollaufga
ben wahr.110
Ein spezielles Verfahren ermöglicht eine endgültige Annahme einer Entschließung
durch die Delegation, es sei denn ein anderer Ausschuss oder ein Fraktionsvorsitzender
stellt einen Antrag auf Aussprache im Plenum. Diese Entschließung wird wie die im
Plenum beschlossenen Entschließungen der Regierung zugeleitet. Eine Entschließung
hat lediglich politischen Charakter, sie sind für die Regierung nicht rechtlich bindend,
allerdings muss sie berücksichtigt werden.111
Eine der wichtigen Tätigkeiten der Delegation ist die Förderung der interparlamenta
rischen Zusammenarbeit. Sie pflegt ständigen Kontakt zu den Parlamenten der Mit
gliedstaaten der EU sowie der Beitrittskandidaten, meist auf bilateraler Ebene. Häufig
werden die Abgeordneten vom EP nach Brüssel eingeladen, um mit den MEPs über
vielfältige Fragen zu diskutieren. Genauso lädt die Nationalversammlung Mitglieder des
EP zu gemeinsamen Sitzungen ein. Außerdem nimmt die Delegation regelmäßig an der
COSAC teil.112
Eine Schwäche der Delegation ist es, dass sie den ständigen Ausschüssen der Assem
blée Nationale nachgeordnet ist. Zwar hat sich die Beziehung zu den Ausschüssen seit
Beginn der 1990er Jahre deutlich verbessert, dennoch begegnen die Ausschüsse der De
legation immer noch mit Skepsis. Nur selten werden Berichte der Delegation in Be
schlussvorlagen an das Plenum umgesetzt. Somit existiert in der Assemblée zwar ein
engagiertes Europa-Gremium, jedoch geht von der Delegation keine effektive europa
politische Kontrolle der französischen Regierung aus.113
2.4.4 Das polnische Parlament
Das polnische Parlament besitzt wie die anderen hier vorgestellten Parlamente zwei
Kammern, den Sejm (Abgeordnetenhaus) und den Senat, in dem die Regionen vertreten
sind.114
Am 11. März 2004 wurde ein Gesetz über die Zusammenarbeit des polnischen Mi
nisterrates mit dem Sejm und dem Senat in Angelegenheiten der Mitgliedschaft Polens
in der EU verabschiedet, in dem die Einzelheiten der Beziehungen zwischen Parlament
und Regierung ausgeführt werden. Es wird festgelegt, dass der polnische Ministerrat
mindestens aller sechs Monate oder auf Verlangen des Sejm oder des Senats über Po
lens Teilnahme an Aktivitäten der EU berichten muss. Außerdem muss der polnische
Ministerrat sofort nach dem Erhalt die EU-Dokumente an Sejm und Senat weiterleiten.
110 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 42 f.; Assemblée Nationale 2003, S. 11, 20 ff.; WIEBER 1999,
S. 111; MAURER 2002, S. 239; JANOWSKI 2005, S. 128, 131; COSAC 2005b, S. 34.
111 Vgl. Assemblée Nationale 2003, S. 23; COSAC 2005b, S. 35; MAURER 2002, S. 244.
112 Vgl. Assemblée Nationale 2003, S. 27, 31 f.
113 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 132 f.
114 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 90.
31
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Dazu gehören u.a. Weiß- oder Grünbücher, das jährliche Arbeits- und Legislativpro
gramm der Kommission sowie dessen Bewertung durch das EP und den Rat der EU,
Mitteilungen der Kommission sowie die Evaluationen anderer Institutionen der EU
dazu, Arbeitsprogramme des Rates und EU-Gesetzesvorlagen. Zu jedem durch die Re
gierung weitergeleiteten EU-Dokument ist sie verpflichtet, zusätzliche Informationen zu
übermitteln, und zwar die Rechtsgrundlage, die Prozedur, den Einfluss auf die nationale
Gesetzgebung, den Einfluss auf die Wirtschaft, den Einfluss auf Soziales, die finanziel
len Folgen sowie die Position des polnischen Ministerrates zu der jeweiligen Vorlage.115
Ausschuss für Angelegenheiten der EU des Sejm - Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Sejmu RP
Gemäß Artikel 110 der Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997 kann der
Sejm ständige Ausschüsse sowie Sonderausschüsse einberufen. Schon im Jahr 1992
wurde ein erster Ausschuss für Europäische Integration gegründet. Nach dem Beitritt
zur EU wurde er am 14. Mai 2004 in Ausschuss für Angelegenheiten der EU umbe
nannt. Die Rechtsgrundlage des Ausschusses ist die Geschäftsordnung des Sejm von
1992 mit ihren Änderungen von 2002.116
Derzeit hat der Ausschuss 43 Mitglieder entsprechend der Stärke der Fraktionen im
Sejm, er sollte nicht mehr als 46 Mitglieder vereinen. Der Ausschuss kann Ad-hoc-Un
terausschüsse einsetzen. Die Sitzungen finden mindestens zweimal im Monat statt, ent
sprechend der Notwendigkeit. Die Sitzungen sind in der Regel öffentlich.117
Die Aufgaben des Ausschusses umfassen laut der Geschäftsordnung des Sejm und
dem Gesetz vom 11. März 2004 alle Angelegenheiten, die mit Polens Mitgliedschaft in
der EU zusammenhängen. Speziell gehört dazu auch die Aufgabe, zu einem Gesetzes
vorschlag der EU, zu Vorschlägen für internationale Verträgen, bei welchen die EG
oder ihre Mitgliedstaaten Vertragspartner sind, oder zu Aktionsplänen und Aktivitäten
des Rates der EU sowie zum jährlichen Legislativprogramm der Kommission eine Posi
tion zu beziehen und eine Stellungnahme zu verfassen. Der Ausschuss kann also im Na
men des Sejm eine Stellungnahme zu Gesetzesvorlagen der EU oder zur Position der
Regierung im Rat der EU abgeben. Die Stellungnahme des Ausschusses sollte eine Ba
sis für die Verhandlungsposition der Regierung darstellen. Wenn die Regierung von der
Stellungnahme des Ausschusses abweicht, ist sie verpflichtet, Rechenschaft darüber ab
zulegen.118
Zwar wurde bisher in keinem Gesetz die Verpflichtung der Regierung für die An
wendung des Parlamentsvorbehalts festgelegt, dennoch ist es üblich, dass die polni
115 Gesetz über die Zusammenarbeit des polnischen Ministerrates mit dem Sejm und dem Senat in Ange
legenheiten bezüglich der Mitgliedschaft Polens in der EU, in: Dziennik Ustaw 2004, Nr. 52, item
515. Erweitert durch das Gesetz vom 28. Juli 2005, in: Dziennik Ustaw 2005, Nr. 160, item 1342;
COSAC 2005b, S. 60; COSAC 2004a, S. 28.
116 Geschäftsordnung des Sejm: Monitor Polski 2002, Nr. 23/398. Vgl. Sejm: European Union Affairs
Committee of the Sejm of the Republic of Poland. Tasks. [http://libr.sejm.gov.pl/oide/ index.php?to
pic=komisja_ue&id=main&col=1&newlang=english; Zugriff am 7.7.2006]; COSAC 2005b, S. 8, 60;
TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 90.
117Vgl. Sejm: Komisje stałe. Komisja do Spraw Unii Europejskiej. [http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/
skladkom4?OpenAgent&SUE; Zugriff am 7.7.2006]; Sejm: Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
Podkomisje. [http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/pkom5?OpenAgent&SUE; Zugriff am 7.7.2006]; CO
SAC 2005b, S. 8, 17, 60; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 91.
118 Geschäftsordnung des Sejm der Republik Polen; COSAC 2005b, S. 60.
32
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
schen Minister im Rat der EU dieses Prinzip anwenden, wenn sie nicht rechtzeitig eine
Stellungnahme des Ausschusses erhalten haben.119
Weiterhin kann der Ausschuss eine Empfehlung zu den für Positionen in Organen
der EU vorgeschlagenen Kandidaten abgeben.120
Der Ausschuss nimmt seit 1997 regelmäßig an der COSAC teil und steht in Informa
tionsaustausch mit den Europa-Gremien anderer nationaler Parlamente. Eine vertiefte
Kooperation der Europa-Gremien findet im Rahmen der Višegrad-Gruppe (Polen, Un
garn, Tschechien, Slowakei) statt. Außerdem nehmen Vertreter des Ausschusses an den
Sitzungen des EP teil.121
2.4.5 Das tschechische Parlament
Rechtsgrundlage für die parlamentarische Kontrolle der Regierung in EU-Angelegen
heiten ist die tschechische Verfassung nach Art. 10b. Auch das Parlament der Tschechi
schen Republik ist ein Zweikammerparlament, bestehend aus der Abgeordnetenkammer
(Poslanecká snĕmovna) und dem Senat (Senát). Beide Kammern haben ihre eigenen
Europa-Gremien, und zwar jeweils einen Ausschuss für Europäische Angelegenheiten.
Beide Gremien tagen öffentlich.122
Die Regierung muss alle EU-Gesetzesvorlagen an die beiden Kammern weiterleiten,
zusammen mit begleitenden Dokumenten zur Position der Regierung, zum Einfluss der
Vorlage auf die nationale Gesetzgebung sowie mit Hinweisen zu den finanziellen Aus
wirkungen.123
Unterstützt wird die Arbeit des tschechischen Parlaments, vor allem in den Vorbera
tungen zu EU-Gesetzesentwürfen, vom „Parlamentní Institut“ (Parlamentarisches Insti
tut), einem 1990 gegründeten Think Tank der Abgeordnetenkammer. Abgeordnete und
Senatoren können detaillierte Studien über einzelne Rechtsakte anfertigen lassen. Das
dem „Parlamentní Institut“ angehörende „Centrum pro evropské právo“ (Zentrum für
Europarecht) unterstützt zusätzlich den Ausschuss für Europäische Angelegenheiten der
Abgeordnetenkammer in seiner Kontrollfunktion. Das Institut stellt Fachinformationen
bereit und bietet Beratungsleistungen an. Außerdem untersucht es Gesetzesinitiativen
auf Antrag von Abgeordneten.124 Diese recht hohe fachliche Expertise ist für den Bera
tungsprozess sehr wichtig und stellt einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Parla
menten dar.
119 Vgl. COSAC 2005b, S. 60.
120 Geschäftsordnung des Sejm der Republik Polen; Sejm: European Union Affairs Committee of the
Sejm of the Republic of Poland. Tasks. [http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?topic=komisja_ue
&id=main&col=1&newlang=english; Zugriff am 7.7.2006].
121 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 84, 91.
122 Vgl. COSAC 2005b, S. 8,17, 26; DIERINGER, JÜRGEN / STUCHLIK, ANDREJ Die Europäisierung der Parla
mentsarbeit in Ungarn und der Tschechischen Republik. Nationale Parlamente als Mitläufer oder Ge
stalter des Integrationsprozesses? 2004, S. 4, 7; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 79.
123 Gesetz vom 7. Mai 2004, welches das Gesetz Nr. 90/1995 zu der Geschäftsordnung der Abgeordne
tenkammer erweitert; COSAC 2004a, S. 28.
124 Vgl. DIERINGER / STUCHLIK 2004, S. 8; Homepage des Instituts: http://www.psp.cz/kps/pi/EN/in
dex.htm [Zugriff am 20.07.2006].
33
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Ausschuss für Europäische Angelegenheiten der Abgeordnetenkammer – Výbor pro
evropské záležitosti
Die Rechtsgrundlage des Ausschusses ist neben Art. 10b der Verfassung das Gesetz
vom 7. Mai 2004, welches das Gesetz Nr. 90/1995 zu der Geschäftsordnung der Abge
ordnetenkammer erweitert. In diesem Gesetz wird auch ein System des Parlamentsvor
behalts eingeführt.125 Der Ausschuss für Europäische Angelegenheiten gehört zu den
ständigen Ausschüssen der Abgeordnetenkammer. Bis zum Beitritt Tschechiens zur EU
hieß er Ausschuss für Europäische Integration und wurde im Mai 2004 mit dem Beitritt
zur EU umbenannt.126
Der Ausschuss hat 21 Mitglieder proportional zur Verteilung der Stärke der politi
schen Parteien in der Abgeordnetenkammer und tagt regelmäßig in den Sitzungswo
chen, kann aber auch Ad-hoc-Sitzungen abhalten. Tschechische Mitglieder des EP kön
nen an den Sitzungen des Ausschusses oder auch anderer Fachausschüsse teilnehmen.127
Die Aufgaben des Ausschusses umfassen die Überprüfung und Beratung von legisla
tiven EU-Vorlagen. Der Ausschuss kann diese EU-Vorlagen zusammen mit seiner eige
nen Stellungnahme an andere zuständige Ausschüsse oder an das Plenum weiterleiten.
Der Ausschuss kann außerdem den jeweiligen zuständigen Regierungsminister bitten,
vor der entsprechenden Ratssitzung an einer Ausschusssitzung teilzunehmen. Der Mi
nister sollte die Parlamentarier darüber informieren, welche Position er im Rat bei den
Verhandlungen einnehmen wird. Die Stellungnahmen, die der Ausschuss verfasst, müs
sen von der Regierung bei ihren Verhandlungen im Rat berücksichtigt werden.128
Der Ausschuss ist weiterhin berechtigt, nach der Bekanntgabe der Nominierungen
der tschechischen Vertreter für europäische Positionen diese zu beraten, bevor die Re
gierung eine endgültige Entscheidung über die Vergabe der Positionen fällt.129
Der Ausschuss unterhält regelmäßige Beziehungen mit den Europa-Gremien anderer
Mitgliedstaaten und der Beitrittskandidaten. Außerdem nehmen Vertreter an den Sitzun
gen des EP oder an der COSAC teil.130
2.4.6 Überblick über die Europa-Gremien der EU-Mitgliedstaaten
Zusammenfassend zu den vorgestellten Europa-Gremien kann man feststellen, dass die
deutschen Europa-Gremien in ihrer formalen Kompetenzen relativ stark gestellt sind,
diese Möglichkeiten jedoch zu selten nutzen bzw. nutzen können. Die französischen
Gremien sind zwar recht engagiert, verlieren jedoch durch ihre nachrangige Stellung im
125 Gesetz vom 7. Mai 2004, welches das Gesetz Nr. 90/1995 zu der Geschäftsordnung der Abgeordne
tenkammer erweitert.
126 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 79; COSAC 2005b, S. 8, 26.
127 Gesetz vom 7. Mai 2004, welches das Gesetz Nr. 90/1995 zu der Geschäftsordnung der Abgeordne
tenkammer erweitert; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 79; COSAC 2005b, S. 8, 26. Zum Zeitpunkt des
Verfassens der Arbeit finden Parlamentswahlen in Tschechien statt. Die Angaben können deshalb
von einer Legislaturperiode zur anderen variieren.
128 Gesetz vom 7. Mai 2004, welches das Gesetz Nr. 90/1995 zu der Geschäftsordnung der Abgeordne
tenkammer erweitert; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 79; COSAC 2005b, S. 26; COSAC: Report on
Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Du
blin, May 2004b, S. 35.
129 Gesetz vom 7. Mai 2004, welches das Gesetz Nr. 90/1995 zu der Geschäftsordnung der Abgeordne
tenkammer erweitert.
130 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 80.
34
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
Vergleich zu den ständigen Ausschüssen ihre Kraft. Die tschechischen Gremien sind
vornehmlich dafür zuständig, EU-Dokumente zu prüfen, und haben erstaunlich viele
Kompetenzen bzw. Vorteile im Vergleich zu den entsprechenden Gremien der „alten“
EU-Mitgliedstaaten. Dazu gehört u.a. die hohe Expertise durch die Zuarbeiten des Par
lamentarischen Instituts, die gute Information, die Möglichkeit, die Besetzung tschechi
scher Positionen in den Europäischen Institutionen zu beeinflussen oder die Nutzung
des Parlamentsvorbehalts. Auch die polnischen Gremien sind ähnlich gut mit Kompe
tenzen ausgestattet, sie haben sogar noch größere Möglichkeiten, ihre Regierung zu be
einflussen, da die Regierung bei ihren Verhandlungen im Rat noch an die Stellungnah
me des Parlaments gebunden ist. Auffällig ist außerdem, dass die polnischen und tsche
chischen Gremien öffentlich tagen, die französischen und deutschen in der Regel nicht
öffentlich.
Die Unterschiede zwischen den Europa-Gremien der Parlamente der EU-Mitglied
staaten sind recht groß. Sie variieren hinsichtlich ihrer Größe und Zusammensetzung,
der Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten, ihren Rechtsgrundlagen sowie der Aktivi
täten und Sitzungsfrequenz. Im Anhang findet man eine Tabelle, die die wichtigsten
Merkmale der Europa-Gremien der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten ge
genüberstellt.
Die meisten der Gremien sind so zusammengesetzt, dass sie die Stärke der politi
schen Gruppen im nationalen Parlament proportional widerspiegeln. Unterschiede lie
gen u.a. darin, ob Mitglieder des EP an den Sitzungen teilnehmen und welche Rechte
sie haben. In den meisten Fällen können MEPs an den Sitzungen der Europa-Gremien
der nationalen Parlamente teilnehmen, wobei sie in einigen Gremien eine aktivere Rolle
spielen.131
Bezüglich des Niveaus an Kompetenzen, Aufgaben und Einflussmöglichkeiten un
terscheiden sich die Europa-Gremien deutlich. Einige haben Beschlussrechte, andere
nur beratende Funktion. Außerdem unterscheiden sich die Gremien, die wie in Irland,
Spanien und Italien hauptsächlich nur für den Informationsaustausch zuständig sind,
stark von den Gremien in Dänemark oder Österreich, die den Standpunkt ihrer Regie
rung im Rat fest binden können.132 Letztere spielen eine deutlich wichtigere Rolle im ge
samten Kontrollprozess, während erstere meist nur mit der Weiterleitung von Informa
tionen beschäftigt sind; ein Recht zur Stellungnahme ist in einigen Parlamenten sogar
ausgeschlossen.
So kann man feststellen, dass die Parlamente in Skandinavien, d.h. Dänemark,
Schweden und Finnland, sowie auch in Österreich und Deutschland einen recht hohen
Einfluss auf ihre Regierungen haben. Dementsprechend sind die Europa-Gremien dieser
Parlamente formal recht stark mit Kompetenzen ausgestattet. Deutliche Gemeinsamkei
ten mit eher schwach institutionalisierten Europa-Gremien in den Parlamenten zeigen
sich zwischen den vier südlichen Mitgliedstaaten Italien, Griechenland, Portugal und
Spanien. Hier scheint die Europapolitik auch eher der Außenpolitik zugeordnet zu wer
den; die Parlamente bleiben dabei eher passiv. Ähnlich ist die Situation in den Ländern
der Beneluxstaaten. Allerdings erfolgt dies offenbar mit der Zielstellung, nicht mit dem
EP in eine national-parlamentarische Konkurrenz zu treten.133
Die Parlamente Frankreichs, Großbritanniens und Irlands stellen jeweils Sonderfälle
dar. Die Besonderheiten der Regierungssysteme spiegeln sich auch in den Europa-Gre
131 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 27; COSAC May 2005, S. 7.
132 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 28.
133 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 85, 181 f.
35
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
mien der Parlamente wieder und lassen keinen direkten Vergleich mit anderen Mitglied
staaten zu.134
Die Parlamente in MOE sind traditionell oftmals eher schwach gegenüber ihren Re
gierungen gestellt. Nach dem Beitritt zur EU haben sie ihre Chance genutzt und inner
parlamentarische Europa-Gremien geschaffen, die meist weitreichende Kompetenzen
besitzen, sowohl im Informationszugang als auch in den Mitteln, mit diesen Informatio
nen ihre Regierungen tatsächlich zu beeinflussen.135
Man kann weiterhin feststellen, dass alle Europa-Gremien Kompetenzen im Bereich
der EU-Angelegenheiten haben, jedoch sind die Rechte im Bereich der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie der Polizeilichen und justiziellen Zusam
menarbeit in Strafsachen (PJZS) für einige der Europa-Gremien der Mitgliedstaaten be
schränkt. Beispielsweise überwachen derzeit 26 parlamentarische Kammern in 20 Mit
gliedstaaten den Bereich der GASP.136 Unterschiede ergeben sich nochmals daraus, wel
che Dokumente genau untersucht werden. Dies ist z.T. auch die Aufgabe der Ausschüs
se für Auswärtige Angelegenheiten. Auch die Überwachung der Einhaltung des Subsi
diaritätsprinzips wird noch nicht in allen parlamentarischen Kammern regelmäßig
durchgeführt. Derzeit zählen dies 18 parlamentarische Kammern (aus 14 Mitgliedstaa
ten) zu ihren Aufgaben.137
Eine weitere Unterscheidung ergibt sich aus der Aktivität der einzelnen Gremien.
Beispielsweise sind die skandinavischen Parlamente europapolitisch sehr aktiv (hohe
Anzahl an Berichten und Stellungnahmen, hohe Sitzungsfrequenz), der österreichische
Ausschuss agiert jedoch trotz seiner weitreichenden Kompetenzen eher zurückhal
tend.138
Eine wichtige Unterscheidung ergibt sich aus der Rechtsgrundlage, mit der die Ein
richtung eines Europa-Gremiums verankert wurde. Beispielsweise ist die Einrichtung
eines Europaausschusses in Deutschland und Österreich in der Verfassung festgeschrie
ben, in den Beneluxstaaten hingegen existieren nur einfache Einsetzungsbeschlüsse.139
Insgesamt ergibt sich ein eher ernüchterndes Bild. Viele Parlamente haben noch
nicht alle institutionellen und formalen Schritte ergriffen, um effektiv europapolitisch
mitzuwirken. Der Status der Gremien schwankt stark. Die Europa-Gremien der skandi
134 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 183; GRUNERT, THOMAS Die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parla
ment und den nationalen Parlamenten – auf dem Wege zu einer neuen Partnerschaft?, in: BUSEK,
ERHARD / HUMMER, WALDEMAR (Hg.) Etappen auf dem Weg zu einer europäischen Verfassung. Wien
u.a. 2004, S. 406.
135 Vgl. DIERINGER / STUCHLIK 2004, S. 3.
136 Kompetenzen in diesem Bereich haben die Gremien in Belgien, Dänemark, Deutschland (Bundest
ag), Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxembourg, den Niederlanden (Abgeordnetenkammer), Österreich, Polen (Sejm), Portugal, Slowa
kei, Slowenien, Schweden und Tschechien.
137 Das sind Dänemark, der deutsche Bundesrat, Estland, Finnland, die französische Assemblée Nationa
le, Großbritannien (House of Commons und House of Lords), Irland, Italien (Abgeordnetenkammer
und Senat), Litauen, Malta, die Niederlande (Abgeordnetenhaus und Senat), Österreich, Portugal, die
tschechische Abgeordnetenkammer und der tschechische Senat. Weiterhin befassen sich der französi
sche Senat, der deutsche Bundestag und das ungarische Parlament unregelmäßig bei bestimmten
Vorschriften mit der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. Weitere sechs nationale Parlamene haben
angekündigt, zukünftig das Subsidiaritätsprinzip zu kontrollieren, und zwar sind das Lettland, Lu
xembourg, der polnische Sejm und Senat, die Slowakei und Spanien. Vgl. COSAC 2005a, S. 7 f., 28
f.; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 28.
138 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 181
139 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 180.
36
2.4 Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente
navischen Länder sind vergleichsweise stark. Entscheidend für den Status der EuropaGremien ist es, dass ihnen auch in der Verfassungswirklichkeit eine übergeordnete Rol
le bei der Behandlung von EU-Vorlagen zugestanden wird. Der vorrangige Status der
Europa-Ausschüsse ist in diesen Ländern innerparlamentarisch auch ohne größere for
male Basis kaum umstritten, ein Bewusstsein für die Relevanz der effektiven Einfluss
nahme auf die Europapolitik der Regierungen ist vorhanden.140
Aus der bisherigen Situation in den Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten ergibt sich
eine noch deutlich ausbaufähige Basis für die europapolitische Mitwirkung der nationa
len Parlamente und damit für die Legitimation der EU durch sie. Das Spannungsfeld
zwischen Theorie und Praxis ist noch groß. Zum einen wollen die Parlamente überwa
chen und beeinflussen, aber auch die Regierungen wollen im Rat frei verhandeln kön
nen. Somit kommt es innerhalb der Regierungssysteme oft zu strukturellen und organi
satorischen Defiziten bei der Verhandlung von EU-Angelegenheiten.141
Grundsätzlich muss man die Grenzen einer europapolitischen Mitwirkung der natio
nalen Parlamente erkennen, ihre zu geringe Leistungsfähigkeit. Nur ein kleiner Bruch
teil der überwiesenen EU-Vorlagen wird tatsächlich in den Ausschüssen bzw. Parla
menten behandelt und ein Beschluss bzw. eine Stellungnahme dazu verabschiedet. So
mit können selbst die starken Europa-Gremien nicht allzu häufig Einfluss auf die Regie
rung ausüben142 und nur vereinzelt ist es bisher zu einer Umsetzung von der Theorie in
die Praxis gekommen.
3. Europäische Ebene: Mitwirkung und Zusammenarbeit der Parla
mente
3.1 Regelungen im Primärrecht
In den Europäischen Verträgen wurden bisher keine expliziten Rechte der nationalen
Parlamente verankert. Dennoch existieren einige richtungsweisende Ansätze.
Durch die Erklärungen 13 und 14 des Maastrichter Vertrages wurde erstmals von al
len Mitgliedstaaten ein explizites Bekenntnis zur Förderung der europapolitischen Mit
wirkungs- und Kontrolloptionen der nationalen Parlamente abgegeben. Auch innerstaat
lich wurden in fast allen EU-Mitgliedstaaten Neuregelungen zur Beteiligung der natio
nalen Parlamente am europäischen Entscheidungsprozess getroffen. Neben dem EP
wurden also die nationalen Parlamente zunehmend wichtig für die demokratische Legi
timation der EU. Dies ist die Grundlage des sog. Mehrebenenparlamentarismus in der
EU.143
Die Erklärung Nr. 13 spiegelt den Wunsch der nationalen Parlamente nach einer stär
keren Einbeziehung in den Entscheidungsprozess der EU wider und fordert eine Ver
besserung der Effektivität der Kontrolle der Regierungen in EU-Angelegenheiten durch
die nationalen Parlamente. Die Bedeutsamkeit des zeitnahen Zugangs zu Informationen
und die Übermittlung von Dokumenten wird betont.144 Die Erklärung 14 hebt die ge
140 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 178 ff.
141 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 221.
142 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 224 ff.
143 Vgl. MAURER 2004, S. 211; MAURER 2002, S. 20 f.
144 Amtsblatt der Europäischen Union: Erklärung 13 in der Schlussakte zum Vertrag über die Europäi
sche Union, unterzeichnet am 7. Februar 1992. Amtsblatt Nr. C 191 vom 29. Juli 1992 (Vertrag von
37
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
meinsame Rolle der Parlamente hervor, speziell der nationalen Parlamente und des EP.
Sie schlägt das Zusammentreten der „Assisen“ vor, ein gemeinsames Treffen des EP
und der nationalen Parlamente als eine “Konferenz der Parlamente“. Es wird konkreti
siert, dass sich die Assisen wenn notwendig treffen und zu den grundlegenden Themen
der EU angehört werden soll.145 Das erste und bis heute letzte Treffen der Assisen wurde
1990 in Rom vor der Regierungskonferenz von Maastricht abgehalten. Außerdem wird
eine Zusammenarbeit der nationalen Parlamente mit dem EP empfohlen und deren Rol
le deutlich gestärkt.146
Eine wichtige primärrechtliche Verankerung der Mitwirkung der nationalen Parla
mente ist das „Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäi
schen Union“. Es fand 1997 mit dem Amsterdamer Vertrag Eingang in das europäische
Verfassungsrecht. Festgehalten wird hier die Möglichkeit der einzelstaatlichen Parla
mente, sich zu Fragen zu äußern, die für sie von besonderem Interesse sein könnten.
Das Protokoll ergänzt die nationalen verfassungsrechtlichen Regelungen der einzelnen
Mitgliedstaaten. Es begründet eine unionsrechtliche Pflicht der Regierungen der EUMitgliedstaaten, die Parlamente über die Angelegenheiten der EU in einer bestimmten
Frist (sechs Wochen) zu unterrichten. Außerdem institutionalisiert das Protokoll die
Konferenz der Europa-Gremien der nationalen Parlamente, die COSAC, und erkennt
die Tatsache an, dass die demokratische Legitimation der EU und ihrer Gemeinschaften
vorrangig über die nationalen Parlamente erfolgt.147 Allerdings erhielten die nationalen
Parlamente durch das Protokoll keine wesentlichen Rechte auf europäischer Ebene, son
dern es wird festgestellt, dass die Kontrolle der Regierungen durch die jeweiligen natio
nalen Parlamente Sache der innerstaatlichen Rechtsordnungen ist.148
Eine weitere Einbindung der nationalen Parlamente in den Rechtssetzungsprozess
der EU wird durch die „Stimmenabgabe ad referendum“ primärrechtlich fixiert. Durch
die „Stimmenabgabe ad referendum“ („parliamentary scrutiny reserve“, „réserve d’ex
amen parlementaire“, „Parlamentsvorbehalt“) machen die Mitgliedstaaten ihre Stim
menabgabe im Rat der EU von der Befassung ihrer nationalen Parlamente abhängig.
Dies ist durch das oben genannte Protokoll unionsrechtlich legitimiert, da vorgesehen
ist, dass die nationalen Parlamente innerhalb einer Frist von sechs Wochen zwischen
Kommissionsvorschlag und der Befassung im Rat Gelegenheit zur Stellungnahme ha
ben.149
Maastricht).
145 Erklärung 14 in der Schlussakte zum Vertrag von Maastricht.
146 Erklärung 13 in der Schlussakte zum Vertrag von Maastricht; PÖHLE 1998, S. 78.; auch TORDORFF,
LORD The Conference of European Affairs Committees: A Collective Voice for National Parliaments
in the European Union, in: The Journal of Legislative Studies 6 (2000), H. 4, S. 3; JANOWSKI 2005,
S. 18; CYGAN 2001, S. 9; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 14 ff.; TÖLLER 2004, S. 44; MAURER 2004,
S. 211; PÖHLE 1993, S. 57.
147 Ausführlicher dazu siehe Punkt 4 (S. 51) dieser Arbeit. Amtsblatt der Europäischen Union: Vertrag
von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaften. Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der
Europäischen Union. Amtsblatt Nr. C 340 vom 10.11.1997, S. 0113; HUBER 2001, S. 15 f.;
TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 16 f.; MAURER 2004, S. 211; MAURER / WESSELS2001, S. 62 f.; PÖHLE
1998, S. 78; JANOWSKI 2005, S. 19; TÖLLER 2004, S. 44; CYGAN 2001, S. 9; RANGE 2004, S. 3; TORDORFF
2000, S. 3; MAURER 2002, S. 20.
148 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 17; RANGE 2004, S. 3.
149 Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente 1997 (C 340), Ziffer I.3; HUBER 2001, S. 17;
PFLÜGER 2000, S. 231, 233.
38
3.1 Regelungen im Primärrecht
Der Vertrag von Nizza übernimmt das Protokoll unverändert. Außerdem wird in der
dem Vertrag angehängten „Erklärung zur Zukunft der Union“150 die Absicht erklärt, sich
zukünftig noch mehr mit der Rolle der nationalen Parlamente in der europäischen Ar
chitektur zu beschäftigen.
3.2 Zusammenarbeit des Europäischen Parlaments mit den nationalen
Parlamenten
3.2.1 Zur Notwendigkeit der Zusammenarbeit
Es wurde deutlich, dass die parlamentarische Demokratie in den Mitgliedstaaten der EU
einem Prozess der Entparlamentarisierung, einem Erosionsprozess ihrer verfassungs
rechtlich garantierten Rechte ausgesetzt ist. Die Mehrheitsentscheidungen im Rat, die
durch eine Politik des Konsens notwendig sind, schwächen den Einfluss der nationalen
Parlamente und damit die demokratische Legitimation der EU zusätzlich. Dies führt zu
der Erkenntnis, dass die parlamentarische Demokratie in der EU nur verbessert werden
kann, wenn das EP und die nationalen Parlamente kooperieren. Weiterhin ist es zur
Stärkung der Demokratie in der EU notwendig, dass auch die nationalen Parlamente un
tereinander verstärkt auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Sowohl durch die Glo
balisierung als auch durch die Europäische Integration wird die internationale Betäti
gung der nationalen Parlamente innerhalb der EU sehr wichtig, da die internationalen
Vereinbarungen durch den Vorrang des EU-Rechts vor nationalstaatlichem Recht eine
direkte Wirkung auf die Rechtssphäre der Bürger entfalten. Deshalb sind sowohl die
einzelstaatlichen als auch die zwischenstaatlichen Strukturen an die neuen Gegebenhei
ten anzupassen, besonders, um die Demokratie auch auf überstaatlicher Ebene zu för
dern und zu sichern. Wichtiger Bestandteil ist dabei die Pflege und der Ausbau der Be
ziehungen unter den nationalen Parlamenten der EU. Effektive Reaktionen auf die mit
der Europäischen Integration verbundenen tief greifenden Veränderungen sind u.a. eine
Zusammenarbeit durch entsprechende interparlamentarische Kooperation auf allen Ebe
nen.151
Im Folgenden wird dargestellt, auf welche Art und Weise die nationalen Parlamente
und das EP auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, um die parlamentarische Demo
kratie in der EU zu stärken. Die Rolle des EP selbst bei der Demokratisierung und im
Entscheidungsprozess der EU ist nicht Gegenstand der Untersuchung.
3.2.2. Rechtliche Bestimmungen des EP zur Zusammenarbeit mit den nationalen
Parlamenten
Im Jahre 1995 fordert das EP in seiner Entschließung zur Funktionsweise des EUV vom
17.5.1995 eine stärkere Kooperation mit den nationalen Parlamenten. So heißt es unter
Ziffer 24: „Die demokratische Kontrolle auf EU-Ebene lässt sich am besten durch eine
150 Amtsblatt der Europäischen Union: Erklärung zur Zukunft Europas zum Vertrag von Nizza zur Än
derung des Vertrages über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte. Amtsblatt Nr. C 80 vom 10.
März 2001.
151 Dazu in Punkt 3.3 (S. 44) dieser Arbeit. Vgl. Deutscher Bundestag: Drucksache 15/5056 vom
09.03.2005, S. 2 f.
39
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten
erreichen. Die Rolle der nationalen Parlamente sollte in mehrfacher Hinsicht gestärkt
werden, z.B. durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Fachaus
schüssen der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments sowie durch die
Möglichkeit für Fachorgane nationaler Parlamente, wichtige europäische Vorschläge
mit ihren Ministern im Vorfeld der Ratstagungen zu erörtern.“152
In seiner Entschließung vom 7. Februar 2002, auch bekannt als Napolitano-Bericht,
erklärte das EP, dass es nicht ausschließlich sich selbst als exklusiven Repräsentanten
der Bürger und Garanten der Demokratie sehe und dass es die Rolle der nationalen Par
lamente als sehr hoch anerkenne. Der Bericht untermauert die Vorstellung des EP, dass
die nationalen Parlamente besonders über die Kontrolle der jeweiligen Regierungen
verstärkt in den europapolitischen Gestaltungsprozess eingebunden werden. Ein zentra
les Element der Entschließung sind außerdem Vorschläge für eine verstärkte Zusam
menarbeit zwischen dem EP und den nationalen Parlamenten.153
Im Juli 2004 beschlossen die Parlamentspräsidenten bzw. -sprecher gemeinsam mit
dem EP auf ihrer Sitzung in Den Haag die „Leitlinien für Interparlamentarische Koope
ration in der EU“.154 Diese Leitlinien enthalten zahlreiche Empfehlungen für die inter
parlamentarische Kooperation, worauf später eingegangen wird.155
In der Geschäftsordnung des EP werden die Beziehungen zu den nationalen Parla
menten in Artikel 24 III, 123 und 125 geregelt. Demnach ist die Konferenz der Präsi
denten des EP (ein Organ des EP) das zuständige Organ für die Beziehungen mit den
nationalen Parlamenten und das EP unterrichtet die nationalen Parlamente regelmäßig
über seine Aktivitäten. Weiterhin wird festgehalten, dass die Konferenz der Präsidenten
des EP die Mitglieder der Delegation des EP für die COSAC benennt und dieser ein
Mandat erteilen kann.156
3.2.3 Entwicklungsphasen der Zusammenarbeit zwischen EP und nationalen Par
lamenten
Nach Grunert kann man die Beziehungen zwischen dem EP und den nationalen Parla
menten chronologisch in drei Phasen untergliedern.
Anfangs, in der „Latenzzeit“, wurde das EP bis zu seiner ersten Direktwahl 1979 von
den nationalen Parlamenten kaum als möglicher Partner oder als Rivale wahrgenom
men, u.a. auch deshalb, weil das EP bis dahin kaum über verbindliche, vertraglich abge
sicherte Zuständigkeiten verfügte. Die Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten
verlief recht lose, aber dennoch durchaus positiv. Dies wurde durch die Rückkopplung
von der europäischen auf die nationale Ebene durch das Doppelmandat der MEP (bis
1979) deutlich erleichtert. Diese enge personelle Verflechtung sicherte den Informati
onsaustausch sowie auch das Gefühl der Zusammenarbeit. Man musste jedoch feststel
len, dass ein derartiges Doppelmandat mit einem zu hohen Arbeitsaufwand für die Par
lamentarier verbunden war, und schon bald nach der ersten Direktwahl des EP 1979 gab
152 Vgl. Europäisches Parlament: Entschließung des Europäischen Parlaments zur Funktionsweise des
EUV vom 17. Mai 1995, Amtsblatt EG Nr. C 151/63.
153 Vgl. Europäisches Parlament: Resolution vom 7.2.2002; GRUNERT 2004, S. 425.
154 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: Guidelines: Interparliamentary Cooperation in
the European Union. 3. July 2004.
155 Siehe Punkt 3.3.1 (S. 44).
156 Europäisches Parlament: Geschäftsordnung des EP, 16. Auflage vom 4.7.2006.
40
3.2 Zusammenarbeit des Europäischen Parlaments mit den nationalen Parlamenten
es kaum noch Doppelmandatsträger. So war danach ein zunehmendes Interesse des EP
an der Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten feststellbar. Noch bis Ende der
1980er Jahre nahmen die nationalen Parlamente das EP kaum als Konkurrenten war, ge
rade auch weil es bis zum Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte 1987 nur
mit geringen Gesetzgebungskompetenzen ausgestattet war.157
Durch die Vertragsreform 1987, den Maastrichter Vertrag 1993 sowie den Amsterda
mer Vertrag 1999 erkannten die nationalen Parlamente zunehmend, dass sie auf die Ge
staltung, Legitimierung und Kontrolle europäischer Politik immer mehr an Einfluss ver
loren, weil diese Funktionen zunehmend auf die supranationale Parlamentsebene verla
gert wurden. Dies führte dazu, dass einige nationale Parlamente das EP sehr kritisch be
obachteten und mehr und mehr als Konkurrent wahrnahmen. Dadurch sind die Bemü
hungen des EP umso größer geworden, an multilateralen Parlamentskontakten teilzuha
ben und nicht ausgeschlossen zu werden. Gerade deshalb beobachtete es misstrauisch,
ob sich andere Institutionen bildeten, die zu einem Konkurrenten werden könnten. Die
se zweite Etappe der Entwicklung der Beziehungen bezeichnet Grunert als „Pubertäts
krise“. Andererseits kann man feststellen, dass zwischen 1989 und 1999 das Netzwerk
interparlamentarischer Beziehungen und Begegnungen zwischen dem EP und den natio
nalen Parlamenten deutlich anwuchs und die Zusammenarbeit durchaus konstruktiv
war.158
In der derzeit anhaltenden dritten Phase des „Erwachsenwerdens“ ist man um eine
Entwicklung der Beziehungen von der Konkurrenz zur Partnerschaft bemüht. Durch das
Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages wurde den nationalen Parlamenten zunehmend
bewusst, dass das EP die vorrangige parlamentarische Instanz in der EU ist, besonders,
weil ihm eine erhebliche Anzahl neuer Gesetzgebungskompetenzen auf europäischer
Ebene übertragen und das Mitentscheidungsverfahren deutlich ausgeweitet wurde. Man
bemühte sich nun, die konstruktive Zusammenarbeit zwischen EP und nationalen Parla
menten zu stärken, wobei man sich bewusst wurde, dass eine Legitimation der europäi
schen Gesetzgebung durch beide parlamentarischen Ebenen zu gewährleisten ist. Der
zeit sind die nationalen Parlamente vor allem darum bemüht, einerseits über die Ein
flussnahme auf und Kontrolle über ihre jeweiligen Regierungen europäische Politik mit
zugestalten und andererseits durch eine strukturierte Zusammenarbeit und systemati
schen Informationsaustausch zwischen den nationalen Parlamenten sowie mit dem EP
die Parlamentarisierung der europäischen Politik zu fördern.159
3.2.4 Instrumente und Aktivitäten des EP
Zu den ersten Ansätzen der interparlamentarischen Kooperation des EP gehört die
Gründung der Konferenz der Parlamentspräsidenten 1973160 und die Schaffung des Eu
ropäischen Zentrums für parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation (ECPRD)
1977161, worauf später genauer eingegangen wird.
157 Vgl. GRUNERT 2004, S. 395 ff.
158 Vgl. GRUNERT 2004, S. 399; PÖHLE 1998, S. 87.
159 Vgl. GRUNERT 2004, S. 399 f.
160 Siehe Punkt 3.3.2 (S. 45) dieser Arbeit.
161 Siehe Punkt 3.3.5 (S. 47) dieser Arbeit.
41
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Die heute wichtigste Form der durch das EP organisierten interparlamentarischen
Kooperation sind die interparlamentarischen Treffen, die man gemäß den verschiedenen
Arten der EU-Politik und ihren entsprechenden Entscheidungsprozessen in zwei Kate
gorien aufteilen kann: Zum einen gibt es gemeinsame parlamentarische Treffen und
zum anderen gemeinsame Treffen der Ausschüsse.162
Bei den gemeinsamen parlamentarischen Treffen werden insbesondere die politi
schen Themen besprochen, bei denen die EU bisher keine Legislativgewalt besitzt, aber
dennoch wichtige Entscheidungen trifft. Dazu gehören die gemeinsame Außen- und Si
cherheitspolitik, die Koordination der makroökonomischen und Währungspolitik oder
der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Ziel der parlamentarischen Tref
fen ist es, einen besseren parlamentarischen Überblick und eine bessere Kontrolle über
intergouvernementale und nichtlegislative Entscheidungen auf der EU-Ebene zu schaf
fen.163 Beispiele sind das gemeinsame parlamentarische Treffen zur Lissabon-Strategie
im März 2005 oder das gemeinsame parlamentarische Treffen zur Zukunft Europas im
Mai 2006.
Die gemeinsamen Treffen der Ausschüsse, die vom EP organisiert werden, gehen
meist auf die Initiative des einzelnen Ausschusses des EP zurück, der seine Kollegen
aus den entsprechenden nationalen Ausschüssen einlädt. Diese Treffen beschäftigen
sich meist mit den politischen Bereichen, bei denen die EU legislative Gewalt im Rah
men der Mitentscheidung hat. Ziel dieser Treffen ist es, den Austausch von Standpunk
ten zwischen EP und nationalen Parlamenten zu fördern, mit Hinblick darauf, die legis
lativen Entscheidungen des EP zu beeinflussen.164 Beispiele für diese Treffen sind das
vom Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP initiierte Treffen zur Frage der
Wachstumssteigerung in der Euro-Zone im Februar 2006165 oder das vom Ausschuss für
Industrie, Forschung und Energie des EP veranstaltete Treffen zur Energieeffizienz im
Januar 2006. Diese Versammlungen gehören zu den alteingesessenen Formen der inter
parlamentarischen Kooperation in der EU.166
Erwähnenswert ist außerdem, dass einige Ausschüsse des EP regelmäßig Vertreter
der nationalen Parlamente in ihre Sitzungen einladen, um gemeinsam neue Legislativ
vorschläge der Kommission zu beraten.167
Weiterhin lädt das EP in großer Regelmäßigkeit zu Fachseminaren und Rundtischge
sprächen ein, bei denen einzelne Politikbereiche diskutiert werden, beispielsweise zum
Wachstum in der Euro-Zone (Februar 2006 in Brüssel) oder eine Konferenz zur PrümKonvention (Juni 2006 in Brüssel). Auch an der von der Konferenz der Parlamentsprä
162 Vgl. Europäisches Parlament: Beziehungen zu den nationalen Parlamenten. Aufgabenbeschreibung
Direktion. [http://www.europarl.europa.eu/natparl/mission_statement_de.htm; Zugriff 05.07.2006].
163 Vgl. Europäisches Parlament: Beziehungen zu den nationalen Parlamenten. Aufgabenbeschreibung
der Direktion.
164 Vgl. European Parliament: Relations with national parliaments. Joint committee meetings.
[http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/11; Zugriff am 05.07.2006].
165 Vgl. European Parliament/ Committee on Economic and Monetary Affairs: Interparliamentary debate
with National Parliaments: How to raise growth in the Euro area? 20.–21. February 2006. Brussels.
166 Conference of Speakers of National Parliaments: Guidelines: Interparliamentary Cooperation in the
European Union. 3. July 2004. Punkt II.
167 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union: COSAC –
Die Konferenz der Europaausschüsse im Wandel. Texte und Materialien. Berlin 2003a, S. 71; Euro
päisches Parlament: Die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten. [http://ww
w.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=58&pageRank=1&language=de; Zugriff
am 10.07.2006].
42
3.2 Zusammenarbeit des Europäischen Parlaments mit den nationalen Parlamenten
sidenten ins Leben gerufenen COSAC als Form der Zusammenarbeit mit den nationalen
Parlamenten ist das EP beteiligt.168
Dazu kommen regelmäßige Kontakte zwischen den nationalen Parlamenten und dem
EP auf politischer Ebene über die in den Parlamenten vertretenen Fraktionen.169
Als Ausdruck der wachsenden Bedeutung der Beziehungen des EP zu den nationalen
Parlamenten wurde Ende 2004 eine neue Direktion des EP für Beziehungen zu den na
tionalen Parlamenten eingerichtet. Dies verdeutlicht, dass die Notwendigkeit der Zu
sammenarbeit mit den nationalen Parlamenten ernster denn je genommen wird.170 Die
neue Direktion soll als Koordinierungszentrum dazu beitragen, alle Arten von Bezie
hungen zu den nationalen Parlamenten weiterzuentwickeln sowie formelle und infor
melle Netzwerke aufrecht zu erhalten bzw. einzurichten. Die Bedeutung der Zusam
menarbeit mit den nationalen Parlamenten für das EP wird außerdem dadurch deutlich,
dass die Vizepräsidenten des EP mit diesen Beziehungen betraut sind.171
Eine der neuesten Kooperationsinitiativen ist das sogenannte COX-Programm, das
„Cooperation and Exchange Programme“ des EP. Dieses Austausch-Programm soll den
direkten Kontakt des EP mit nationalen Parlamenten fördern. Es wurde mit dem Ziel ge
schaffen, die Mitarbeiter der Parlamente und die Mitarbeiter des EP zusammenbringen
und in Arbeitskreisen zusammenarbeiten lassen. Es arbeitet insbesondere mit zwei Ele
menten. Das sind erstens Informations-Seminare, in erster Linie für die Mitarbeiter der
nationalen Parlamente, die sich sowohl mit der Rolle des EP im Entscheidungsprozess
in der EU als auch mit dem Management und der Organisation der Kontrollprozesse des
nationalen Parlaments in EU-Angelegenheiten beschäftigen. Das zweite Element sind
die für Abgeordnete des EP organisierten Besuche der nationalen Parlamente. Diese
Treffen können thematisch sehr weit gefasst sein, beispielsweise um den Austausch zu
Themen von interparlamentarischen Treffen fortzusetzen oder neue Themen anzuspre
chen. Derartige Treffen mit Berichterstattern des EP zu bestimmten Themen können
auch auf Vorschlag eines einzelnen Fachausschusses eines nationalen Parlaments orga
nisiert werden.172
Als weitere Form der Zusammenarbeit des EP mit den nationalen Parlamenten kann
man die oben beschriebene Teilnahme der MEPs an den Sitzungen der nationalen Parla
mente bezeichnen. Allerdings muss man festhalten, dass die MEPs nur in den seltensten
Fällen diese Möglichkeiten der Teilnahme tatsächlich nutzten; nur die Zusammenarbeit
im belgischen Parlament scheint zufriedenstellend (dies wird durch die räumliche Nähe
vereinfacht).173
168 Siehe Punkt 4 (S. 51) dieser Arbeit; PFLÜGER 2000, S. 236; Conference of Speakers of National Par
liaments: Calendar. [http://www.eu-speakers.org/en/calendar/; Zugriff am 29.06.2006]; Neunreither
2005, S. 470.
169 Vgl. PFLÜGER 2000, S. 236, 243; FUCHS 2001, S. 236.
170 Zuvor wurden die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten von einer Division des Generalsekre
tariats des EP bearbeitet, die Division wurde nun zu einer Direktion aufgewertet, die der neuen Gene
raldirektion II „Interne Politikbereiche der EU“ unterstellt ist. Vgl. NEUNREITHER 2005, S. 482.
171 Vgl. PÖHLE 1998, S. 87; Europäisches Parlament: Beziehungen zu den nationalen Parlamenten. Auf
gabenbeschreibung der Direktion.
172 Vgl. European Parliament: Relations with national parliaments. Cooperation and Exchange Program
me. [http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/13; Zugriff am 28.06.2006]; NEUNREITHER
2005, S. 473.
173 Vgl. NEUNREITHER 2005, S. 484.
43
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
3.3 Zusammenarbeit der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
3.3.1 Überblick
Bei der Vorstellung der Tätigkeiten des EP wurden schon einige Instrumente der inter
parlamentarischen Zusammenarbeit in der EU angesprochen und kurz vorgestellt.
Hauptziele der interparlamentarischen Kooperation in der EU sollten zum einen die Be
reitstellung von Informationen und die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle in al
len Gebieten der Kompetenzen der EU sein und zum anderen die Sicherung der effekti
ven Ausübung der Kompetenzen der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten,
insbesondere im Bereich der Subsidiaritätskontrolle.174
Die Leitlinien über die Interparlamentarische Kooperation in der EU, die auf der
Konferenz der Parlamentspräsidenten von den Sprechern der einzelstaatlichen Parla
mente und des EP in Den Haag am 3. Juli 2004 beschlossen wurden, halten die Grund
lage der interparlamentarischen Kooperation in der EU fest und stellen die derzeit wich
tigsten Formen der Kooperation dar.
Laut diesen Leitlinien verläuft die interparlamentarische Kooperation in der EU
hauptsächlich über die Konferenz der Parlamentspräsidenten, die Treffen der Fachaus
schüsse, die COSAC, gleichzeitige Debatten in den Parlamenten, über die Generalse
kretäre der Parlamente sowie die Verbindungsbüros der nationalen Parlamente in Brüs
sel. Zum Informationsaustausch dienen das ECPRD sowie IPEX. Gemäß den Leitlinien
soll bei der interparlamentarischen Kooperation das Hauptaugenmerk auf die Bereiche
der Subsidiaritätskontrolle, den Informations- und Dokumentenaustausch sowie Konfe
renzen u.ä. Veranstaltungen gelegt werden. Außerdem soll ein Kalender der interparla
mentarischen Treffen zur Verfügung gestellt werden, Ansprechpartner dafür ist jeweils
der Generalsekretär des Parlaments, welches die folgende Konferenz der Parlamentsprä
sidenten der EU (kleine PPK) ausrichtet.175 Die Leitlinien unterstreichen die Autonomie
jedes Parlaments, das den Grad seiner Einbindung in interparlamentarische Kooperatio
nen selbst bestimmen kann. Die nationalen Parlamente und das EP werden auf die glei
che Basis gestellt und nehmen sich ergänzende Rollen in der EU-Struktur ein.176
Weitere Formen der interparlamentarischen Zusammenarbeit bilden die Beziehungen
im Rahmen interparlamentarischer Versammlungen, z.B. des Europarates, der NATO,
der WEU, zur Versammlung der IPU, der OSZE, etc.177 Diese Formen der Kooperation
werden hier nicht tiefer erläutert. Im Folgenden erfolgt eine Darstellung einiger Instru
mente der Kooperation der nationalen Parlamente untereinander sowie mit dem EP.
174 Conference of Speakers of National Parliaments: Guidelines: Interparliamentary Cooperation in the
European Union. 3. July 2004. Punkt I.
175 Veröffentlichung über die IPEX-Website geplant, derzeit über die Website der PPK.
176 Conference of Speakers of National Parliaments: Guidelines: Interparliamentary Cooperation in the
European Union. 3. July 2004; Neunreither 2005, S. 479.
177 Mehr dazu u.a. GRUNERT 2004, S. 411 ff.
44
3.3 Zusammenarbeit der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
3.3.2 Konferenz der Parlamentspräsidenten178
Die älteste Form der interparlamentarischen Kooperation ist die Konferenz der Par
lamentspräsidenten. Einzelne isolierte Sitzungen fanden bereits 1963 und 1973 statt. Im
Jahr 1975 wurden dann durch die Initiierung des EP regelmäßige Sitzungen ins Leben
gerufen. Auf dieser Plattform werden Diskussionen zu „großen Themen“ europäischer
Politik geführt und die interparlamentarische Zusammenarbeit gefördert. Der direkte
politische Einfluss ist jedoch eher begrenzt, vor allem, da die Wahrnehmung der Rolle
der Konferenz unter den Mitgliedstaaten nicht einheitlich ist.179
Die ursprünglich gegründete Konferenz der Parlamentspräsidenten hat sich 1999 ge
teilt. So treffen sich nun auf diesen Konferenzen die Präsidenten der nationalen Parla
mente der Mitgliedstaaten der EU und des EP (Kleine PPK) jährlich und die Präsiden
ten der Parlamente der Mitgliedstaaten des Europarates (Große PPK) alle zwei Jahre
zum Meinungs- und Informationsaustausch. Ziel der Treffen ist es, die Kontakte sowie
den Meinungsaustausch zwischen den Parlamenten zu fördern.180
Wichtig für die interparlamentarische Kooperation in der EU ist besonders die kleine
PPK. Sie hat die Aufgabe, die Koordination von interparlamentarischen EU-Aktivitäten
zu betreuen. Die Konferenz ist ein Forum, auf dem die Bereitstellung von Informatio
nen und die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle in allen Kompetenzbereichen der
EU im Mittelpunkt steht. Außerdem fördert die kleine PPK Studien und gemeinsame
Aktivitäten zu verschiedenen Themen in Verbindung mit der Rolle der Parlamente.181
Als Ergebnisse der Konferenz der Präsidenten werden zentrale politische Entwick
lungen in ihren Grundzügen bewertet sowie Empfehlungen ausgesprochen, auf die man
sich im Konsens einigt. Dies gilt vor allem für wichtige Themen wie die Erweiterung
der EU oder die Stärkung der interparlamentarischen Zusammenarbeit in der EU.182
Zu erwähnen sind besonders die oben erwähnten von der Konferenz in Den Haag
2004 verabschiedeten Richtlinien zur interparlamentarischen Kooperation in der EU.183
Es zeigt sich, dass die PPK oftmals die interparlamentarische Kooperation anregt, was
sich weiterhin u.a. darin zeigt, dass sie die COSAC ins Leben gerufen hat.
178 Bezeichnet auch als Konferenz der Präsidenten der Parlamente der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
und des Europäischen Parlaments, Konferenz der Parlamentspräsidenten und -sprecher, Parlaments
präsidentenkonferenz, Conference of Speakers of the European Parliaments, Conférence des Prési
dents des Parlements.
179 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: What is the Speakers Conference? [http:// ww
w.eu-speakers.org/en/about/; Zugriff am 04.07.2006]; PÖHLE 1998, S. 86; NEUNREITHER 2005, S. 478;
GRUNERT 2004, S. 407; MAURER/ WESSELS2001, S. 456.
180 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: What is the Speakers Conference?; Bundesrat:
Parlamentarische Beziehungen. Berlin 2006d. [http://www.bundesrat.de/Site/Inhalt/DE/5_20EuropaInternationales/5.4_20Parlamentarische_20Beziehungen/5.4.1_20Gremien_20und_20Konferenzen/5.
4.1.2_PKK/HI/Parlamentspr_C3_A4sidentenkonferenz,templateId=renderUnterseiteKomplett.html;
Zugriff am 8.5.2006]; NEUNREITHER 2005, S. 478.
181 Conference of Speakers of National Parliaments: Guidelines: Interparliamentary Cooperation in the
European Union. 3. July 2004. Punkt II; Conference of Speakers of National Parliaments: What is
the Speakers Conference?
182 Vgl. GRUNERT 2004, S. 408; MAURER / WESSELS2001, S. 456.
183 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: What is the Speakers Conference?;
NEUNREITHER 2005, S. 478.
45
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
3.3.3 Zusammenarbeit der Fachausschüsse und Delegationsbesuche
Bei der Zusammenarbeit der Fachausschüsse auf europäischer Ebene gilt es, drei Arten
von Treffen zu unterscheiden, je nach dem, wer die Zusammenarbeit organisiert. Dazu
gehören:
a) die interparlamentarischen Treffen, die von einem einzelstaatlichen Parlament orga
nisiert werden (bilateral oder multilateral),
b) Treffen, die von der aktuellen EU-Präsidentschaft organisiert werden sowie
c) durch das EP organisierte Treffen.184
Ein Beispiel der erstgenannten Form der Kooperation ist die vom Schwedischen
Reichstag einberufene Konferenz zur EU-Richtlinie INSPIRE zum Thema der nachhal
tigen Entwicklung im April 2006.185 Zu bilateralen Kontakten der interparlamentari
schen Treffen kann man feststellen, dass in den 1990er Jahren die Parlamente Frank
reichs, Deutschlands und Großbritanniens die meisten bilateralen Kontakte unterhielten,
aber auch die skandinavischen Mitgliedstaaten wurden nach ihrem Beitritt recht aktiv.186
Wichtiger und regelmäßiger sind die Treffen der Fachausschüsse, die von der jewei
ligen EU-Präsidentschaft organisiert werden. Im Rahmen dieser Treffen kamen wäh
rend der britischen und der österreichischen Ratspräsidentschaft die Fachausschüsse
bzw. deren Vorsitzende für auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Landwirtschaft
und Entwicklung, Justiz und Inneres, Entwicklungszusammenarbeit, Finanzen und Um
welt zusammen. Außerdem gab es Treffen zur parlamentarischen Kontrolle der Dritten
Säule, eine Konferenz zur Subsidiarität sowie ein gemeinsames parlamentarisches Tref
fen zur Zukunft Europas (9. Mai 2006).187 Diese Treffen werden oftmals gleichzeitig in
Kooperation mit dem EP organisiert.
Gemeinsame Treffen gesamter Fachausschüsse der nationalen Parlamente und des
EP finden nur gelegentlich statt, häufiger kommt es zu Delegationsbesuchen von Ver
tretern der Fachausschüsse in den Parlamenten der Mitgliedstaaten.188 Die Teilnahme an
Sitzungen der Fachausschüsse des EP sind ein Grund zur Reise nationaler Abgeordneter
nach Brüssel, ein anderer sind Besuche von Delegationen aus Interesse an den Aktivitä
ten des EP.
In der aktuellen Debatte über die Rolle der nationalen Parlamente in der EU weist
man der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Fachausschüssen eine zentrale
Bedeutung zu. Modellcharakter für eine solche Zusammenarbeit haben die Begegnun
gen zwischen Vertretern der Europa-Gremien der nationalen Parlamente und dem Ver
fassungsausschuss des EP. Die Europa-Gremien werden regelmäßig über die Tagesord
nungen des Verfassungsausschusses informiert und sind ständig eingeladen, an seinen
Sitzungen teilzunehmen.189
Kritisch anzumerken ist, dass es derzeit noch keine umfassende zugängliche Daten
bank gibt, die die hier dargestellten Parlamentskontakte vollständig erfasst; die parla
mentarischen Ausschüsse sind größtenteils auf sich alleine gestellt. Demzufolge gibt es
184 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: Calendar. [http://www.eu-speakers.org/en/ca
lendar; Zugriff am 27.06.2006]. Die vom EP organisierten Treffen wurden oben in Punkt 3.2.4
(S. 41) dargestellt.
185 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: Calendar.
186 Vgl. NEUNREITHER 2005, S. 470.
187 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: Calendar.
188 Vgl. GRUNERT 2004, S. 410; NEUNREITHER 2005, S. 470.
189 Vgl. GRUNERT 2004, S. 409 f.
46
3.3 Zusammenarbeit der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
auch selten ein Feedback oder eine Evaluation, um die Kontakte zukünftig besser zu ge
stalten.190
3.3.4 Verbindungsbüros der nationalen Parlamente in Brüssel
Zahlreiche nationale Parlamente der EU-Mitgliedstaaten haben Verbindungsbüros in
Brüssel eingerichtet, in denen meist Beamte des nationalen Parlaments eingesetzt wer
den. Über diese Büros ist eine Netzwerkbildung der Parlamente möglich. Vornehmlich
beschaffen sie zeitnah Informationen über neue EU-Vorlagen, die nicht über das Inter
net erhältlich sind, sie können vor Ort Ausschusssitzungen des EP verfolgen, bauen
Kontakte mit den Mitarbeitern des EP auf etc. Dies verbessert die Fähigkeit der Parla
mente, ihre Regierungen effektiver zu kontrollieren. Die Repräsentanten in Brüssel kön
nen an dem regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den nationalen Parlamenten
oder auch dem COSAC-Sekretariat in Brüssel teilnehmen. Dies wird dadurch erleich
tert, dass die meisten dieser Verbindungsbüros der nationalen Parlamente sowie auch
das COSAC-Sekretariat direkt im EP-Gebäude in Brüssel ihren Sitz haben.191
Für Deutschland kann man festhalten, dass die Bundesländer schon ihre Verbin
dungsbüros in Brüssel eingerichtet haben. Der Bundestag plant derzeit die Schaffung ei
nes solchen Büros, das voraussichtlich noch im Jahr 2006 seine Arbeit aufnehmen wird.
Durch die Einrichtung des Verbindungsbüros wird die Mitwirkung des Bundestages
verbessert. Es sollen Mitarbeiter als Verbindungspersonen entsandt werden, die somit
eine Kontaktstelle zwischen den Europäischen Institutionen in Brüssel, den anderen
Vertretungen der nationalen Parlamente und dem Bundestag herstellen. 192 Dabei soll je
de Fraktion die Möglichkeit haben, einen Referenten dorthin zu entsenden.193 Voraus
sichtlich wird es auch eine wichtige Rolle bei der Durchführung des im Verfassungsver
trag festgehaltenen Frühwarnmechanismus spielen.194
3.3.5 Zusammenarbeit im Bereich der Dokumentation und Information
Europäisches Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation
(ECPRD)
Das Europäische Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation (Eu
ropean Center for Parliamentary Research and Documentation) wurde 1977 auf Wunsch
der Konferenz der Parlamentspräsidenten unter der Schirmherrschaft des Präsidenten
des EP sowie der Parlamentarischen Versammlung des Europarates geschaffen. Dieses
internationale Netzwerk wird zur Informationsbeschaffung und Zusammenarbeit zwi
190 Vgl. NEUNREITHER 2005, S. 471.
191 Vgl. Deutscher Bundestag/ Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a,
S. 47; NEUNREITHER 2005, S. 480; Conference of Speakers of National Parliaments: Guidelines: Inter
parliamentary Cooperation in the European Union. 3. July 2004; NEUNREITHER 2005, S. 480 f.
192 Interview mit Steffen Reiche, MdB, Berlin 19.6.2006.; vorgeschlagen u.a. schon von PFLÜGER 2000,
S. 243; SACH, ANNETTE: Bundestag errichtet Horchposten in Brüssel. Vereinbarung mit der Bun
desregierung soll Mitbestimmungsrechte des Parlaments stärken. In: Das Parlament, Nr. 27,
03.07.2006.
193 Schriftliches Interview mit Michael Link, MdB, Juni 2006.
194 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin.
47
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
schen den Wissenschaftlichen Diensten der nationalen Parlamente und des EP ge
nutzt.195
Ziel des ECPRD ist es, den Informations-, Erfahrungs- und Ideenaustausch zu The
men von gemeinsamem Interesse für das EP und die nationalen Parlamente zu fördern,
die derzeitige enge Zusammenarbeit zwischen den Forschungs- und Dokumentations
diensten der nationalen Parlamente in allen Bereichen zu stärken sowie die von den Par
lamentsdiensten durchgeführten Untersuchungen zu sammeln, auszutauschen und wei
terzuverbreiten.196
Zu den Aktivitäten des ECPRD gehört die Ausrichtung von Seminaren zu Themen,
die die Parlamentsmitarbeiter betreffen. Somit kommen über das ECPRD die Beamten
der europäischen Parlamente zusammen, die für die Informationsbeschaffung und -ver
teilung sowie die Vorbereitung der Gesetzgebung zuständig sind. Das Sekretariat des
ECPRD befindet sich im Europäischen Parlament in Brüssel.197
IPEX
Das IPEX-Programm (Interparliamentary EU Information Exchange, Arbeitsgruppe für
interparlamentarische EU-Information), ging hervor aus Beschlüssen der Konferenz der
Parlamentspräsidenten 2000, 2003 und 2004. Das Ziel von IPEX ist es, die interparla
mentarische Kooperation in der EU durch die Bereitstellung einer Plattform für den
elektronischen Informationsaustausch zu EU-Themen zwischen den Parlamenten der
Union zu unterstützen.198 Schon derzeit kann die Vorversion der IPEX-Website (unter
http://www.ipex.eu bzw. http://www.ecprd.org/ipex/index.asp) eingesehen werden.199
Mit der Inbetriebnahme der permanenten IPEX-Website soll es den nationalen Parla
menten möglich sein, EU-bezogene Informationen über spezielle Vorschläge und Doku
mente direkt auszutauschen (über eine Datenbank). Weiterhin ist es geplant, dass die
neue IPEX-Website alle Dokumente der Kommission sowie relevante Dokumente der
anderen EU-Institutionen enthält, mit täglicher Aktualisierung. Vorausgesehen ist au
ßerdem, dass jedes Parlament bzw. jede Kammer alle eigenen relevanten parlamentari
schen Dokumente, die die IPEX-Dossiers betreffen, auf die Website hochlädt (inkl. des
aktuellen Stands der Behandlung).200 Man erwartet, dass IPEX ein wichtiges Instrument
bei der Durchführung des Frühwarnmechanismus wird.
Der auf der IPEX-Website eingestellte Kalender der interparlamentarischen Koope
rationen soll genutzt werden, Informationen zu Treffen auszutauschen, wie in den Leit
linien der Interparlamentarischen Kooperation von Den Haag gefordert. Eine Dokumen
195 Vgl. ECPRD: About us. 2006. [http://www.ecprd.org/Public/aboutus.asp; Zugriff am 19.7.2006];
Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a, S. 228;
ECPRD: Satzung des ECPRD, angenommen am 7.6.1996 in Budapest; TOORNSTRA / ECPRD 2003,
S. 4; GRUNERT 2004, S. 416; NEUNREITHER 2005, S. 479.
196 Vgl. ECPRD: About us. 2006; Europäisches Parlament: Die Beziehungen zu den nationalen Parla
menten der Mitgliedstaaten. [http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do? id=
58&pageRank=1&language=de; Zugriff am 26.06.2006].
197 Vgl. ECPRD: About us. 2006; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 4; NEUNREITHER 2005, S. 480.
198 Vgl. IPEX: IPEX Informs. IPEX – A Presentation. Factsheet Nr. 1. January 2006. [http://www.euspeakers.org/en/ipex/; Zugriff am 23.6.2006]; NEUNREITHER 2005, S. 480; FRAGA, ANA After the Con
vention: The Future Role of National Parliaments in the European Union (And the day after ... noth
ing will happen). In: Journal of Legislative Studies, 11, 2005, Nr. 3–4, S. 500.
199 Die neue Version wurde offiziell am 29. Juni 2006 auf dem Treffen der Parlamentspräsidenten in
Kopenhagen in Betrieb genommen.
200 Vgl. IPEX 2006; GRUNERT 2004, S. 417.
48
3.3 Zusammenarbeit der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
tation und Informationen bezüglich der Aktivitäten der Konferenz der Parlamentspräsi
denten und der Generalsekretäre ist eingeschlossen, genauso wie Informationen zu CO
SAC, regelmäßigen Treffen der Fachausschüsse und anderen Foren und Netzwerken so
wie zu interparlamentarischen Ad-hoc-Treffen.201
Die Hauptnutzer von IPEX als ein Werkzeug für interparlamentarische Kooperation
werden die nationalen Parlamente sein. Dennoch wird ein Großteil der IPEX-Website,
neben einigen Bereichen mit beschränktem Zugang, der Allgemeinheit zur Verfügung
stehen.202
3.3.6 Beziehungen zwischen den Parlamentsverwaltungen
Als eine weitere wichtige Form der Kooperation zwischen den nationalen Parlamenten
gelten die Beziehungen zwischen den Parlamentsverwaltungen. Das EP organisiert jähr
lich seit 1993 Treffen zwischen den Verwaltungen der nationalen Parlamente und des
EP.203
Im Rahmen der Treffen des ECPRD, das die Wissenschaftlichen Dienste der Parla
mente vernetzt, finden jährlich Treffen der Korrespondenten204 statt, das nächste im Ok
tober 2006 London.205
Des weiteren soll durch das Parliamentary Committee Network (PCN) die Zusam
menarbeit der Fachausschüsse auf Verwaltungsebene unterstützt werden. Problematisch
dabei ist allerdings, dass es nicht immer korrespondierenden Ausschüsse bzw. äquiva
lente Ausschüsse auf der nationalen Ebene der verschiedenen EU-Staaten gibt.
Einer Kooperation zwischen den Parlamentsverwaltungen dienen sicherlich auch die
im EP angesiedelten Verbindungsbüros der nationalen Parlamente, die meist durch Ver
treter der Parlamentsverwaltungen besetzt sind. Gegenwärtig haben fast alle Kammern
der Mitgliedstaaten Ständige Vertreter im EP.206
Eine einfach scheinende, aber noch immer zu wenig genutzte Möglichkeit der Ko
operation ist der Beamtenaustausch. Es bestehen schon Vorkehrungen in den Parla
mentsverwaltungen sowohl der den meisten nationalen Parlamente als auch beim EP,
um Austauschbeamte über einen längeren Zeitraum in die jeweilige administrative
Struktur einzubinden. Genutzt wurde dies weitgehend jedoch nur von den Parlaments
verwaltungen der Beitrittsländer (im EP).207
201 Vgl. IPEX 2006.
202 Vgl. IPEX 2006.
203 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a,
S. 64.
204 Jedes nationale Parlament ernennt einen ECPRD-Korrespondenten, d.h. eine Kontaktperson zwi
schen Parlament und EPCRD. Dies sind meist Mitarbeiter der Wissenschaftlichen Dienste der Parla
mente.
205 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: Calendar.
206 Siehe Punkt 3.3.4 (S.47) dieser Arbeit; GRUNERT 2004, S. 415.
207 Vgl. GRUNERT 2004, S. 416.
49
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
3.3.7 COSAC – Die Konferenz der Europa-Gremien der nationalen Parlamente
Eine weitere Form der interparlamentarischen Kooperation ist die Konferenz der Aus
schüsse der Europa-Gremien der nationalen Parlamente der EU. Die COSAC soll an
dieser Stelle zum Zweck der Einordnung als Kooperationsinstrument erwähnt werden,
eine ausführliche Darstellung folgt in Kapitel 4 (S. 51) dieser Arbeit.
3.4 Derzeitige interparlamentarische Kooperationen des deutschen Bun
destages
Der Deutsche Bundestag ist an allen der oben genannten Formen den interparlamentari
schen Kooperationen weitgehend beteiligt.
Der EU-Ausschuss des Bundestages sprach sich in seinem Bericht an die Bundesre
gierung im Vorfeld des Europäischen Rates von Dublin im Dezember 1996 dafür aus,
dass die bestehenden Kontakte zwischen den nationalen Parlamenten und mit dem EP
im Rahmen der jeweiligen nationalen Regelungen in Deutschland intensiviert werden.208
In Deutschland wurde durch die Zusammensetzung des Europaausschusses des Bun
destages bereits ein guter Ansatz zur Zusammenarbeit der nationalen Parlamente mit
dem EP geschaffen, da die Möglichkeit der Teilnahme von deutschen Mitgliedern des
EP an den Sitzungen des Europaausschusses besteht. Vor allem durch die terminlichen
Überschneidungen der Sitzungen wird diese Möglichkeit leider nicht so oft genutzt.209
Eine Überlegung für eine bessere Zusammenarbeit wäre die Ausweitung der Teilnah
me der Mitglieder des EP auf die Sitzungen aller Ausschüsse des Bundestages. So
könnte ein unmittelbarer, direkter Meinungsaustausch der nationalen und europäischen
Fachpolitiker stattfinden. Die Intensivierung der Kooperation der korrespondierenden
Ausschüsse auf nationaler und europäischer Ebene könnte außerdem zu einer Einfluss
nahme der nationalen Parlamente auf das Jahresgesetzgebungsprogramm der Kommis
sion führen.210
Eine der sehr intensiv genutzten Formen der Zusammenarbeit auf europäischer Ebe
ne sind die Delegationsreisen der Ausschüsse und Enquete-Kommissionen des Bundes
tages, die dazu dienen, Erkenntnisse und Erfahrungen zu aktuellen und wichtigen politi
schen Themen auf europäischer Ebene zu sammeln.211 Als Beispiel für die Zusammenar
beit des Bundestages mit den anderen nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten
soll der Zeitraum der 15. Wahlperiode (von 2002 bis 2005) herausgegriffen werden.
In diesem Zeitraum führten zahlreiche Ausschüsse des Bundestages Gespräche mit
den Mitgliedern des EP, der Europäischen Kommission und anderen Europäischen Or
ganisationen.212
Ein sehr wichtiger Partner in der europäischen Zusammenarbeit ist Frankreich. Bei
spiel der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist die „Gemeinsame Erklärung der
Délégation pour l’Union Européenne der Assemblée Nationale und des Ausschusses für
die Angelegenheiten der Europäischen Union des Deutschen Bundestages über die Re
gierungskonferenz und die Europäische Verfassung“ im Jahr 2003 kurz vor der Eröff
nung der Regierungskonferenz zur Europäischen Verfassung, in der sie gemeinsam ihre
208 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 3.
209 Vgl. KABEL 1995, S. 261 f.
210 Vgl. KABEL 1995, S. 262.
211 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 6.
212 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 7.
50
3.4 Derzeitige interparlamentarische Kooperationen des deutschen Bundestages
Unterstützung für den vom Konvent verabschiedeten Entwurf eines Vertrages über eine
Verfassung für Europa bekundeten.213 Im Rahmen einer noch immer sehr engen Koope
ration finden weiterhin gemeinsame Sitzungen der beiden Ausschüsse statt, zuletzt im
März 2006 in Paris.
Weiterhin trafen sich Mitglieder der Europaausschüsse des Bundesrates und des
französischen Senats am 20. Januar 2006 in Strasbourg zu einer ersten gemeinsamen
Arbeitssitzung, bei der vor allem die Themen Subsidiaritätskontrolle, „bessere Rechts
setzung“ sowie die Kommunikationsstrategie der Europäischen Union behandelt und
gemeinsame Ziele formuliert wurden. Beide Delegationen kamen überein, dass sie wei
tere gemeinsame Arbeitssitzungen abhalten werden, um gemeinschaftliche Initiativen
vorzubereiten.214
Zudem besuchen Delegationen des Europaausschusses kurz vor Beginn einer neuen
EU-Ratspräsidentschaft das jeweilige Land des nächsten Vorsitzes. In Gesprächen mit
Parlamentariern und Regierungsvertretern lassen sie sich über Vorhaben und Schwer
punkte der Ratspräsidentschaft informieren oder tauschen Positionen aus.215
Auch schon vor dem Beitritt der acht osteuropäischen Länder fanden Delegationsrei
sen im Austausch statt, u.a. reisten Mitglieder des Europaausschusses des Bundestages
zu politischen Gesprächen mit Abgeordneten der Europaausschüsse des polnischen
Sejm und der französischen Nationalversammlung nach Warschau. Diese Zusammenar
beit im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ (Polen – Frankreich – Deutschland) wird
weiterhin gepflegt. Auch in Tschechien, der Slowakei, Slowenien, den baltischen Staa
ten, Ungarn sowie in den Kandidatenländern Bulgarien und der Türkei fanden Gesprä
che statt.216
Außerdem gab es zahlreiche Treffen der Fachausschüsse mit deutscher Beteiligung
auf europäischer Ebene. Dazu gehört u.a. die Konferenz der Agrarausschüsse der Parla
mente der EU-Mitgliedstaaten, des EP und der EU-Kandidatenländer in Athen (19. Mai
2003) oder die XIV. Interparlamentarische EUREKA-Konferenz in Kopenhagen (23.
und 24. Juni 2003).217
4. Die COSAC – Ein Beispiel der parlamentarischen Kooperation auf
europäischer Ebene
4.1 Organisation
4.1.1 Entwicklung und Rechtsgrundlagen
Im Jahr 1985, als die Einheitliche Europäische Akte die Schaffung eines Binnenmarktes
ankündigte, begannen die ersten nationalen Parlamente ihre Struktur der europäischen
213 Vgl. Deutscher Bundestag, Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union / Assemblée
Nationale, Délégation pour l’Union Européenne: Gemeinsame Erklärung der Délégation pour l’Uni
on Européenne der Assemblée Nationale und des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäi
schen Union des Deutschen Bundestages über die Regierungskonferenz und die Europäische Verfas
sung. 2003; Deutscher Bundestag Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 8.
214 Vgl. Bundesrat / Sénat: Treffen am 20. Januar 2006 – Strasbourg. Gemeinsame Erklärung.
215 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 10 f.
216 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 12 ff.
217 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 15/5056 vom 09.03.2005, S. 7.
51
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Entwicklung anzupassen, um ihre Stellung hinsichtlich Informationsbeschaffung und
Einflussnahme zu verbessern. Unter anderem wurden häufig Europaausschüsse gegrün
det, zum Teil mit Beteiligung der „nationalen“ Mitglieder im EP, sie hatten jedoch kei
nen organisierten Kontakt miteinander.218
Hintergrund der Gründung der COSAC219 war das Ergebnis einer umfassenden Ana
lyse des Verhältnisses der nationalen Parlamente zur europäischen Integration. Diese
wurde von Laurent Fabius, dem damaligen Präsidenten der französischen Nationalver
sammlung, auf der Konferenz der Parlamentspräsidenten vom 18. bis 20. Mai 1989 in
Madrid vorgelegt. Inhaltlich stellte die Analyse fest, dass die nationalen Parlamente
zwar neue Verträge der EU ratifizierten; sie dürften jedoch nichts an ihrem Inhalt än
dern. Viele der europäischen legislativen Akte gingen an den Parlamenten vorbei und
würden dennoch zu unmittelbarem national geltenden Recht (Verordnungen und Richt
linien, zu deren Umsetzung in nationales Recht die Parlamente nicht benötigt werden).
Selbst wenn die Richtlinien von den einzelstaatlichen Parlamenten umgesetzt würden,
wäre ihnen der Inhalt vorgegeben. Somit fielen auf immer mehr Ebenen der EU Ent
scheidungen, die ohne parlamentarische Kontrolle getroffen würden, z.B. wenn im
nicht-öffentlich tagenden Rat Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Besonders
durch die fehlenden Informationen über die Entscheidungen aus Brüssel seien die Parla
mente oftmals auf europäischer Ebene handlungsunfähig. Eine indirekte Bestätigung
dieser Tatsache findet sich darin, dass die Verträge von Maastricht, Amsterdam, Nizza
und auch der Verfassungsvertrag eine verbesserte Information der nationalen Parlamen
te fordern. Diese beschriebenen Kompetenzverlagerungen und die dadurch aufkommen
de Frage, ob die EU demokratisch legitimiert sei, verlangten nach einer Kompensati
on.220
Im Ergebnis schlug Fabius vor, halbjährliche Tagungen der europäischen Gremien
der nationalen Parlamente abzuhalten, jeweils in dem Land, das die Ratspräsidentschaft
innehat. Daraufhin lud er zu einem ersten Treffen am 16./17. November 1989 nach Pa
ris ein.221
Hier wurde die COSAC gegründet. Die französische Nationalversammlung stellte
sich eine institutionalisierte Mitwirkung der nationalen Parlamente auf europäischer
Ebene in Form einer national-parlamentarischen Kammer vor. Vielen Parlamenten gin
gen diese Überlegungen allerdings zu weit; der Kompromiss war die COSAC. Schon
zur ersten Sitzung wurden Vertreter fast aller nationalen Parlamente der EU und des EP
entsandt. Das Gründungsziel des Gremiums war es, den Meinungs- und Informations
austausch der für die Angelegenheiten der EU zuständigen Ausschüsse in den nationa
len Parlamenten der EU zu fördern sowie die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten auf
europäischer Ebene sichtbar zu machen. Diese zunächst informelle interparlamentari
218 Vgl. PÖHLE 1998, S. 79.
219 Das Akronym COSAC leitet sich von der französischen Bezeichnung „Conférence des Organes Spé
cialisés en Affaires Communautaires“ ab, also die „Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschaftsund Europa-Angelegenheiten (der einzelstaatlichen Parlamente der Europäischen Union und des Eu
ropäischen Parlaments)“ [gemäß der Geschäftsordnung der COSAC] oder auch „Konferenz der Aus
schüsse für Gemeinschafts- und Europaangelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union“.
Kurz wird sie auch als Konferenz der Europaausschüsse bezeichnet.
220 Vgl. FABIUS, LAURENT Les Parlements Européens dans la Perspective de l’Europe de 1993, le Traite
ment des Affaires coummunautaires et la Collaboration entre les Chambres. Madrid, Mai 1989;
TORDORFF 2000, S. 1; PÖHLE 1998, S. 79; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 16.
221 Vgl. PÖHLE 1998, S. 79; TORDORFF 2000, S. 1; MAURER 2002, S. 301.
52
4.1 Organisation
sche Einrichtung zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch blieb anfangs ohne Außen
wirkung.222
Trotz dem, dass die Konferenz der Parlamentspräsidenten dem Vorschlag von Fabius
im Mai 1989 zugestimmt hatte, entsandten einige Parlamente zur ersten Sitzung nur wi
derstrebend ihre Vertreter. Mittlerweile ist die COSAC ein Teil des institutionellen Ge
füges der EU und in den Verträgen verankert, das Misstrauen ihr gegenüber ist gesun
ken. Sie gilt als das wichtigste Forum für parlamentarischen Informationsaustausch und
Beratung.223 Dennoch ist sie eine kaum bekannte Institution der EU geblieben.
Ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung der COSAC wurde dadurch einge
leitet, dass der Europäische Rat von Turin am 29. März 1996 eine Regierungskonferenz
zur Reform des Vertrages von Maastricht beschloss. Insbesondere sollten die Institutio
nen der EU verbessert und u.a. auch geprüft werden, in welcher Form und inwieweit die
nationalen Parlamente, auch gemeinsam, besser zur Erfüllung der Aufgaben der Union
beitragen können. Die einzelnen Parlamente der EU legten Vorschläge und Stellung
nahmen vor, doch die wichtigste Grundlage der Beratungen der Regierungskonferenz
bildeten die Schlussfolgerungen der XV. COSAC in Dublin vom 16. Oktober 1996 so
wie eine Aufzeichnung des damaligen irischen Ratsvorsitzes vom 19. November
1996.224
Die Schlussfolgerungen der COSAC von Dublin stellen klar, dass die COSAC die
einzelnen nationalen Parlamente durch den Zugang zu Erfahrungen und Informationen
anderer Parlamente unterstützt, und sie fordern, dass die Organisation zur Förderung der
parlamentarischen Zusammenarbeit verstärkt und die Arbeitsweise verbessert werden
solle. Spezifische Themen der COSAC sollten Fragen der Subsidiarität oder der 2. und
3. Säule sein. Die Schlussfolgerungen der COSAC seien als Vorschläge anzusehen; sie
seien keinesfalls bindend. Diese Schlussfolgerungen könnten jeweils den Organen der
EU und den Regierungen der Mitgliedstaaten übermittelt werden. Die irische Präsident
schaft schlägt in dem Protokollentwurf über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente
über die Schlussfolgerungen der COSAC hinaus vor, dass die Konferenz weitgehende
Beiträge für die anderen Organe der EU liefern solle. Die COSAC solle demnach von
Regierungen der Mitgliedstaaten oder einem einzelstaatlichen Parlament ersucht wer
den können, EU-Vorschläge zu prüfen oder Stellungnahmen abzugeben.225
Ergebnis der Verhandlungen im Zuge der Revision des Maastrichter Vertrages war
es, dass dem Amsterdamer Vertrag (1997) das schon oben erwähnte „Protokoll über die
Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union“ zugefügt wurde. 226 In
diesem Protokoll wird die COSAC erstmals in den Europäischen Verträgen erwähnt
und dadurch deutlich aufgewertet. Die Aufnahme der COSAC in den Vertrag von Ams
terdam fand recht überraschend statt und schuf gegenüber der Ausgangslage eine poli
222 Vgl. Bundesrat: COSAC. Konferenz der Europaausschüsse der Parlamente der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und des Europäischen Parlaments. Berlin 2006c. [http://www.bundesrat.de/
Site/Inhalt/DE/5_20Europa-Internationales/5.4_20Parlamentarische_20 Beziehungen/5.4.1_20Gre
mien_20und_20Konferenzen/5.4.1.4_COSAC/HI/COSAC,templateId=renderUnterseiteKomplet
t.htm; Zugriff am 08.05.2006]; JANOWSKI 2005, S. 214 f.; FUCHS 2004, S. 21; MAURER 2002, S. 301;
CYGAN 2001, S. 37; PÖHLE 1998, S. 79.
223 Vgl. GRUNERT 2004, S. 401; PÖHLE 1998, S. 82.
224 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 1;
CYGAN 2001, S. 40.
225 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 4 f.
226 Protokoll über die Rolle einzelstaatlicher Parlamente (1997). Der Vertrag von Nizza übernimmt das
Protokoll unverändert.
53
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
tisch und rechtlich veränderte Situation. Nun sind die Europa-Gremien der nationalen
Parlamente der Mitgliedstaaten der EU die einzigen Ausschüsse, die über ein in den
Verträgen verankertes institutionalisiertes Forum des Meinungsaustausches verfügen.227
4.1.2 Struktur und Arbeitsweise entsprechend der Geschäftsordnung
Auf der VI. COSAC in Luxemburg im Jahre 1991 wurde die erste Geschäftsordnung
der COSAC verabschiedet und in den folgenden Jahren mehrfach geändert. Darin regelt
sie ihre Struktur und den Ablauf der Arbeiten.228 Zuletzt wurde die Geschäftsordnung
auf der XXIX. COSAC im Mai 2003 in Athen in einigen Punkten erneuert.
In der Geschäftsordnung wird festgelegt, dass die Sitzungen jeweils im Verlauf der
halbjährlichen Ratspräsidentschaft stattfinden und jeweils eineinhalb Tage dauern sol
len. Die Sitzungen der COSAC werden immer von dem nationalen Parlament des Mit
gliedstaates ausgerichtet und finden auch in diesem Land statt, das gerade die Präsident
schaft des Rates der EU inne hat. Der entsprechende Ausschuss dieses Landes führt
während der Präsidentschaft auch den Vorsitz der COSAC. Außerordentliche Sitzungen
können auch in einem anderen Land stattfinden.229
Zu den Teilnehmern der COSAC ist in der Geschäftsordnung festgehalten, dass je
sechs Abgeordnete der nationalen Parlamente pro EU-Mitgliedsland an den Tagungen
teilnehmen können. Auch das EP entsendet sechs Delegierte, darunter zwei für die Be
ziehungen zu den nationalen Parlamenten zuständige Vizepräsidenten. Die Vertreter ei
nes Landes bzw. des EP bilden eine Delegation, wobei jedes Parlament die Zusammen
setzung seiner eigenen Delegation bestimmt.230 Falls ein Parlament in mehrere Kammern
untergliedert ist, teilen sich die sechs Delegierten nach innerstaatlichen Vereinbarungen
auf die beiden Kammern auf.231 Im Falle Deutschlands haben sich der Bundesrat und der
Deutsche Bundestag darauf geeinigt, als deutsche Teilnehmer zwei Vertreter des Bun
desrates und vier Vertreter des Bundestages zu entsenden. Der Bundesrat ist in der Re
gel durch den Vorsitzenden des Ausschusses für Fragen der Europäischen Union oder
durch ein bis zwei Vertreter des Ausschusses vertreten. Der Deutsche Bundestag ent
sendet Mitglieder des EU-Ausschusses, nach Festlegung der Fraktionen. Meist nimmt
der Vorsitzende des Europaausschusses oder ein Stellvertreter teil. Oftmals werden die
vier Plätze nicht ganz ausgeschöpft. Es erfolgt bei der COSAC keine parteipolitische
Ordnung nach Fraktionen.232 Grundsätzlich sind die Sitzungen der COSAC öffentlich.233
Eine bedeutende Veränderung war die Entscheidung im April 1994 auf der X. CO
SAC in Athen, Beobachter aus den Kandidatenländern für die Sitzungen zuzulassen.234
Bis zu drei Abgeordnete der Parlamente eines Beitrittsstaates können als Beobachter an
den Sitzungen teilnehmen, vorausgesetzt, die Beitrittsverhandlungen wurden offiziell
227 Vgl. FUCHS 2004, S. 21; PÖHLE 1998, S. 78 ff.; Tordorff 2000, S. 3; PFLÜGER 2000, S. 243; MAURER /
WESSELS 2001, S. 62 f.
228 Amtsblatt der Europäischen Union: Europäisches Parlament: Geschäftsordnung der Konferenz der
Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europa-Angelegenheiten der Parlamente der Europäischen Uni
on. 4.11.2004. (2004/C 270/01).
229 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 2, 3, 11; TORDORFF 2000, S. 4; JANOWSKI 2005, S. 215; FUCHS
2004, S. 21.
230 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 4.1.
231 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 4.
232Vgl. PÖHLE 1998, S. 79, 83; Bundesrat 2006c; FUCHS 2004, S. 21; TORDORFF 2000, S. 2.
233 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 4.4.
234 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 4.2.
54
4.1 Organisation
eröffnet. Seit Mai 1998 haben die Beobachter das Recht, an Debatten zu bestimmten
Themen teilzunehmen.235 Der Meinungsaustausch zwischen den Parlamentariern der al
ten und der neuen Mitgliedstaaten bzw. der Beitrittskandidaten ist eine der wertvollsten
Errungenschaften der COSAC.236
Von den 25 Mitgliedstaaten der EU haben 13 Staaten ein Einkammerparlament, 12
Volksvertretungen sind als Zweikammerparlamente organisiert. Somit sind derzeit 37
parlamentarische Kammern auf der COSAC vertreten. Dazu kommen die parlamentari
schen Kammern der Kandidatenländer sowie das EP.237
Das vorsitzende und leitende Organ der COSAC ist die Vorsitz-Troika. Sie besteht
aus den Europaausschussvorsitzenden der Parlamente der EU-Mitgliedstaaten der lau
fenden, der vorangegangenen und der kommenden Ratspräsidentschaft sowie Vertretern
des EP (je zwei Vertreter).238 Vor den Sitzungen der COSAC findet meist eine vorberei
tende Sitzung der Troika statt. Sie stellt nach Vorschlägen von Themen durch die Dele
gationen einen Entwurf der Tagesordnung auf und regelt andere formelle Fragen. Die
Tagesordnung wird von der Konferenz selbst beschlossen. Die Themen der Tagesord
nung sollen sich aus der Rolle der COSAC als Gremium für den Austausch von Infor
mationen, insbesondere über die praktischen Aspekte der parlamentarischen Kontrolle
ergeben.239 Meist beinhaltet die Tagesordnung zwei Themenbereiche, einen, der sich mit
institutionellen Fragen beschäftigt, und einen anderen, der auf bestimmte Politikberei
che ausgerichtet ist.240
Vorbereitet werden können die Plenarsitzungen der COSAC außerdem durch Sitzun
gen der Vorsitzenden der Europa-Gremien der nationalen Parlamente und eines Vertre
ters des EP im Einvernehmen mit der Vorsitz-Troika.241
Durch eine Änderung der Geschäftsordnung 1999 ist es nun außerdem möglich, dass
die COSAC Arbeitsgruppen einsetzen kann, um bestimmte Tagesordnungspunkte vor
zubereiten.242 Diese Regelung wurde getroffen, um der Tendenz bzw. dem Vorwurf ent
gegenzuwirken, dass sich die COSAC bei ihrer Arbeit nicht auf wenige wichtige Punkte
konzentriere. Zu den Vorbereitungen der Sitzungen ist in der Geschäftsordnung der CO
SAC weiterhin festgehalten, dass die nationalen Delegationen Unterlagen zu den Tages
ordnungspunkten dem Sekretariat des Gastgeberparlaments zuleiten können. Die vorsit
zende Delegation kann weiterhin Diskussionsunterlagen für die Konferenz ausarbei
ten.243 Mittlerweile ist es gängig, dass das Parlament, welches die COSAC ausrichtet,
vor dem Treffen Informationen sammelt, welche es dann verteilt. Meist sind dies Frage
bögen zu bestimmten auf der Tagesordnung stehenden Themen, die dann ausgewertet
werden.244
235 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 4.2.
236 Vgl. TORDORFF 2000, S. 2; Pflüger 2000, S. 242; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 16; CYGAN 2001, S. 38;
FUCHS 2004, S. 21.
237 Vgl. Conference of Speakers of National Parliaments: What is the Speakers Conference? [http://ww
w.eu-speakers.org/en/about/; Zugriff am 28.06.2006].
238 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 2.5.
239 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 7.
240 Vgl. CYGAN 2001, S. 39; Grunert 2004, S. 401; PÖHLE 1998, S. 84; TORDORFF 2000, S. 2; JANOWSKI
2005, S. 215; Bundesrat 2006c.
241 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 2.3.
242 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 2.6.
243 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 8.
244 Vgl. CYGAN 2001, S. 38; TORDORFF 2000, S. 2.
55
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Die Vorbereitung der Treffen liegt immer bei dem ausrichtenden Parlament, das vom
COSAC-Sekretariat unterstützt wird. Innerhalb weniger Monate muss dabei ein Parla
ment mindestens drei Treffen organisieren, nämlich das Treffen der Troika, das Treffen
der Ausschussvorsitzenden, das Plenum selbst sowie eventuell Treffen der Arbeitsgrup
pen.245
Die Kosten der einzelnen Sitzungen der COSAC fallen dem jeweiligen nationalen
Parlament zu, dass den Vorsitz innehat. Das EP hält zwar nie den Vorsitz, finanziert
aber die Dolmetscher auf den Sitzungen, was einen hohen Kostenanteil ausmacht.246
Zu den Abstimmungsregeln der COSAC wurde in der Geschäftsordnung verankert,
dass alle Änderungen der Geschäftsordnung einstimmig entschieden werden müssen.
Diese Regelung wurde erst auf der XXI. COSAC im Oktober 1999 in Helsinki geändert,
als man die Möglichkeit einer konstruktiven Enthaltung einführte, d.h. die Enthaltung
einer Delegation verhindert nicht mehr die Änderung der Geschäftsordnung.247
Weitere wichtige Entscheidungen zur Struktur der COSAC wurden auf der XXVIII.
Sitzung in Brüssel bzw. auf der XXIX. Sitzung 2003 in Athen getroffen. Es wurde eine
Reform durchgeführt, die sich an die zahlreichen Verhandlungen in der vorherigen dä
nischen Präsidentschaft anschloss. Dabei beschloss die COSAC umfangreiche Änderun
gen ihrer Geschäftsordnung, u.a., dass inhaltliche Beiträge mit qualifizierter Mehrheit
von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen angenommen werden können.
Zusätzlich müssen die drei Viertel der abgegebenen Stimmen gleichzeitig mindestens
der Hälfte aller Stimmen entsprechen. Dabei hat jede Delegation der nationalen Parla
mente zwei Stimmen. Falls es zwei parlamentarische Vertretungen für ein Land gibt,
wie für Deutschland, haben die Vertretungen der jeweiligen Kammern jeweils eine
Stimme. Änderungen der Geschäftsordnung müssen weiterhin einstimmig beschlossen
werden, dabei hat jede Delegation nur eine Stimme.248 Eine konstruktive Enthaltung ist
in diesem Fall möglich.249
Außerdem soll eine verbesserte Vernetzung über das Internet erfolgen sowie die Zu
sammenarbeit der Verwaltungen der nationalen Parlamente ausgebaut werden. Damals
wurde auch die Umbenennung der COSAC in „Forum der Parlamente“ diskutiert, aller
dings entschied man sich dagegen.250
Weiterhin beschloss die COSAC im Rahmen dieser Reform die Einrichtung eines ei
genen Sekretariats; seit Januar 2004 sitzt es permanent in Brüssel. Das Sekretariat orga
nisiert und bereitet alle Sitzungen im Rahmen der COSAC vor. Die Aufgaben sind rein
administrativ.251
245 Vgl. TORDORFF 2000, S. 4.
246 Vgl. PÖHLE 1998, S. 84.
247 Vgl. TORDORFF 2000, S. 2.
248 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 10 und 14.
249 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 14, Bundesrat 2006; Deutscher Bundestag / Ausschuss für die
Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a, S. 227 f.; GRUNERT 2004, S. 428.
250 Vgl. GRUNERT 2004, S. 428.
251 Vgl. Bundesrat 2006c; Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union 2003a, S. 229.
56
4.1 Organisation
4.1.3 Themen und Ergebnisse
Themen und Debatten
Ein grundsätzlich hervorstechendes Merkmal der Tagesordnungen der COSAC ist die
große Spannweite der Themen. Neben den aktuellen Themen der Präsidentschaft und
der Erweiterung wird eine große Anzahl weiterer Punkte diskutiert. Dies führt leider zu
Debatten, die oftmals nur aus einem Aufeinanderfolgen von Reden bestehen. Die Be
schränkung der Redezeit auf fünf Minuten und die Notwendigkeit der Übersetzung in
alle Amtssprachen der EU macht eine spontane Debatte kaum möglich. Im Laufe der
vergangenen Jahre wurden verschiedene Methoden der Vorbereitung der Tagungen ge
nutzt, um konzentriertere Debatten zu erreichen. Die im Voraus versandten Fragebögen
wurden aber leider in den Debatten zu oft ignoriert. Eine andere Möglichkeit zur Kon
zentration der Debatten war die Versendung von Diskussionspapieren. Generell ist fest
zustellen, dass eine effektivere Vorbereitung der Tagungen für effektivere Sitzungen
notwendig wäre. Aus dieser Überlegung heraus wurde die Festlegung getroffen, dass
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bestimmter Themen einberufen werden können.252
Themen der im Mai 2006 in Wien stattfindenden COSAC waren die Zukunft der
Union und die derzeitige „Denkpause“, der Verfassungsvertrag und dessen Ratifikation
in den Mitgliedstaaten, die Überwachung des Prinzips der Subsidiarität und der Verhält
nismäßigkeit durch die nationalen Parlamente, die Zusammenarbeit der nationalen Par
lamente mit der Kommission der EU, die Öffentlichkeit des Rates der EU, die Entwick
lung der Länder des Westbalkans und ihre Beziehungen zur EU sowie die Europäische
Nachbarschaftspolitik mit der Ukraine.253
Wichtige Ergebnisse
Es können hier nicht die gesamten Beiträge der COSAC erwähnt werden, deshalb wer
den in einem Ausschnitt die wichtigsten Leistungen dargestellt.
Bedeutend ist zunächst die oben beschriebene Leistung der COSAC von Dublin
1996, die dazu beitrug, dass die COSAC in den europäischen Verträgen verankert wur
de.
Im Rahmen der Ausarbeitung des Verfassungsvertrages wurde die COSAC vom
Konvent beauftragt, einen detaillierten Beitrag zur Rolle der nationalen Parlamente in
der EU zu leisten. Gleichzeitig überwachte die Konferenz die Arbeit des Konvents.
Auch, dass überhaupt ein Konvent mit Beteiligung der nationalen Parlamente zustande
kam, war zum Teil ein Verdienst der COSAC, da sich die COSAC in einem gemeinsa
men Standpunkt aller nationalen Parlamente einstimmig für einen Konvent aussprach.254
Viele der im Verfassungsvertrag festgehaltenen Einflussmöglichkeiten der nationalen
252 Vgl. TORDORFF 2000, S. 4.
253 Vgl. COSAC: Contribution adopted by the XXXV COSAC Vienna, 22–23 May 2006; TORDORFF
2000, S. 4.
254 Vgl. COSAC: Contribution from the XXIV COSAC in Stockholm to the European Council,
22.05.2001, S. 1; JANOWSKI 2005, S. 219. Auch das EP und die Kommission sprachen sich für diese
Lösung aus. In einer gemeinsamen Sitzung des EU-Ausschusses des Deutschen Bundestages und der
EU-Delegation der Französischen Nationalversammlung nahmen beide eine Entschließung an, in der
sie eine Konventslösung forderten. Den vielen Stimmen für einen Konvent konnten sich die nationa
len Regierungen schließlich nicht mehr entgegen stellen.
57
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Parlamente wurden im Voraus auf der COSAC diskutiert bzw. eingebracht, möglicher
weise stammen sie aus den Debatten der Parlamentarier.
Außerdem empfahl der Konvent der COSAC, Leitlinien für die Beziehungen zwi
schen Regierungen und Parlamenten zu erarbeiten, damit alle nationalen Parlamente die
Möglichkeit haben, ihre Regierungen zu überwachen und Einfluss auf die Europapolitik
der Regierungen zu nehmen. In Folge dessen entstanden die Kopenhagener Parlamenta
rischen Leitlinien255, die im Januar 2003 von der XXVIII. COSAC in Brüssel verab
schiedet wurden. Diese Leitlinien umfassen einen Verhaltenskodex für Minimalstan
dards zur effektiven nationalen parlamentarischen Kontrolle gegenüber den Regierun
gen, wonach eine schnellstmögliche und umfassende Information der nationalen Parla
mente durch die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten in Abstimmung mit den Gemein
schaftsorganen über alle EU-Vorhaben erfolgen sollte. Festgehalten wird außerdem die
Empfehlung, dass die Parlamente vor wichtigen Entscheidungen auf EU-Ebene, wie
Gipfeltreffen, Regierungskonferenzen oder Ratstagungen, rechtzeitig und umfassend
über die Haltungen ihrer Regierungen informiert werden.256 Man hebt besonders drei
Elemente der Beziehungen zwischen Regierung und Parlament hervor, die dazu beitra
gen sollen, dass die einzelstaatlichen Parlamente größeren Einfluss auf die Gemein
schaftspolitik erhalten. Diese Elemente seien:
a) der Umfang und die Qualität der Informationen des einzelstaatlichen Parlaments,
b) der Zeitplan des Informationsaustausches sowie
c) die Möglichkeit des einzelstaatlichen Parlaments, die eingegangen Informationen zu
nutzen, um Einfluss auf die Gemeinschaftspolitik zu erhalten.257
Weiterhin empfiehlt man Treffen mit Ministern in den einzelstaatlichen Parlamenten
frühzeitig vor Gemeinschaftstreffen, bei denen die Regierung ihren Standpunkt zu Ge
meinschaftsvorschlägen erläutert.258
Diese Leitlinien sind allerdings rechtlich nicht verbindlich; ihre Umsetzung ist aus
schließlich Sache der nationalen Rechtsordnungen.259 Die Leitlinien sind in der Ge
schäftsordnung der COSAC ausdrücklich erwähnt und ihr als Anhang beigelegt.260
Bemerkenswert ist der Hinweis in Punkt II.5. der Leitlinien, wo festgehalten wird,
dass es hinsichtlich der administrativen Unterstützung der einzelstaatlichen Parlamente
die Aufgabe jedes einzelnen Parlaments sei, dafür zu sorgen, dass es die administrative
und fachliche Unterstützung des Parlaments in EU-Angelegenheiten stärkt und diese
Unterstützung an die tatsächlichen Bedürfnisse des Parlaments anpasst, um somit best
möglich von den Leitlinien zu profitieren.261 Kurz gesagt, man hat erkannt und betont,
dass jedes einzelne Parlament besondere Aufmerksamkeit auf die eigene administrative
und fachliche Ausstattung legen muss. Die Parlamente sollten sich dessen noch bewuss
ter werden und eine stärkere Unterstützung in Anspruch nehmen.
255 Amtsblatt der Europäischen Union: Europäisches Parlament: verabschiedet auf der XXVIII. Konfe
renz der Gemeinschafts- und Europaauschüsse der Parlamente der Europäischen Union (COSAC).
„Kopenhagener Parlamentarische Leitlinien“. Leitlinien für die Beziehungen zwischen Regierungen
und Parlamenten bei Gemeinschaftsangelegenheiten (wünschenswerte Mindeststandards), Brüssel,
27. Januar 2003. Veröffentlicht am 2.7.2003 (2003/ C 154/01).
256 Amtsblatt der Europäischen Union (2003/ C 154/01), Punkt II.
257 Amtsblatt der Europäischen Union (2003/ C 154/01), Punkt I.
258 Amtsblatt der Europäischen Union (2003/ C 154/01), Punkt II.
259 Amtsblatt der Europäischen Union (2003/ C 154/01), Punkt III.
260 Vgl. Bundesrat 2006c; Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union 2003a, S. 120, 227; GRUNERT 2004, S. 428.
261 Amtsblatt der Europäischen Union (2003/ C 154/01), Punkt II.5.
58
4.1 Organisation
Eine weitere wichtige Aktivität der COSAC ist die Initiierung eines Probelaufes des
im Verfassungsvertrag festgelegten Frühwarnmechanismus.262 So wurde im Mai 2005
ein Bericht durch die COSAC vorgelegt, in welchem anhand des 3rd Railway Package
ein Durchlauf des Frühwarnsystem dokumentiert wurde. An diesem Pilotprojekt nah
men 31 der 37 parlamentarischen Kammern der EU teil. Als verbesserungswürdig wur
den die Erläuterungen und Begründungen zur Einhaltung der Subsidiarität und der Ver
hältnismäßigkeit durch die Kommission angesehen sowie die betonte Notwendigkeit
der Übersetzung der EU-Dokumente in alle Amtssprachen der EU. Außerdem wurde
festgestellt, dass die im Verfassungsvertrag vorgesehene Zeitspanne von sechs Wochen
zur Abgabe einer Stellungnahme recht kurz sei, vor allem, wenn möglichst viele Inter
essenvertreter angehört werden sollten.263 Des weiteren wurde angemerkt, dass es
schwierig gewesen sei, die Positionen der anderen nationalen Parlamente zu dem unter
suchten Gesetzesvorhaben zu erfahren. Deshalb sei zukünftig eine verbesserte zeitnahe
Kommunikation zwischen den Parlamenten untereinander notwendig.264 Ein zweiter
Testlauf ist für die zweite Jahreshälfte 2006 geplant.265
4.2 Die Rolle der COSAC als Demokratisierungsinstrument
4.2.1 Kompetenzen entsprechend der unionsrechtlichen Regelungen
Im Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente zum Amsterdamer und
Nizzaer Vertrag (folgend Protokoll) werden die COSAC und ihre Rolle in EU-Angele
genheiten anerkannt sowie die Notwendigkeit der interparlamentarischen Kooperation
hervorgehoben. Allein durch die Nennung in einem Vertragsprotokoll steigt der Grad
der Institutionalisierung dieses Gremiums.266
Die COSAC kann laut dem Protokoll jeden ihr zweckmäßig erscheinenden Beitrag über
Gesetzgebungstätigkeiten der EU an die Organe der EU, speziell an die Kommission,
den Rat und das EP, richten. Insbesondere bezieht sich dieses Recht auf die Themen der
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts sowie auf Fragen, die die Grundrechte betreffen.267 Damit konzentrieren sich die
Protokollvorschriften auf die Justiz- und Innenpolitik und den Grundrechtsschutz in die
sem Bereich. Bisher ist allerdings erkennbar, dass die Interessen der COSAC eher auf
institutionelle oder generelle europapolitische Themen, z.T. mit einem Blick auf die
Rolle der nationalen Parlamente in der EU, als auf politikfeldspezifische Themen der
dritten Säule gerichtet waren. Dies hängt auch damit zusammen, dass sich die Delega
tionen der COSAC meist aus Mitgliedern der Europaausschüsse zusammensetzen und
nicht aus Mitgliedern der Ausschüsse für Innenpolitik.268
262 Mehr zum Ablauf des Frühwarnmechanismus in Punkt 5.3.1 (S. 73) dieser Arbeit.
263 Vgl. COSAC: Report on the results of COSAC’s Pilot project on the 3rd Railway Package to test the
„Subsidiarity early warning mechanism“. Luxembourg 2005, S. 5, 7 f.; FRAGA 2005, S. 501.
264 Vgl. COSAC: Report on the results of COSAC’s Pilot project on the 3rd Railway Package to test the
„Subsidiarity early warning mechanism“. Luxembourg 2005, S. 9.
265 Vgl. COSAC: Contribution adopted by the XXXV COSAC Vienna, 22–23 May 2006. Punkt 3.7.
266 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 16; MAURER 2002, S. 362.
267 Protokoll über die Rolle einzelstaatlicher Parlamente (1997), Art. 5; Geschäftsordnung der COSAC,
Punkt 1.
268 Vgl. MAURER 2002, S. 363, 366; Bundesrat 2006c; PÖHLE 1998, S. 78 ff.; TORDORFF 2000, S. 3,
MAURER / WESSELS 2001, S. 63, 457, GRUNERT 2004, S. 402.
59
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Außerdem haben der Rat oder die Regierungen der Mitgliedstaaten die Möglichkeit,
die COSAC um Stellungnahmen zu Gesetzesvorlagen zu bitten. 269 Dies wurde aber bis
her noch nicht genutzt.
Die Spannweite der Beiträge der COSAC kann von konkreten Änderungsvorschlä
gen über einzelne Gesetzesvorlagen bis hin zu Essays zu bestimmten Themen reichen.
Nachdem ein Beitrag verabschiedet wurde, wird er im Amtsblatt der Europäischen Uni
on veröffentlicht.270 Die Prozedur der Annahme der Beiträge der COSAC wurde zwar
dadurch vereinfacht, dass laut der Geschäftsordnung der COSAC keine Einstimmigkeit
mehr vorliegen muss; in der Praxis versucht man jedoch immer noch fast ausnahmslos,
im Konsens zu entscheiden. Somit werden die Beiträge der COSAC noch immer sehr
stark diskutiert, was Zeit und Energie von anderen zu diskutierenden Themen ablenkt.
Außerdem scheinen die Texte der Beiträge zunächst recht fad, jedoch stellen sie einen
genau durchdachten, von der Präsidentschaft ausgehandelten Kompromiss dar, der sich
aus der Schwierigkeit ergibt, alle Sichtweisen der nationalen Parlamente einfließen zu
lassen und dabei noch immer etwas Substantielles zu sagen.271
Die Beiträge der COSAC haben keinerlei Bindungswirkung, weder für die einzel
staatlichen Parlamente, noch präjudizieren sie in irgendeiner Weise deren Standpunkt.272
Die COSAC kann demzufolge keine Beschlüsse fassen, sie hat keine Gesetzgebungs
kompetenz. Auch die Institutionen der EU, an die die Beiträge der COSAC gerichtet
sind, werden nicht gebunden.
Die jeweilige Berücksichtigung der COSAC-Beiträge ist unterschiedlich, doch zeich
net sich eine positive Tendenz ab. Beispielsweise wurde in der Schlussfolgerung der
COSAC in Wien im Mai 2006 festgehalten, dass die COSAC die Zusage der Kommissi
on vom 9. Mai 2006 begrüßt, den nationalen Parlamenten alle neuen legislativen Vor
schläge und Konsultationspapiere direkt zur Verfügung zu stellen und sie um Stellung
nahme zu bitten. Die COSAC wiederum bittet die Kommission, diese Stellungnahmen
in ihre Arbeit mit einzubeziehen, insbesondere, wenn es um die Grundsätze der Verhält
nismäßigkeit und Subsidiarität geht.273 Darauf reagierte nun der Europäische Rat vom
15. und 16. Juni 2006 in seinen Schlussfolgerungen und hielt fest, dass auch er die Zu
sage der Kommission begrüße, und er ersuchte ebenfalls die Kommission, die Stellung
nahmen der nationalen Parlamente, insbesondere zu den oben genannten Grundsätzen,
gebührend zu berücksichtigen. Gleichzeitig werden die nationalen Parlamente dazu auf
gefordert, verstärkt bei der Überwachung des Subsidiaritätsprinzips im Rahmen der
COSAC zusammenzuarbeiten.274
Neben dem Leisten von Beiträgen besteht für die COSAC die Möglichkeit, dass am
Ende jeder Sitzung der Vorsitzende des Gastgeberparlaments die Schlussfolgerungen
der Debatte vorlegt, welche von der Vorsitz-Troika ausgearbeitet worden sind. Dieses
269 Protokoll über die Rolle einzelstaatlicher Parlamente (1997), Art. 4.
270 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 10.
271 Vgl. TORDOFF 2000, S. 5; Bundesrat 2006c; PÖHLE 1998, S. 80.
272 Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente (1997), Abschnitt II, Ziffer 7, siehe auch
Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 1.
273 Vgl. COSAC: Contribution adopted by the XXXV COSAC. Vienna, 22–23 May 2006, Punkt 3.4;
Bundesrat: Bundesrat begrüßt stärkere Einbindung der nationalen Parlamente. Pressemitteilung vom
7.7.2006.
274 Vgl. Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes. (Ratsdok. 10633/06). 15./16. Juni 2006 in
Brüssel, Ziffer 37.; TORDORFF 2000, S. 3.
60
4.2 Die Rolle der COSAC als Demokratisierungsinstrument
sogenannte Kommuniqué wird den Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem EP, dem
Rat der EU und der Europäischen Kommission zugeleitet.275
4.2.2 Die Wahrnehmung der Kompetenzen in der Praxis
Die COSAC hat derzeit insbesondere die Aufgabe, ein Forum zum Erfahrungs- und
Meinungsaustausch sowie zur Meinungsbildung für die nationalen Parlamente der EUMitgliedstaaten zu sein. Sie wirkt sozusagen als institutionalisierte Gesprächsebene, als
Abstimmungsgremium und Netzwerk.276 Außerdem wird die COSAC als Forum für den
Austausch von best practice und benchmarking zwischen den nationalen Parlamenten
und dem EP genutzt.277 Auch wenn die Treffen vornehmlich auf informeller Ebene ab
laufen und obwohl die COSAC keinerlei formelle Beschlussfassungskompetenz hat, ist
sie als Forum für eine offene Diskussion sehr hilfreich. 278 Des weiteren ist die COSAC
derzeit das einzige Gremium, das in den europäischen Verträgen verankert ist und in
dem die nationalen Parlamente auf europäischer Ebene zusammenwirken.
Außerdem können bei den Sitzungen der COSAC vielfältige Kontakte mit Parlamen
tariern aus anderen Nationen, aber auch mit Ministern oder Kommissaren genutzt wer
den. Diese europäischen Kontakte könnten bei entsprechender Nutzung auch auf die na
tionalen Parlamente zurückwirken.279 Die Kontakte sowie der Meinungs- und Informati
onsaustausch nützen vor allem denjenigen nationalen Parlamenten, die gegenüber ihrer
Regierungen in EU-Angelegenheiten eher benachteiligt sind. Beispielsweise sei die
heutige Form der Überwachung von EU-Angelegenheiten in Frankreich ein Ergebnis
des Erfahrungsaustausches dieses Parlaments mit den britischen Kollegen auf der CO
SAC.280 Dieser positive Austausch nützt sicherlich auch einer Vielzahl weiterer Parla
mente, besonders der neuen Mitgliedstaaten.
Ein weiterer sehr wichtiger positiver Aspekt der COSAC ist, dass in diesem Forum
schon frühzeitig die Beitrittsländer einbezogen werden. Beispielsweise nehmen derzeit
schon Mazedonien und andere Länder des Balkan sowie die Türkei teil, oder es werden
auch Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik zu eben diesen Themen eingela
den, wie z.B. die Ukraine.
Die COSAC leistet zusätzlich einen Beitrag zur Verminderung des Demokratiedefi
zits in der EU. Zum einen wird den europäischen Institutionen, insbesondere dem Rat
der Kommission und auch dem EP, signalisiert, dass auch die nationalen Parlamente ein
Mitspracherecht in europäischen Angelegenheiten haben bzw. fordern. Durch die Teil
nahme des EP an der Sitzung soll gleichzeitig deutlich werden, dass die COSAC nicht
in Konkurrenz zum EP stehen soll, sondern dass beide konstruktiv zusammen wirken.
Weiterhin wichtig ist diese Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und
dem EP, zwei Institutionen, die sich lange als Konkurrenten wahrgenommen haben.
Beide haben das Ziel, den Rat der EU besser zu kontrollieren, die Gesetzgebung der EU
zu beeinflussen und die parlamentarische Mitbestimmung in der EU zu fördern. In die
275 Geschäftsordnung der COSAC, Punkt 11, 12, 13.
276 Interview mit Steffen Reiche, MdB, Berlin 19.06.2006; Interview mit Michael Roth, MdB,
20.06.2006.
277 COSAC: Concluding Minutes of the COSAC chairmen's meeting, 16. September 2002 in Copenha
gen. Punkt 1.
278 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 16.
279 Vgl. PÖHLE 1998, S. 86.
280 Vgl. WEBER-PANARIELLO 1995, S. 312.
61
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
sem Gremium können sie sich annähern und Wege finden, durch Informationsaustausch
effektiver zu arbeiten. Die Rolle der nationalen Parlamente und des EP wurde durch die
Zusammenarbeit in der COSAC erweitert und diese trug zu einer besseren Beziehung
beider bei.281
Man muss jedoch immer daran denken, dass in der COSAC noch nicht die Parlamen
te allgemein vertreten sind, sondern „nur“ die Europa-Gremien. Bei einer Ausweitung
der Rolle der COSAC müssen auch vermehrt die Fachausschüsse mit einbezogen wer
den.
4.2.3 Grenzen der Wirksamkeit
Die COSAC leidet unter einigen konzeptionellen Nachteilen. Davon kann man einen
Teil auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Parlamenten und ihren Europa-Gre
mien zurückzuführen. Es ist wahrscheinlich, dass einige dieser Nachteile den Aufstieg
der COSAC zu einer neuen Kammer verhindern. Dieses Ziel der Schaffung einer zu
sätzlichen parlamentarischen Kammer auf europäischer Ebene wird sowieso nur von ei
ner kleinen Minderheit befürwortet.
Zu den Nachteilen gehört, dass sich auf der COSAC verschiedene nationale Parla
mente mit unterschiedlichem Gewicht in EU-Angelegenheiten treffen, Abgeordnete aus
Europa-Gremien mit geringerem Einfluss spüren den höheren Rang anderer Europaaus
schüsse.282
Weiterhin problematisch für die COSAC ist, dass die Erwartungen und Vorstellun
gen der Mitgliedstaaten zur Rolle der COSAC recht unterschiedlich sind. Einige natio
nale Parlamente setzen sich für die Stärkung des Einflusses der COSAC zu Lasten der
nationalen Parlamente und für eine Institutionalisierung ein (darunter Frankreich). Auch
besonders die südlichen EU-Mitgliedstaaten befürworten die Stärkung der Rolle der
COSAC und die Formalisierung ihrer Entscheidungen. Einige Vorschläge in diese
Richtung wurden schon auf der Regierungskonferenz von Amsterdam geäußert, andere
in der Arbeitsgruppe des Europäischen Konvents über die Rolle der Nationalen Parla
mente.
Andere Parlamente sind eher zurückhaltend. Dazu gehört Deutschland, das sich deut
lich gegen eine weitere Institutionalisierung der COSAC bzw. eine Schaffung einer drit
ten Kammer einsetzt.283 Die Steigerung der Kompetenzen des EP und seine allmähliche
Gleichstellung mit dem Rat ist für diese nationalen Parlamenten ausreichend, um die
parlamentarische Demokratie in der EU zu stärken. Die Institutionalisierung der Zusam
menarbeit der Europa-Gremien der nationalen Parlamente sehen sie als mögliches
Hemmnis für die Weiterentwicklung des EP und stehen deshalb der COSAC nur zu
rückhaltend gegenüber. Viele Analytiker sehen in dieser Heterogenität der Vorstellun
gen eine entscheidende Ursache für die mäßige Leistungsbilanz der COSAC.284
Eine weitere bremsende Rolle spielt die Tatsache, dass das EP ebenfalls mit sechs
Delegierten an der COSAC teilnimmt. Dies wurde im Kompromiss der Konferenz der
Parlamentspräsidenten in Paris 1989 so festgelegt. Das EP hat keinen eigenen Euro
281 Vgl. CYGAN 2001, S. 39, 46.
282 Vgl. PÖHLE 1998, S. 81 f.; GRUNERT 2004, S. 402.
283 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin.
284 Vgl. TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 16; MAURER/ WESSELS2001, S.22; GRUNERT 2004, S. 404; PÖHLE
1998, S. 82.
62
4.2 Die Rolle der COSAC als Demokratisierungsinstrument
paausschuss, da es sich gänzlich mit Europa beschäftigt, ist aber dennoch gleichberech
tigt an der COSAC beteiligt. Außerdem ist das EP zwar an der COSAC-Troika beteiligt,
der Vorsitz der COSAC rotiert jedoch nur zwischen den nationalen Parlamenten. Somit
muss sich das EP in die Konferenz hineindrängen, was die Atmosphäre von Gleichbe
rechtigten belastet. Außerdem ist das EP natürlich misstrauisch gegenüber der COSAC,
da sie sich durchaus als Konkurrentin entwickeln könnte, da sie nun schon vertraglich
verankert und zu legislativen Beiträgen aufgerufen wurde. So spricht sich das EP gegen
die Schaffung einer neuen parlamentarischen Institution auf europäischer Ebene aus und
ist kritisch gegenüber der Stärkung der COSAC eingestellt. Man kann feststellen, dass
auch die meisten nationalen Parlamente zu diesen Aspekten eine ähnliche Meinung ver
treten und eher darauf fokussiert sind, ihre eigene Regierung effektiver zu kontrollieren
und ihre Rolle bei der Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu stärken.285
Die COSAC versammelt derzeit bei 25 Mitgliedstaaten 156 Mitglieder (je sechs Ver
treter plus 6 Vertreter des EP). Damit die COSAC allerdings eine wirksame Vertretung
der nationalen Parlamente sein kann, müssen die entsandten Delegierten repräsentativ
für die Parlamente und von ihnen legitimiert sein. Da derzeit pro Land nur sechs Dele
gierte bei der COSAC vertreten sind, das heißt in einem Land mit einem Zweikammer
system die Zahl der Sitze pro Kammer nochmals verringert wird, ist eine repräsentative
Vertretung der einzelnen Fraktionen der nationalen Parlamente nicht möglich. Kleinere
Fraktionen bleiben dadurch von der COSAC ausgeschlossen. Damit ist unklar, wie die
Beiträge der COSAC legitimiert sein können, wenn eine entsprechende Repräsentativi
tät nicht gegeben ist.286
Da schon auf der Konferenz eine Übereinstimmung in Sachfragen nur schwer zu er
reichen ist und bei allen Beiträgen grundsätzlich Konsens angestrebt wird, werden die
abschließenden Beiträge inhaltlich meist sehr allgemein gehalten und sind selten
schlagkräftig. Dadurch bieten sie auch keine deutliche Gegenposition zu Legislativakt
en anderer EU-Organe und bleiben meist ohne Wirkung. Vor allem dieser Fakt führt da
zu, dass die COSAC trotz ihrer stetig zunehmenden Wirkungsmöglichkeiten deutlich
hinter den Erwartungen zurück bleibt.287 Außerdem nehmen die langen Diskussionen um
die Formulierung der Beiträge neben den prozeduralen Fragen meist viel Zeit in An
spruch.
Gegen eine effektive Wahrnehmung der Kontrollkompetenzen der COSAC im Ge
setzgebungsprozess der Gemeinschaft oder sogar die Erweiterung ihrer Kompetenzen
zu einer gesetzgebenden Kammer spricht eindeutig ihr Sitzungsrhythmus. Da sich die
Parlamentarier nur halbjährlich für eineinhalb Tage treffen, können nur sehr wenige
Themen erörtert werden. Dadurch kann die alltägliche Arbeit der europäischen Institu
tionen oder die der nationalen Parlamente kaum beeinflusst werden. Derzeit bestehen
weder die materiellen Voraussetzungen noch die Bereitschaft der COSAC selbst, als ge
setzgebende Kammer tätig zu werden. Wenn der Sitzungsrhythmus erhöht würde, hät
ten die nationalen Parlamentarier Probleme, regelmäßig an der COSAC teilzunehmen
ohne ihre Verpflichtung als nationaler Abgeordneter zu vernachlässigen.288
Außerdem muss man an der Arbeit der COSAC kritisieren, dass sie sich nicht auf ih
re Kerngebiete der Subsidiaritätskontrolle, des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts und der Grundrechte konzentriert, sondern oftmals auch als Präsentationsfo
285 Vgl. NEUNREITHER 2005, S. 467 f.; PÖHLE 1998, S. 83, 87.
286 Vgl. MAURER / WESSELS 2001, S. 145, 457; PÖHLE 1998, S. 85.
287 Vgl. PÖHLE 1998, S. 82, GRUNERT 2004, S. 402.
288 Vgl. PÖHLE 1998, S. 81 ff.; MAURER / WESSELS 2001, S. 22, 458.
63
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
rum für Präsidentschaftsprogramme oder andere große europäische Themen genutzt
wird. Bei einer Konzentration auf die Kerngebiete könnte sie auch effektiver arbeiten.
4.2.4 Ansätze der zukünftigen Rolle
Zur Schaffung einer grundsätzlich effektiveren Arbeitsweise der COSAC sind einige or
ganisatorische und strukturelle Veränderungen notwendig. Beispielsweise müssten die
Plenarsitzungen besser vorbereitet werden (z.B. rechtzeitige Verteilung der Tagesord
nungen vor der Sitzung), um einen effektiveren Ablauf zu ermöglichen. Um die Konti
nuität der COSAC als Institution zu fördern, müsste u.a. die Sitzungsfrequenz erhöht
werden. Da eine Sitzung des Plenums sehr aufwendig ist, könnte man überlegen, ob es
sinnvoll wäre, dem Treffen der Vorsitzenden das Mandat zur Verabschiedung von Bei
trägen zeitweilig zu übergeben. Diese könnten sich dann häufiger treffen und damit eine
höhere Kontinuität der COSAC gewährleisten. Problematisch dabei wären allerdings
Fragen der Repräsentativität.
Außerdem sollten die Sitzungen längerfristig geplant werden, Termine lange im vor
aus feststehen. Eine bessere Vernetzung der nationalen Parlamente durch die neuen In
formations- und Kommunikationstechnologien sowie die Konzentration auf die Kernge
biete der COSAC würde außerdem zu einer Steigerung der Effektivität beitragen. Die
ser Vorschlag wurde auch schon im Beitrag der XXVIII. COSAC in Brüssel 2003 vor
gebracht, man konnte sich aber noch nicht auf eine Aufgabenübertragung in Verbin
dung mit dem Frühwarnmechanismus einigen.289 Man ist jedoch dabei verblieben, dass
die COSAC einmal jährlich die Kommission zu einer Vorstellung ihres Legislativpro
gramms einlädt.290
Über die künftige Rolle und zukünftige Entwicklung der COSAC gibt es ausgespro
chen viele Vorschläge, darunter zwei Hauptrichtungen (wie oben angedeutet). Die eine
wünscht sich eine formalere Rolle der COSAC in den Verträgen und in der institutio
nellen Architektur der EU, vielleicht sogar als weitere Kammer im Gesetzgebungspro
zess der EU (u.a. Frankreich, südliche Mitgliedstaaten). Die andere spricht sich eher da
für aus, dass die COSAC ein informelles Gremium bleibt, in dem sich die nationalen
Parlamentarier treffen und ihre Meinung darüber austauschen, wie die einzelnen natio
nalen Parlamente mit EU-Angelegenheiten umgehen (vor allem Deutschland, Öster
reich, House of Lords, EP).291
Das Hauptargument für die Formalisierung und Ausweitung der Rolle der COSAC
ist, dass die nationalen Parlamente eine essentielle Rolle bei der Legitimierung der EUAktivitäten spielen, insbesondere in der intergouvernementalen zweiten und dritten
Säule, wo das EP nur wenig Einfluss hat. Die Gegenargumente weisen jedoch darauf
hin, dass die vorrangige Bedeutung der nationalen Parlamente darin besteht, von den
nationalen Ministern Rechenschaft einzuholen. Viele der nationalen Kontrollmechanis
men sind nicht dafür ausgelegt, supranationale Vorgänge zu überwachen. Wenn die
Rolle der COSAC zunehmend formalisiert würde, müsste man außerdem die Repräsen
tation der nationalen Parlamente in der COSAC überdenken, da mit den derzeit sechs
289 Vgl. COSAC: Contribution from the XXVIII COSAC. Brussels, 27 January 2003, Punkt 6; Deut
scher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a, S. 304, S. 314.
290 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a,
S. 314.
291 Vgl. TORDORFF 2000, S. 6; Pflüger 2000, S. 243; Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegen
heiten der Europäischen Union 2003a, S. 56.
64
4.2 Die Rolle der COSAC als Demokratisierungsinstrument
Delegierten nicht die ganze Spannweite aller politischen Meinungen in politischen Par
teien in den nationalen Parlamenten widergespiegelt werden kann. Weiterhin müsste
man auch die Abstimmungsregeln überarbeiten; an die Gewichtung der Stimmen je
nach der repräsentierten Bevölkerungszahl ist zu denken. Weiterhin sollte man bezüg
lich der Garantie eines institutionellen Status der COSAC an die Erfahrung des Aus
schusses der Regionen oder des Wirtschafts- und Sozialausschusses denken. Obwohl
diese beiden Gremien fest im Institutionengefüge der EU verankert sind und auch schon
einige Berichte zu EU-Angelegenheiten angenommen haben, stimmt man darin überein,
dass ihr Einfluss eher gering ist. Demzufolge birgt die Institutionalisierung der COSAC
nicht die Garantie, dass ihre Arbeit danach effektiver wäre oder ernster genommen wür
de.292
Weiterhin muss man praktisch bezweifeln, dass die COSAC, ein Gremium aus natio
nalen Parlamentariern, sich regelmäßig genug treffen könnte, um effektiv zu arbeiten
(Problem des Doppelmandats).293
Die andere Entwicklungsmöglichkeit ist, die derzeitige informelle Rolle der COSAC
zu stärken und sie als Forum des Austausches von Informationen und Standpunkten
zum Umgang der nationalen Parlamente mit EU-Angelegenheiten zu nutzen. Sie wird
u.a. von Großbritannien, Deutschland, den skandinavischen Parlamenten vertreten.294
Die wahrscheinlichste Variante der zukünftigen Entwicklung ist, dass die COSAC
als gemeinsame Vertretung der nationalen Parlamente bestehen bleibt, aber nicht als ge
setzgebende Kammer ausgebaut wird, und die nationalen Parlamente bzw. ihre Kam
mern weiterhin auch einzeln handeln.295 Die COSAC bleibt jedoch Forum, Koordinator
und Netzwerk für die nationalen Parlamente.
Wahrscheinlich ist außerdem, dass die Rolle der COSAC bei der Subsidiaritätsprü
fung steigen wird, ein Testlauf wurde schon durchgeführt, ein zweiter ist geplant und
die COSAC wurde wie oben beschrieben sogar vom Europäischen Rat dazu aufgefor
dert.296
4.3 Die COSAC und der Deutsche Bundestag
Der Europaausschuss des Bundestages sendet regelmäßig maximal vier Vertreter zu den
Tagungen der COSAC, was bedeutet, dass nicht alle Fraktionen des Bundestages vertre
ten sein können. Dies bringt mit sich, dass die Delegation kein substanzielles Mandat
besitzt und auf der COSAC nicht für den Bundestag als Ganzes sprechen kann.297
Zur zukünftigen Rolle der COSAC äußerte sich der Europaausschuss des Bundesta
ges in Form eines Berichtes gegenüber der Bundesregierung (gemäß Art. 45 GG in Ver
bindung mit § 93 a Abs. 3 Satz 2 GO-BT) vor dem im Dezember 1996 in Dublin tagen
den Europäischen Rat, bei dem vor allem die Revision des Maastrichter Vertrages auf
der Tagesordnung stand. Er gab ein befürwortendes Votum zu den Schlussfolgerungen
der COSAC von Dublin im Oktober 1996 ab, mit dem Ziel der „Aufrechterhaltung des
Status der COSAC als einer flexiblen Form offenen Informations- und Meinungsaustau
292 Vgl. TORDORFF 2000, S. 6.
293 Vgl. TORDORFF 2000, S. 6.
294 Vgl. TORDORFF 2000, S. 7.
295 Vgl. PÖHLE 1998, S. 85.
296 Vgl. dazu auch ROTH 2005, S. 114.
297 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 15/5056. 09.03.2005, S. 7; CYGAN 2001, S. 154.
65
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
sches zwischen den Mitgliedern der nationalen Parlamente“298. Gleichzeitig wurde je
doch auch „die ablehnende Haltung des Deutschen Bundestages zu weitergehenden
Vorschlägen im Hinblick auf eine Institutionalisierung der COSAC“299 deutlich ge
macht. Der Bundestag „lehnt die Umgestaltung der COSAC zu einem Organ, das die
nationalen Parlamente formal vertritt und für bestimmte Bereiche als Beschlussorgan
gleichsam auf die Gemeinschaftsebene gehoben wird, ab“300.
Der Bundestag vertritt die Auffassung, dass die COSAC in ihrer jetzigen Form und
Bedeutung beibehalten werden sollte. Sie soll als Netzwerk auf europäischer Ebene be
stehen, ohne jedoch verbindliche Beschlüsse zu fassen. Die Haltung des Bundestages
zur COSAC bleibt auch weiterhin konsistent. EP und nationale Parlamente handeln als
Partner. Die COSAC ist wichtig, soll jedoch nicht weiter institutionalisiert werden, ganz
zu Schweigen von der Einrichtung einer zweiten bzw. dritten Kammer. 301 Gedankenaus
tausch ja, aber nicht mehr. Zu begründen ist dies damit, dass für die demokratische Le
gitimierung der europäischen Rechtssetzung in erster Linie das EP zuständig sei; die na
tionalen Parlamente sollten vorrangig ihre eigenen Regierungen im Rat kontrollieren.
So müsse der Bundestag rechtzeitig vor einer europäischen Entscheidung seine Mei
nung zu dieser bekunden und im Folgenden das Verhalten der Regierung bei den Ver
handlungen im Rat prüfen sowie Rechenschaft fordern.
Es wäre allerdings wünschenswert, dass sich die COSAC stärker auf Projekte kon
zentriert, die die nationalen Parlamente direkt betreffen. Man solle auch bereit sein, kri
tische Themen anzusprechen. Dagegen spricht jedoch noch, dass die Beiträge meist mit
Konsens beschlossen werden, was kontroverse Diskussionen oder Stellungnahmen
kaum zulässt. Die gezieltere Behandlung von aktuellen politischen Projekten, die Stei
gerung der Europatauglichkeit der nationalen Parlamente sowie eine stärkere Partner
schaft mit dem EP werden als aussichtsreiche Wege gesehen, die COSAC ohne eine
tiefgreifende Reform effektiver zu gestalten.302
Im ersten Halbjahr 2007, während der deutschen Ratspräsidentschaft, wird der Euro
paausschuss des Bundestages gemeinsam mit dem Ausschuss für Fragen der Europäi
schen Union des Bundesrates die XXXVII. COSAC ausrichten. 303 Das Sekretariat des
Europaausschusses ist im Bundestag Ansprechpartner der COSAC, d.h. dass das Aus
schusssekretariat die Ausrichtung des Treffens der COSAC-Troika, des Treffens der
Vorsitzenden der COSAC sowie die XXXVII. COSAC-Konferenz in Berlin organisie
ren wird.304
Für Matthias Wissmann, den derzeitigen Vorsitzenden des Europaausschusses des
Bundestages, ist es ein Ziel der Ratspräsidentschaft Deutschlands, eine tiefgreifende
Debatte zur Zukunft und zur Finalität Europas zu führen. Eine weitere Priorität stellt für
ihn die Wiederbelebung der Verfassungsdebatte nach der selbstverordneten Reflexions
298 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 2 f.
299 Vgl. Deutscher Bundestag/ Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 2;
MAURER / WESSELS2001, S. 123.
300 Vgl. Deutscher Bundestag/ Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union 1997, S. 3.
301 Interview mit Steffen Reiche, MdB, Berlin 19.05.2006.
302 Interview mit Michael Roth, MdB, Berlin 20.06.2006.
303 Vgl. Deutscher Bundestag: Ausschüsse. Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.
Aufgaben und Arbeit. Berlin 2006a. [http://www.bundestag.de/ausschuesse/a21/aufgaben.html; Zu
griff am 03.08.2006].
304 Vgl. Deutscher Bundestag: Ausschüsse. Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.
Aufgaben des Sekretariats und des Europabüros. Berlin 2006b. [http://www.bundestag.de/ausschues
se/a21/darstellung.html; Zugriff am 03.08.2006].
66
4.3 Die COSAC und der Deutsche Bundestag
phase dar. Außerdem vertritt er die Meinung, dass der Erfolg der Europäischen Integra
tion entscheidend davon abhängt, ob es gelingt, die Handlungsfähigkeit der EU-Institu
tionen zu stärken, und ob man die demokratische Legitimation der EU auf eine breitere
Basis stelle. Die Rolle der nationalen Parlamente sei dabei von besonderer Bedeutung.
Sie müssten stärker an der Willensbildung der EU beteiligt werden, vor allem um die
Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu wahren.305 Es ist zu vermu
ten, dass mindestens ein Teil dieser Themen auf der COSAC in Berlin angesprochen
wird.
5. Perspektiven der Mitwirkung nationaler Parlamente in EU-Angele
genheiten
5.1 Bewertung der derzeitigen Mitwirkung
In fast allen Mitgliedstaaten der EU wird die Entmachtung der nationalen Parlamente,
die mit der Europäisierung einhergeht, als Problem der Europäischen Integration wahr
genommen. Es wird ersichtlich, dass der Rat derzeit oftmals nur unzureichend demokra
tisch kontrolliert wird, woraus vornehmlich das Demokratiedefizit und das Legitimati
onsproblem der Rechtssetzung der EU erwächst, welches durch den Ausbau der Mehr
heitsentscheidungen im Rat noch verstärkt wird.306
Sowohl auf der Ebene der EU als auch auf mitgliedstaatlicher Ebene wurden gegen
die kontinuierliche Entparlamentarisierung der nationalen Verfassungsordnungen ver
schiedene Kompensationsmaßnahmen ergriffen. Doch weder die Einführung und ver
fassungsrechtliche Verankerung von innerstaatlichen Informations- und Mitwirkungs
rechten der nationalen Parlamente noch das Protokoll über die Rolle der einzelstaatli
chen Parlamente des Amsterdamer Vertrages haben zu einer entscheidenden Verbesse
rung beigetragen.
Die EU-Regelung über die Informationspflicht der Regierungen an die nationalen
Parlamente wird auf nationaler Ebene kaum beachtet, da dies in den nationalen verfas
sungsrechtlichen Bestimmungen geregelt wird. Auf diese Regelungen der Mitgliedstaa
ten konzentriert sich die nationale Diskussion. Es muss allerdings auch bemerkt werden,
dass der Informationszuwachs der nationalen Parlamente auf Kapazitätsprobleme stößt,
die diesen Zuwachs wieder zunichte machen können.307
Im Falle Deutschlands muss festgehalten werden, dass der Bundestag bisher zu sel
ten effektiven Gebrauch von seinen Rechten gemacht hat. Außerdem sind die Rechte
des Bundestages nicht ausreichend bzw. nicht geeignet, um die mit der Europäischen
Integration verbundenen Kompetenzeinbußen auch nur annähernd auszugleichen. Bei
spiele der unzureichenden Ausstattung mit Rechten ist die Beschränkung der Rechte des
305 Vgl. Deutscher Bundestag: Ausschüsse. Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.
Grußwort des Vorsitzenden. Berlin 2006c. [http://www.bundestag.de/ausschuesse/a21/grusswort.html;
Zugriff am 03.08.2006].
306 Vgl. PÖHLE 1993, S. 54; HUBER 2001, S. 7, 15; KABEL 1995, S. 245; KIETZ, S. 1; TOORNSTRA / ECPRD
2003, S. 10; MAURER 2004, S. 205.
307 Vgl. MAURER 2004, S. 206; JANOWSKI 2005, S. 52; HUBER 2001, S. 34 f.
67
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Bundestages auf Informationsrechte oder das schlichte Berücksichtigungsgebot des
Art. 23 Abs. 3 GG.308
Auch die Organisation und die Arbeitsweise des Europaausschusses sind bisher nicht
uneingeschränkt förderlich für eine effektive Mitbestimmung. Kritikpunkt ist zum
einen, dass er meistens nicht öffentlich tagt. Dies ist insbesondere dadurch bedenklich,
da er einen Beschluss des Plenums ersetzen kann. Außerdem verhindert dies die vom
Demokratieprinzip geforderte Transparenz und schränkt eine effektivere Kontrolle der
Bundesregierung durch die Öffentlichkeit ein. Zum anderen ist der Europaausschuss
übermäßig belastet und stößt an Kapazitätsgrenzen. Folglich ist eine Gewichtung der
EU-Vorlagen notwendig, um zu erreichen, dass der Ausschuss und damit die Mitwir
kung des Bundestages über eine bloße Kenntnisnahme der EU-Dokumente hinaus
geht.309
Im Bundesrat ist die Situation ähnlich. Verdeutlicht wird dies durch die Tatsache,
dass die Europakammer zwischen 1993 und 1999 nur dreimal getagt hat. Damit hat die
Europakammer nur dreimal die Möglichkeit genutzt, im Namen des Plenums Beschlüs
se abzugeben. Eine zentrale Ursache dafür ist, dass eine kontinuierliche und konsistente
Europapolitik für die Landesregierungen kaum einen Stellenwert hat.310
In den anderen Mitgliedstaaten der EU ist das Bild nicht wesentlich anders.
Man muss eingestehen, dass bisher eine effektive Kontrolle der Tätigkeiten der na
tionalen Regierungen im Rat durch die nationalen Parlamente meist nicht möglich ist.
Daneben gelten einerseits die Abhängigkeit der Parlamente von der Informationsüber
mittlung durch die Regierungen und andererseits eben die Überforderung der Parlamen
te durch eine Papierflut aus Brüssel als zu lösende Probleme.311
Auf europäischer Ebene wirken die nationalen Parlamente derzeit vor allem durch
interparlamentarische Kooperationen. Diese Vernetzung findet in zahlreichen Formen
statt, oft in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. Eine dieser Kooperatio
nen ist die COSAC, die Konferenz der Europa-Gremien der nationalen Parlamente der
EU-Mitgliedstaaten. Sie ist derzeit das einzige in den Europäischen Verträgen veranker
te Forum, in dem die Parlamente auf europäischer Ebene zusammenwirken. Es ist aller
dings festzuhalten, dass auch die COSAC trotz ihres weiten Zuständigkeitsbereiches zu
wenig Wirkung entfalten kann. Die halbjährliche Sitzungsfrequenz reicht nicht aus, um
einen kontinuierlichen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess zu ermöglichen.312
308 Vgl. HUBER 2001, S. 35 f.; Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Euro
päischen Union, Berlin 2001b, S. 3; ROTH 2005, S. 112; COSAC 2005b, S. 37.
309 Vgl. HUBER 2001, S. 36; COSAC 2005b, S. 37; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 49; JANOWSKI 2005,
S. 90; FUCHS 2004, S. 18.
310 Vgl. HUBER 2001, S. 36; Bundesrat 2006c.
311 Vgl. HÖLSCHEIDT 2000, S. 32 f.; FUCHS 2001, S. 234, 238; MAURER / WESSELS 2001, S. 123; KABEL 1995,
S. 242, 256; PFLÜGER 2000, S. 233; MAURER 2002, S. 237; JANOWSKI 2005, S. 92; FUCHS 2004, S. 7;
RANGE 2004, S. 4 ff.; CYGAN 2001, S. 117 f.; HUBER 2001, S. 18 f., 39.
312 Vgl. HUBER 2001, S. 35.
68
5.2 Perspektiven der Mitwirkung der nationalen Parlamente auf nationaler Ebene
5.2 Perspektiven der Mitwirkung der nationalen Parlamente auf nationaler
Ebene
5.2.1 Verbesserungspotentiale
In den Ausführungen dieser Arbeit wurde deutlich, dass die nationalen Parlamente und
ihre Europa-Gremien bisher nur wenig Einfluss auf die Europapolitik ihrer Regierungen
haben. Die Selbstbilder der Ausschüsse versprechen zwar oft viel, praktisch ergibt sich
aber oftmals noch ein ernüchterndes Bild. Die formalen Möglichkeiten werden ihrer ef
fektiven Umsetzung gleichgesetzt, was jedoch in der Praxis in der Regel nicht ge
schieht.313 Oftmals sind formal schon viele Rechte der Parlamente bzw. der Ausschüsse
vorhanden, es scheitert jedoch noch an der Umsetzung bzw. der Leistungsfähigkeit der
nationalen Parlamente. Zu häufig sind sie mit ihrer Rolle im Entscheidungsprozess der
EU deutlich überfordert.
Weiterhin ist bedenklich, dass die Forderung nach maximaler Mitbestimmung der
nationalen Parlamente in der Europapolitik nicht zu verwirklichen ist, wenn den Regie
rungsvertretern im Rat ein gewisser Verhandlungsspielraum offen bleiben soll. Außer
dem schwindet die Motivation der einzelnen Abgeordneten, sich mit Europaangelegen
heiten zu beschäftigen. Dies ist vor allem damit zu begründen, dass die Erfolgsaussicht
einer Stellungnahme des Ausschusses recht gering ist, und schon das Verfassen einer
Stellungnahme eine lange Beschäftigung einzelner Abgeordneter voraussetzt. Die Er
gebnisse der Bemühungen sind wenig kalkulierbar. Zusätzlich besteht ein deutliches
Missverhältnis von Aufgaben und Mitteln. Außerdem scheinen diese Aktivitäten für das
Ziel einer Wiederwahl nur einen geringen Gewinn zu versprechen.314
Besonders wichtig für die zukünftige Arbeit der Parlamente und ihrer Europa-Gremi
en ist, dass sie ihre Aufgabe in EU-Angelegenheiten als eine Kernkompetenz wahrneh
men. Vor allem in den südlichen Mitgliedstaaten sowie in den Benelux-Ländern ist dies
allerdings nicht zu beobachten.315
Derzeit ist zu beobachten, dass eine Dominanz der nationalen Regierungen in der
Europapolitik vorherrscht; legitimiert wird dies durch die indirekte Legitimation durch
das Parlament.316
Ein oftmals vorgebrachter Vorschlag zur Verbesserung der parlamentarischen Mitbe
stimmung in der EU ist, zu wichtigen europapolitischen Themen in allen nationalen
Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU gleichzeitig Sitzungen dazu durchzuführen, um
das europäische Bewusstsein zu stärken. Ein weiteres Instrument wäre die Abhaltung
regelmäßiger Plenardebatten zu wichtigen europäischen Themen oder die Einführung
einer regelmäßigen europapolitischen Fragestunde im Plenum, die von der Öffentlich
keit und auch von den Medien eher wahrgenommen wird.317 In einigen Parlamenten fin
den derartige Debatten, Fragestunden oder auch Europa-Tage schon statt. Dennoch wird
bisher selten davon Gebrauch gemacht.318
313 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 227.
314 Vgl. TÖLLER 2004, S. 41; JANOWSKI 2005, S. 229.
315 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 229.
316 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 230.
317 Vgl. PFLÜGER 2000, S. 244.
318 Vgl. dazu auch KIETZ 2005, S. 7.
69
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Man sollte insbesondere in Erwägung ziehen, ob zu Beginn und Ende jeder Ratsprä
sidentschaft Plenardebatten stattfinden sollten, bei denen die Öffentlichkeit über die
Vorhaben bzw. das Erreichte der jeweiligen Präsidentschaft unterrichtet wird.319
Weiterhin sollte grundsätzlich die Zusammenarbeit mit EU-Politikern vertieft wer
den. Mit am wichtigsten ist aber die Information der Parlamente und Parlamentarier
durch zugeleitete Informationen oder auch durch Selbstbefassung. Genauso bedeutsam
ist die Weitergabe dieser Informationen an die Bürger, um eine höhere Öffentlichkeit
und Transparenz des EU-Gesetzgebungsprozesses zu schaffen und die Bürgernähe zu
erhöhen, damit sich die Unionsbürger stärker mit der EU identifizieren können. Dazu
gehört auch, dass mehr Möglichkeiten der Partizipation für den Bürger geschaffen wer
den.320 Um ihre Mitwirkungsrechte effektiv zu nutzen, müssen sich die Parlamentarier
über die den Gang und die Wirkung europäischer Gesetzgebung sowie über ihre eige
nen Einflussmöglichkeiten bewusst werden.
Wichtig für das Funktionieren der parlamentsinternen Kontrollmechanismen wäre,
dass die Sitzungsfrequenz der Europa-Gremien der des Rates der EU angepasst würde,
um die kontrollrelevanten Dokumente effizient und zeitnah zu bearbeiten. Außerdem
sollten in den Parlamenten besondere Institutionen eingerichtet werden, die eine effizi
ente Verarbeitung der zugeleiteten Informationen ermöglichen.321
Sicherlich sind auch regelmäßigere Treffen der nationalen Mitglieder des EP und der
Europa-Gremien der nationalen Parlamente sinnvoll, wobei dafür die Sitzungspläne an
geglichen werden müssten.322
Eine weitere Möglichkeit der Verminderung des Demokratiedefizits in der EU wäre,
dass bei der Benennung des jeweiligen Kommissars in den nationalen Parlamenten eine
öffentliche Anhörung des von der Regierung vorgeschlagenen Politikers erfolgen müss
te. Ähnlich wird schon in einigen Mitgliedstaaten vorgegangen.323 Außerdem sollten alle
europäischen Parteien mit europaweiten Spitzenkandidaten bzw. Spitzenteams antreten.
Diese Maßnahmen würden dazu dienen, dass die Wähler im Voraus genau wissen, wer
als Kommissionspräsident bzw. als Kommissar antritt bzw. dann auch gewählt wird.324
Zusätzlich solle die Wahl zum EP EU-weit angelegt werden, um ihr damit einen ge
meinsamen supranationalen Charakter zu geben.325
5.2.2 Perspektiven der Mitwirkung des Bundestages in EU-Angelegenheiten
Neue Vereinbarung
Im Juni 2006 wurde eine neue Vereinbarung zwischen Bundestag und Bundesregierung
über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union ausgehandelt
(noch nicht in Kraft). Damit wird die Europatauglichkeit des Bundestages verbessert
und das gesetzgeberische Handeln der Bundesregierung im Rat stärker demokratisch le
gitimiert.326 Die Rechtsgrundlage dieser Vereinbarung wurde durch das Gesetz zur Rati
319 Vgl. PFLÜGER 2000, S. 244.
320 Vgl. KIETZ 2005, S. 8.
321 Vgl. MAURER 2002, S. 357.
322 Vgl. PFLÜGER 2000, S. 244.
323 Unter anderem in Polen (Sejm) und Tschechien (Abgeordnetenkammer).
324 Vgl. Frankfurter Rundschau/ Axel Schäfer 17.06.2006.
325 Vgl. Frankfurter Rundschau/ Axel Schäfer 17.06.2006.
326 Vgl. Bundestag: Deutscher Bundestag stärkt Europatauglichkeit. Pressemitteilung vom 22.06.2006;
SACH 2006, S. 1.
70
5.2 Perspektiven der Mitwirkung der nationalen Parlamente auf nationaler Ebene
fikation des Verfassungsvertrages vom 17. November 2005 geschaffen. Die Vereinba
rung wird unabhängig vom Inkrafttreten des Verfassungsvertrages gelten. 327 Die Be
schlussvorlage dieser neuen Vereinbarung wird nach der Sommerpause 2006 im Ple
num des Bundestages beraten und voraussichtlich Ende September verabschiedet. Ziel
der Vereinbarung ist es, den Bundestag in der Übermittlung von Informationen und der
Bindungswirkung der abgegebenen Stellungnahmen mit dem Bundesrat gleichzustellen.
Dazu gehört, dass dem Bundestag umfassendere, detailliertere Informationen, bessere
Berichte in Analyse und Auswertung zukommen sollen, um seine Position bei der euro
päischen Mitbestimmung zu stärken.328
Durch die Vereinbarung werden die Informationsrechte des Bundestages erheblich
erweitert. Sowohl Dokumente und Berichte der Organe der EU als auch der Bundesre
gierung zu aktuellen europäischen Aktivitäten sollen in umfassender Weise übermittelt
werden. In den Bereichen, in denen der Bund originär zuständig ist (z.B. Außen-, Si
cherheits-, Verteidigungs- und Handelspolitik) wird der Bundestag weitreichender un
terrichtet als der Bundesrat.
Weiterhin werden die bisherigen Mitwirkungsrechte des Bundestages erweitert, d.h.
die gemäß Art. 23 GG durch den Bundestag abgegebenen Stellungnahmen werden für
die Regierung verbindliche Grundlagen für die Verhandlungen im Rat. Nur aus be
stimmten Gründen darf die Regierung von der Stellungnahme des Bundestages abwei
chen und sie muss dies ihm gegenüber begründen.
Außerdem muss der Bundestag zukünftig bei Entscheidungen von grundlegender Be
deutung stärker beteiligt werden. Dazu gehört der Übergang zu Mehrheitsentscheidun
gen. Die Bundesregierung muss sich weiterhin vor der Eröffnung von Vertragsände
rungsverfahren oder Beitritten um ein Einvernehmen mit dem Bundestag bemühen.329
Insgesamt würde das Inkrafttreten dieser Vereinbarung eine erhebliche Verbesserung
der Information sowie der Mitwirkung des Bundestages in Angelegenheiten der EU mit
sich bringen.
Zur weiteren Verbesserung der Europatauglichkeit des Bundestages ist derzeit die
Einrichtung eines Verbindungsbüros des Bundestages in Brüssel in Planung330, und in
nerhalb der Verwaltung des Deutschen Bundestages wurde ein neues Referat „Europa“
geschaffen.331 Diese Entwicklung zeigt, dass das Problem der zu geringen Mitwirkung
der nationalen Parlamente, oftmals verursacht durch das Problem der minderen Infor
mationsübermittlung, erkannt wurde und man intensiv daran arbeitet, diese Situation zu
verbessern.
327 Bundesgesetzblatt: Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des
Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 17. November 2005, Art. 2 Abs. 1 Nr.
2. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 71, ausgegeben zu Bonn am 25. November 2005,
S. 3178.
328 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin; SACH 2006, S. 1.
329 Beschlussvorlage: Vereinbarung zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung über
die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union. 16. Wahlperiode. Stand 22. Juni
2006; Bundestag: Deutscher Bundestag stärkt Europatauglichkeit. Pressemitteilung vom 22.06.2006.;
SACH 2006, S. 1.
330 Mehr dazu Punkt 3.3.4 dieser Arbeit (S. 47).
331 Vgl. SACH 2006, S. 2.
71
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Weitere Potentiale zur Stärkung der Mitwirkung
Besonders wichtig für die Mitbestimmung der nationalen Parlamente, beispielsweise
des Deutschen Bundestages, ist es, dass die praktische Umsetzung der formalen institu
tionellen Möglichkeiten ausgebaut wird. Außerdem muss die Schwerfälligkeit der förm
lichen Verfahren beseitigt werden. Derzeit liegen die Ursachen für diese Schwerfällig
keit in den Problemen bei der Verarbeitung der großen Mengen an Informationen sowie
bei der Notwendigkeit der Angleichung parlamentsinterner und europäischer Verfah
rensabläufe. Es muss gewährleistet werden, dass eine Vorlage im Bundestag abschlie
ßend beraten worden ist, bevor in Brüssel entschieden wird. Dabei muss sichergestellt
sein, dass die Beratungen im Parlament auf Basis des aktuellen Entwurfs durchgeführt
werden.332
Die parlamentarische Praxis in anderen Mitgliedstaaten der EU wie z.B. den balti
schen Staaten, Finnland oder Großbritannien macht deutlich, dass eine effizientere
Wahrnehmung der Rolle der nationalen Parlamente als Kontroll- und Legislativorgane
möglich ist. Auch die Rechte der Parlamente in Dänemark oder Österreich sind stark
ausgebildet; jedes Modell birgt jedoch auch seine Schwierigkeiten. Der Bundestag ist
zwar grundsätzlich nicht schlecht mit Kompetenzen ausgestattet, arbeitet aber unter sei
nen Möglichkeiten.333 Eine weitere Sensibilisierung und Bewusstseinsschaffung für eu
ropäische Angelegenheiten ist dringend erforderlich.334
Durch den aktuellen Prozess der Ratifizierung des Verfassungsvertrages werden in
vielen Parlamenten Reformen geplant bzw. durchgeführt, zum einen zur Umsetzung der
aus der Verfassung gewonnen Rechte und Pflichten (z.B. Frühwarnsystem335) und zum
anderen im Rahmen der Überprüfung der bestehenden Praktiken parlamentarischer Be
gleitung der nationalen EU-Politik. Gerade die Parlamente der neuen Mitgliedstaaten
haben zumindest formal sehr effiziente Mechanismen zur parlamentarischen Begleitung
der EU-Politik eingeführt.336
So betonte Michael Roth, MdB, auf der gemeinsamen Sitzung des EU-Ausschusses
mit der Délégation pour l’Union européenne der Französischen Nationalversammlung
am 9. März 2005 zu der durch die Bestimmungen im Verfassungsvertrag wachsenden
Rolle der nationalen Parlamente, dass aus der Kontrollaufgabe über die Subsidiarität
und aus der Klagemöglichkeit vor dem EuGH dem Bundestag wichtige Aufgaben er
wüchsen. Dadurch sei der Bundestag in der Pflicht, seine bereits vorhandenen Rechte
effizienter zu nutzen und die Bundesregierung umfassender und offensiver zu kontrol
lieren, wobei dafür bestehende Gesetze nicht unbedingt geändert werden müssten.337 Der
Bundestag und insbesondere der Europaausschuss müsse für seine neuen Aufgaben die
vorhandenen Möglichkeiten besser nutzen.338
332 Vgl. TÖLLER 2004, S. 48 f.
333 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin; KIETZ 2005, S. 1.
334 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin.
335 Genauer dazu Punkt 5.3.1 (S. 73) dieser Arbeit.
336 Vgl. KIETZ 2005, S. 2.
337 Vgl. Deutscher Bundestag: Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für die Angelegen
heiten der Europäischen Union (20. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf […] Entwurf eines Gesetzes
über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegen
heiten der Europäischen Union. […] 15. Wahlperiode. Drucksache 15/5492, Berlin 11.05.2005,
S. 16.
338 Aussage der Sitzung am 13. April 2005; Deutscher Bundestag Drucksache 15/5492, 2005, S. 19.
72
5.2 Perspektiven der Mitwirkung der nationalen Parlamente auf nationaler Ebene
Roth stellt fest, dass die Europatauglichkeit des Bundestages generell verbesserungs
würdig sei und dass der Bundestag die ihm eingeräumten verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Möglichkeiten besser nutzen müsse. Dabei müsse vor allem auch das Bun
destagsplenum einbezogen und das Interesse der Abgeordneten, die nicht im Euro
paausschuss sitzen, für Europa geweckt werden. Außerdem müsse man die Regierung
im Rat besser kontrollieren. Weiterhin sei dringend eine bessere personelle Ausstattung
des Bundestages notwendig, um mit der Regierung auf gleichem Niveau mitzuhalten.339
Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung der Mitwirkungsrechte des Bundestages wäre
die Übertragung von Art. 23 VI GG auf den Bundestag, d.h. dass man die Mitwirkung
an der Rechtssetzung auf europäischer Ebene dem Bundestag übergäbe, wenn aus
schließlich seine Zuständigkeiten betroffen sind. Demzufolge könnte in den Fällen,
wenn das deutsche Verfassungsrecht einen Parlamentsvorbehalt feststellen würde, die
Wahrnehmung der Rechte Deutschlands von der Bundesregierung auf den Bundestag
(seinen Präsidenten oder den Vorsitzenden des EU-Ausschusses) übertragen werden.340
Außerdem wäre zur Stärkung des Demokratieprinzips und der Transparenz eine Fest
legung wünschenswert, die festschreibt, dass die Sitzungen des EU-Ausschusses grund
sätzlich öffentlich sind. Somit könnte das demokratische Legitimationsniveau erhöht
werden. Zwar tagt der Ausschuss hin und wieder öffentlich, grundsätzlich sind die Be
ratungen jedoch nicht öffentlich.341
Die Einflussmöglichkeiten des Bundestages könnten zusätzlich dadurch gestärkt
werden, dass die Bundesregierung dazu verpflichtet wird, auf Verlangen des Bundesta
ges gegen einen Rechtssetzungsakt der EU und ihrer Gemeinschaften Klage vor dem
EuGH zu erheben, auch wenn der Verfassungsvertrag nicht in Kraft treten sollte. Da
durch könnten das Subsidiaritätsprinzips sowie auch die Grundrechte der Bürger besser
geschützt werden.342
5.3 Perspektiven der Mitbestimmung der nationalen Parlamente auf euro
päischer Ebene
5.3.1 Neue Rechte der nationalen Parlamente im Vertrag über eine Verfassung für
Europa
Bestimmungen im Verfassungsvertrag343
Im Rahmen des Verfassungsvertrages werden den Mitgliedstaaten mehr Möglichkeiten
zur Mitwirkung eingeräumt. Bezüglich der Mitwirkung bei der Primärrechtsetzung
durch die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten der EU ist im Vertrag über eine
Verfassung für Europa (folgend Verfassungsvertrag) vorgesehen, dass zukünftige Re
gierungskonferenzen durch einen Konvent vorbereitet werden. Zu diesem Konvent ge
hören Vertreter der nationalen Parlamente und Regierungen sowie Vertreter des EP und
339 Interview mit Michael Roth, MdB, am 20.06.2006 in Berlin.
340 Vgl. HUBER 2001, S. 49 f.
341 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Berlin
2002b. S. 11; HÖLSCHEIDT 2000, S. 34; HUBER 2001, S. 50.
342 Vgl. HUBER 2001, S. 51.
343 In dieser Arbeit als Verfassungsvertrag bezeichnet wird der „Vertrag über eine Verfassung für Euro
pa“ wie er am 28.10.2004 von den Staats- und Regierungschefs der EU verabschiedet wurde. Veröf
fentlicht im Amtsblatt Nr. C 310 vom 16/12/2004 S. 0001– 0474.
73
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
der Europäischen Kommission. Dieser Konvent arbeitet Vorschläge für Vertragsände
rungen aus. Diese Vorschläge dienen später als Grundlage der Verhandlungen der Re
gierungskonferenz. Durch dieses Verfahren besteht, falls der Verfassungsvertrag in
Kraft tritt, die Möglichkeit für die nationalen Parlamente, sich schon zu einem frühen
Zeitpunkt an den Verhandlungen zu beteiligen und Einfluss zu nehmen.344
Im Verfassungsvertrag werden die Mitwirkungsrechte der einzelstaatlichen Parla
mente zum größten Teil in dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente und
dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhält
nismäßigkeit festgehalten.345
Darin wird die Rolle der Parlamente, insbesondere als Hüter des Subsidiaritätsprin
zips gestärkt.346 Dies erfolgt erstens durch eine verbesserte und frühere Unterrichtung
der nationalen Parlamente, zweitens durch die Möglichkeit der Stellungnahme zur
Übereinstimmung eines Gesetzgebungsvorschlages mit dem Subsidiaritätsprinzip sowie
drittens durch das Klagerecht vor dem EuGH bei vermuteter Verletzung des Subsidiari
tätsprinzips.347
Gemäß dem Verfassungsvertrag wird die frühzeitige Unterrichtung der nationalen
Parlamente dadurch ermöglicht, dass ihnen sämtliche Dokumente direkt durch die Kom
mission bzw. die anderen EU-Institutionen zugeleitet werden. Neben den Konsultati
onsdokumenten übersendet die Kommission außerdem das jährliche Rechtssetzungspro
gramm, die Tagesordnungen des Rates sowie dessen Sitzungsprotokolle, in denen sich
der Rat mit Gesetzgebungsvorschlägen befasst, an die nationalen Parlamente. Diese um
fangreiche und zeitnahe Unterrichtung durch die europäischen Institutionen erleichtert
den nationalen Parlamenten deutlich die Überprüfung der Einhaltung des Subsidiaritäts
prinzips sowie gleichzeitig auch die Kontrolle ihrer jeweiligen Regierungen. Sie können
frühzeitig agieren und erhalten alle EU-Dokumente ohne Selektion durch die Kommis
sion, inklusive einer Beurteilung zur Einhaltung der Prinzipien der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit bei legislativen EU-Vorlagen. Dadurch wird der EU-Gesetzge
bungsprozess für die nationalen Parlamente erheblich transparenter.348
Eine weitere deutliche Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten der nationalen
Parlamente am Rechtssetzungsprozess der EU ermöglicht die in Art. I-11 Verfassungs
vertrag i. V. m. dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität
und der Verhältnismäßigkeit vorgesehene Möglichkeit der Stellungnahme zur Überein
stimmung eines Gesetzgebungsvorschlages mit dem Subsidiaritätsprinzips, der soge
nannte Frühwarnmechanismus oder das Frühwarnsystem.349 So werden die nationalen
344 Vgl. RANGE 2004, S. 4; PFLÜGER 2000, S. 244.
345 1. Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union, 2. Protokoll über
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, Anhang zum Vertrag
über eine Verfassung für Europa, von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet am 29.10.2004.
Veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 16.12.2004, C310/204–209.
346 Vgl. Deutscher Bundestag, Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union / Assemblée
Nationale, Délégation pour l'Union Europeénne 2003, S. 2; RANGE 2004, S. 7; KIETZ 2005, S. 2.
347 Vgl. RANGE 2004, S. 7; COSAC 2005b, S. 76; GRUNERT 2004, S. 423.
348 Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der EU (2004), Titel 1; KIETZ 2005, S. 2;
RANGE 2004, S. 9; COSAC 2004a, S. 7; JANOWSKI 2005, S. 43.
349 Amtsblatt der Europäischen Union: 2. Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiari
tät und der Verhältnismäßigkeit. 16.12.2004. Amtsblatt der Europäischen Union C 310/207–209.
(Anhang zum Vertrag über eine Verfassung für Europa, von den Staats- und Regierungschefs unter
zeichnet am 29.10.2004).
74
5.3 Perspektiven der Mitbestimmung der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
Parlamente schon zu Beginn des Rechtssetzungsprozesses einbezogen. Dadurch er
wächst die Chance, auch im weiteren Prozess mehr Verantwortung zu übernehmen.350
Die von der Kommission oder den anderen EU-Institutionen direkt an die Parlamente
übermittelten Gesetzesvorlagen müssen einen Vermerk mit detaillierten Angaben ent
halten, der ermöglichen soll, zu beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden. Anschließend können die nationalen Parla
mente eine Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf verfassen, wenn sie die Prinzipien
gefährdet sehen. Diese Stellungnahme eines nationalen Parlaments ist an die Präsiden
ten des EP, des Rates und der EU-Kommission zu richten und muss darlegen, warum
ein Gesetzgebungsvorschlag ihrer Meinung nach nicht mit dem Subsidiaritätsprinzips
vereinbar ist. In Deutschland haben dann Bundestag und Bundesrat die Möglichkeit zur
Abgabe einer Stellungnahme. Wenn zu einem Gesetzgebungsvorschlag mindestens ein
Drittel der stimmberechtigten nationalen Parlamente begründete Stellungnahmen abge
ben, muss die Kommission ihren Vorschlag überprüfen. Die Kommission kann an
schließend ihren Vorschlag ändern, ihn zurückziehen oder aber auch an ihm festhalten.
Ihre Entscheidung muss die Kommission begründen.351
350 Vgl. KIETZ 2005, S. 2; RANGE 2004, S. 10; COSAC 2005b, S. 78; JANOWSKI 2005, S. 43; Deutscher
Bundestag, Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union / Assemblée Nationale,
Délégation pour l’Union Européenne 2003, S. 2.; TOORNSTRA / ECPRD 2003, S. 8; GRUNERT 2004,
S. 423.
351 Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (2004);
KIETZ 2005, S. 2; RANGE 2004, S. 10 f.; COSAC 2005b, S. 78; COSAC 2004a, S. 6; JANOWSKI 2005, S.
43; GRUNERT 2004, S. 423.
75
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Abbildung 4: Ablauf des Frühwarnmechanismus352
Die nationalen Parlamente haben dann die Möglichkeit, Klage vor dem EuGH wegen
eines vermuteten Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzips zu erheben. Das Recht zur
Klage besteht in jedem Fall, also auch, wenn die nationalen Parlamente im Rahmen des
Frühwarnsystems keine Bedenken geäußert hatten. Außerdem können sie auch gegen
bereits geltende Richtlinien, Verordnungen etc. klagen, falls sie einen Verstoß gegen
das Subsidiaritätsprinzips vermuten.353
352 Entnommen aus RANGE 2004, S. 8.
353 Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (2004);
KIETZ 2005, S. 2; RANGE 2004, S. 11, COSAC 2004a, S.6; JANOWSKI 2005, S. 43; SATTLER 2006.
76
5.3 Perspektiven der Mitbestimmung der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
Man muss jedoch darauf hinweisen, dass diese Klage, je nach der innerstaatlichen
Rechtsordnung, von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder
von einer Kammer dieses Parlaments erhoben werden kann. Im Falle des Bundestages
hieße das, dass er nicht selbst Klage einreichen kann, sondern von der Bundesregierung
vertreten wird.354
Durch diese neuen Regelungen werden die nationalen Parlamente erstmals direkt in
die Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene einbezogen. In Abbildung 4 wird das
Frühwarnsystem vereinfacht dargestellt.
Im Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente zum Verfassungsvertrag wird
weiterhin zu einer Stärkung der interparlamentarischen Kooperation zwischen den na
tionalen Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU und dem EP aufgerufen.355
Eine weitere die Parlamente betreffende Neuerung ist, dass der Rat in Zukunft öf
fentlich tagt , wenn er gesetzgeberisch tätig wird. Dadurch wird eine Kontrolle der Re
gierungen im Rat durch die nationalen Parlamente deutlich erleichtert.356
Durch den Verfassungsvertrag wird die demokratische Legitimation der Union deut
lich gestärkt, da nun die nationalen Parlamente deutlicher in den Entscheidungsprozess
auf EU-Ebene einbezogen werden. Die nationalen Parlamente werden zum neuen
Wächter der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, wodurch ihre Rolle auf europäischer
Ebene aufgewertet wird und sie erstmals die Möglichkeit einer direkten Einflussnahme
auf die europäische Gesetzgebung erhalten. Somit erhalten die nationalen Parlamente
die Möglichkeit, einem weiteren Kompetenzverlust entgegenzuwirken. Außerdem wird
die Kontrolle der Regierungen im Rat durch die erhöhte Öffentlichkeit der Sitzungen
und die direkte Zusendung der Sitzungsprotokolle durch die Kommission erleichtert.357
Inwieweit die nationalen Parlamente diese neuen Rechte umsetzen werden, wird sich
zukünftig zeigen, falls der Vertrag bzw. ähnliche Bestimmungen in Kraft treten werden.
Denn dies würde voraussetzen, dass die nationalen Parlamente die ihnen überwiesenen
EU-Vorlagen kontinuierlich behandeln. Dazu müssten die notwendigen Voraussetzun
gen an Ressourcen und Kompetenz geschaffen werden, um die Fülle an EU-Dokumen
ten zeitnah und effektiv zu verarbeiten. Zu beobachten ist weiterhin, ob sich zukünftig
die Beziehung zwischen dem EP und den nationalen Parlamenten ändert, da das EP nun
die nationalen Parlamente als möglichen Konkurrenten oder als dritte Kammer im Ge
setzgebungsprozess wahrnehmen könnte.358
Konsequenzen für die nationalen Parlamente
Durch die in dem Verfassungsvertrag neu geschaffenen Mechanismen werden organisa
torische Anpassungen der nationalen Parlamente, so auch des Bundestages, notwendig.
Die Parlamente müssen sich somit auf die frühzeitige Unterrichtung durch die EU-Insti
tutionen einstellen. Man sollte ein Verfahren der Selektion und neue Kapazitäten schaf
fen, da die Parlamente eine Vielzahl von Dokumenten empfangen und sonst nicht in der
Lage sein werden, ihre neuen Kompetenzen umfassend zu nutzen. Die bisher schon
festgeschriebenen Unterrichtungspflichten der Regierungen sollten insofern geändert
werden, dass der die Parlamente nicht doppelt unterrichtet werden. In diesem Bereich
354 Vgl. RANGE 2004, S. 11; JANOWSKI 2005, S. 44.
355 Zur Rolle der COSAC laut Verfassungsvertrag siehe Punkt 5.3.3 (S. 80).
356 Siehe Deutscher Bundestag Drucksache 15/5492, 11.05.2005, S. 17.
357 Vgl. RANGE 2004, S. 13 f.; JANOWSKI 2005, S. 44.
358 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 231 f.
77
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
der Selektion sollten zukünftig verstärkt Personal und Technik eingesetzt werden, um
der Informationsflut Herr zu werden. Heute wird die Selektion im Bundestag fast aus
schließlich Parlamentsmitarbeitern, d.h. Mitarbeitern der Ausschusssekretariate, über
lassen. Grundsätzlich ist dies nicht kritikwürdig, allerdings ist es problematisch, dass
diese oft keine Spezialisten sindund oft auf sich allein gestellt arbeiten.359
Weiterhin sollte eine verstärkte Abstimmung zwischen allen nationalen Parlamenten
und dem EP stattfinden. Eine Möglichkeit wäre, dass diese Abstimmung im Rahmen
der COSAC verläuft. Diese erhöhte Koordination ist wichtig, da beim Frühwarnmecha
nismus mindestens ein Drittel der Parlamente eine negative Stellungnahme abgeben
muss, um die Kommission zur Überprüfung ihres Vorschlages zu bewegen. Regelmäßi
ge gemeinsame Sitzungen der Fachausschüsse der nationalen Parlamente und des EP
könnten bedeutend zu einer besseren Kommunikation beitragen.360
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Demokratiedefizit der EU durch die Er
weiterung der Rolle der nationalen Parlamente im Verfassungsvertrag gesenkt wird. Al
lerdings heißt das für die nationalen Parlamente auch, dass ihnen in Zukunft für die de
mokratische Legitimation europäischer Politik mehr Verantwortung übertragen wird
und auf sie damit auch ein erheblich größerer Arbeitsaufwand in EU-Angelegenheiten
zukommt. Darauf müssen sich die Parlamente dringend einstellen und entsprechende
Maßnahmen ergreifen, um ihrer neuen Rolle gerecht werden zu können. Die Parlamente
sollten sich früher, umfassender und regelmäßig mit europapolitischen Initiativen befas
sen, ihre Präsenz in Brüssel stärken und sich zu allererst bewusst werden, dass sie ein
Teil des europäischen Gesetzgebungsprozesses sind. Die deutliche Steigerung der Ein
flussmöglichkeiten der nationalen Parlamente im europäischen Entscheidungsprozess
durch den Verfassungsvertrag sollte für die Volksvertretungen Anlass sein, verstärkt für
den Verfassungsvertrag zu werben.
5.3.2 Weitere Vorschläge zur Erweiterung der parlamentarischen Mitbestimmung
Neben der im Verfassungsvertrag vorgeschlagenen Methode des Konvents zur Ver
tragsänderung, bei dem die nationalen Parlamente inhaltlich Einfluss nehmen können361,
wäre es noch besser, wenn die nationalen Parlamente stärker in die Vertragsänderung
nach Art. 48 EUV einbezogen würden, z.B. durch die Vorlage von Vorschlägen über ei
ne Vertragsänderung an die nationalen Parlamente zur Anhörung vor der Regierungs
konferenz sowie eine weitere Beteiligung der Parlamente durch den Europäischen Rat
vor Abschluss der Regierungskonferenz. Dadurch könnte die Transparenz des Verfah
rens erhöht, ein breiterer Konsens ermöglicht und die Exekutivlastigkeit dieses Verfah
rens gesenkt werden.362
Bedeutender ist die Einbindung der nationalen Parlamente in die Rechtssetzung des
Sekundärrechts. Die dabei notwendige institutionalisierte Kooperation zwischen EP und
den nationalen Parlamenten ist derzeit schon in Art. 249 Abs. 3 EGV sowie in dem Pro
tokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente der EU angelegt. Allerdings kann
nur eine direkte Einbeziehung der nationalen Parlamente in das sekundärrechtliche
359 Vgl. WEBER-PANARIELLO 1995, S. 250; RANGE 2004, S. 15; KIETZ 2005, S. 6; JANOWSKI 2005, S. 52;
DIERINGER / STUCHLIK 2004, S. 2.
360 Vgl. KIETZ 2005, S. 3; RANGE 2004, S. 16.
361 Vgl. HUBER 2001, S. 51.
362 Vgl. HUBER 2001, S. 52.
78
5.3 Perspektiven der Mitbestimmung der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
Rechtssetzungsverfahren das Legitimationsdefizit der EU deutlich senken. Möglich
wäre z.B., dass die nationalen Parlamente in Grundsatzfragen der Gesetzgebung zusam
men mit dem EP an Stelle der Regierungen entscheiden könnten.363
Falls die nationalen Parlamente stärker unionsrechtlich beteiligt würden, wäre auch
die Sicherung ihrer Rechte durch ein Klagerecht vor dem EuGH notwendig. Die im
Verfassungsvertrag erweiterten Rechte der nationalen Parlamente werden durch ein
Klagerecht vor dem EuGH unterstützt.364 Man sollte Möglichkeiten finden, dieses Recht
den nationalen Parlamenten auch zuzusichern, wenn der Verfassungsvertrag nicht in
Kraft treten würde.
Weiterhin ist es besonders für eine verbesserte Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips
empfehlenswert, dass man die Beziehungen zwischen den Parlamenten, und zwar nicht
nur zwischen ihren Europaausschüssen, sondern auch zwischen den jeweiligen Fachaus
schüssen, intensiviert. Somit könnten auch normative Alleingänge und damit verbunde
ne negative Auswirkungen für alle weitestgehend verhindert werden.365
Ein zusätzlicher wichtiger Aspekt hinsichtlich der Sicherung oder des Ausbaus der
Mitwirkungsrechte der nationalen Parlamente ist das System der parlamentarischen
Kontrolle in der EU. Diese parlamentarischen Kontrollaufgaben sollten sowohl durch
das EP als auch von den nationalen Parlamenten durchgeführt werden. Die Kontrolle
der Kommission und des Rates liegt beim EP, die im Rat vereinigten Vertreter der Re
gierungen werden v.a. von den nationalen Parlamenten überwacht. Der Europäische Rat
unterliegt derzeit einer nicht immer wirksamen Kontrolle durch das EP oder die natio
nalen Parlamente, was meist von den innerstaatlichen Regelungen abhängt. In Deutsch
land hat sich beispielsweise das Verfahren etabliert, dass vor und nach jedem Europäi
schen Rat im Europaausschuss oder im Plenum des Bundestages ein Mitglied der Bun
desregierung oder ein Vertreter über den Rat berichtet. Man sollte demnach darauf ach
ten, dass auch die nationale parlamentarische Kontrolle ausgebaut wird und man diese
nicht nur dem EP überlässt.366
Im Rahmen der Diskussion über eine verstärkte parlamentarische Mitwirkung in der
EU spricht man immer wieder über eine zweite oder dritte Kammer367, eine europäische
Parlamentskammer bzw. über überhaupt zusätzliche Gremien auf EU-Ebene, die die na
tionalen Parlamente vertreten sollen. Größter Befürworter dieser Idee ist Frankreich. In
einer Rede zu „Gedanken über die Finalität der europäischen Integration“ entwarf auch
der damalige Bundesaußenminister Deutschlands Joseph Fischer im Mai 2000 den Weg
zu einer vollen Parlamentarisierung in einer Europäischen Föderation. Dabei schlug er
die Gründung eines europäischen Parlaments vor, das aus zwei Kammern bestehe, wo
bei eine Kammer durch gewählte Abgeordnete der nationalen Parlamente zu besetzen
sei. Die zweite Kammer sollte dem Senatsmodell ähneln. Die erste Kammer würde so
mit durch Parlamentarier mit einem Doppelmandat besetzt, was praktisch zu einer sehr
hohen Belastung führen würde.368 Auch der Vorsitzende des Konvents über die Zukunft
Europas, Giscard d’Estaing äußerte sich mehrfach für einen „Kongress der Völker Eu
363 Vgl. HUBER 2001, S. 52 f.
364 Dazu ausführlicher unter Punkt 5.3.1 (S. 73) dieser Arbeit; HUBER 2001, S. 53.
365 Vgl. PÖHLE 1998, S. 86.
366 Vgl. PÖHLE 1998, S. 86.
367 Vgl. PÖHLE 1998, S. 56.
368 Vgl. FISCHER, JOSEPH Vom Staatenbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der Europäi
schen Integration. Vortrag an der Humboldt-Universität zu Berlin am 12. Mai 2000. [http://www.aus
waertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/2000/000512-EuropaeischeIntegration.html; Zu
griff am 12.06.2006], JANOWSKI S. 46; MAURER 2002, S. 388; MAURER / WESSELS 2001.
79
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
ropas“.369 Vor allem die Parlamente Schwedens, Finnlands, Deutschlands, Irlands, Ös
terreichs, Estlands und Großbritanniens haben sich grundsätzlich deutlich gegen die
Einrichtung eines derartigen neuen Gremiums und für die Prüfung nationalparlamenta
rischer Mitwirkung auf der Ebene der Mitgliedstaaten ausgesprochen. Als Alternative
zur Schaffung eines neuen Organs sehen sie die Stärkung der Rolle der COSAC.
5.3.3 Perspektiven der interparlamentarischen Kooperation einschließlich der
COSAC
Bei der Betrachtung der aktuellen Initiativen zur Stärkung der Rolle der nationalen Par
lamente im europäischen Entscheidungsprozess und zur Verbesserung der interparla
mentarischen Kooperation, u.a. im Rahmen des Konvents zur Zukunft Europas, durch
die COSAC, durch das EP, durch die Konferenz der Parlamentspräsidenten, durch die
nationalen Parlamente selbst, etc., kann man davon ausgehen, dass der Wille besteht,
Fortschritte zu machen. Man kann festhalten, dass sich die interparlamentarische Ko
operation in den letzten Jahren deutlich verbessert hat und man sich schon derzeit auf
ein Netzwerk von institutionalisierten und informellen Beziehungen stützen kann, das
die Mitwirkung der nationalen Parlamente am europäischen Entscheidungsprozess si
chert und zukünftig noch steigern soll.370
Verbesserungswürdig scheint, dass derzeit noch kein Gremium zur Koordinierung
der Parlamentskontakte existiert. So sind die einzelnen Parlamente bzw. deren Aus
schüsse größtenteils auf sich alleine gestellt.
Beispielhaft für die Bemühungen um eine Verbesserung der interparlamentarischen
Kooperation ist die im November 2003 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Euro
paausschuss des Deutschen Bundestages und der EU-Delegation der französischen Na
tionalversammlung, die ermöglicht, dass zukünftig ein Beobachter des EU-Ausschusses
an den Sitzungen der Delegation der Französischen Nationalversammlung teilnehmen
kann und umgekehrt. Dadurch soll die interinstitutionelle Zusammenarbeit der beiden
Gremien verstärkt werden.371
Die COSAC ist das einzige in den Verträgen erwähnte Gremium auf europäischer
Ebene, in dem die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten und das EP gemein
sam handeln und bei dem die Beitrittskandidaten frühzeitig eingebunden sind. Die CO
SAC hat das Recht, Stellungnahmen an die EU-Institutionen abzugeben. Durch die re
gelmäßigen Treffen können die Parlamentarier der teilnehmenden Länder persönliche
Netzwerke aufbauen, nationale Ideen auf europäischer Ebene austauschen und die euro
päischen Ideen wieder auf die nationale Ebene tragen.
Ein Mittel zur verstärkten parlamentarischen Mitwirkung wäre die bereits angespro
chene Möglichkeit, dass die COSAC einmal jährlich die Kommission zu einer Diskussi
on über ihr Legislativ- und Arbeitsprogramm einlädt und folgend eine bestimmte Zahl
an konkreten Initiativen auswählt, die dann von der COSAC detaillierter kontrolliert
und evaluiert werden, vor allem in Bezug auf die Prinzipien der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit.372 Einige nationale Parlamente sehen diese Entwicklung der Auf
369 Vgl. D’ESTAING, GISCARD Europas letzte Chance, in: Süddeutsche Zeitung, 23. Juli 2002; MAURER
2004, S. 255.
370 Vgl. GRUNERT 2004, S. 429 f.
371 Vgl. JANOWSKI 2005, S. 227.
372 Vgl. Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a,
S. 239, 270, 275, 304; COSAC: Contribution from the XXVIII COSAC. Brussels, 27 January 2003.
Punkt 6.
80
5.3 Perspektiven der Mitbestimmung der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene
gaben der COSAC als nicht wünschenswert an, u.a. äußerte sich der Vorsitzende des
Europaausschusses des Bundestages im Januar 2003 gegen neue formale Aufgaben der
COSAC im Bereich der Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, da dies al
lein in der Zuständigkeit der nationalen Parlamente liege. 373 Eine Tendenz dieser Aufga
benübertragung ist heute jedoch abzusehen. Zukünftig ist zu erwarten, dass die COSAC
eine bedeutendere Rolle bei der Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips ein
nehmen wird.
Außerdem sollten die Fachausschüsse untereinander stärker vernetzt werden, was
auch schon im Rahmen der COSAC diskutiert wurde. Die COSAC unterstützt diese
Vernetzung, will jedoch nicht zu einem Forum der Fachausschüsse werden.374
Im Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente zum Verfassungsvertrag wird
zu einer Stärkung der interparlamentarischen Kooperation unter den nationalen Parla
menten der Mitgliedstaaten der EU und mit dem EP aufgerufen.375 Die COSAC kann
weiterhin jeden ihr zweckmäßig erscheinenden Beitrag an die EU-Institutionen richten,
wobei sie jedoch nicht die nationalen Parlamente binden soll. Zusätzlich werden die
Rolle und die Funktionen der COSAC in zwei neue Bereiche ausgeweitet, da erstens
festgelegt wurde, dass die COSAC den Austausch von Informationen und „best practi
ce“ zwischen den Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU und dem EP einschließlich
ihrer Fachausschüsse fördern soll. Außerdem wird die COSAC aufgerufen, interparla
mentarische Konferenzen zu bestimmten Themen einzuberufen, insbesondere zu Fragen
der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.376
Man kann feststellen, dass sich bezüglich der Mitbestimmung der nationalen Parla
mente in EU-Angelegenheiten schon viel bewegt hat, seitdem die Parlamente Anfang
der 1990er Jahre als Akteure in der EU wahrgenommen wurden. Dennoch bestehen
Notwendigkeiten und auch Potentiale, die bisher erreichte Situation sowohl auf nationa
ler als auch auf europäischer Ebene zu verbessern. Das Inkrafttreten des Verfassungs
vertrages wäre ein weiterer bedeutender Schritt in diese Richtung. Außerdem muss ver
stärkt darauf hingearbeitet werden, dass die dazu gewonnenen Rechte und Kompeten
zen der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten effektiver in die Praxis umge
setzt werden.
373 Vgl. Deutscher Bundestag/ Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a,
S. 288.
374 Vgl. Deutscher Bundestag/ Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 2003a,
S. 304.
375 Zur Rolle der COSAC laut Verfassungsvertrag siehe Punkt 5.3.3 (S. 80).
376 Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente zum Vertrag über eine Verfassung für Europa
(2004), Titel II, COSAC 2004a, S. 8; GRUNERT 2004, S. 424.
81
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Anhang
A) Thesen
I. Nationale Ebene: Die aktuelle Situation und Verbesserungsvorschläge für die
parlamentarische Mitbestimmung in der EU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
82
Das Parlament ist in einer parlamentarischen Demokratie das zentrale Leitungsund Steuerungsorgan.
Eine höhere Integration der Europapolitik bzw. europäischer Themen in die Ar
beit der nationalen Parlamente ist eine Voraussetzung für die demokratische Le
gitimation der EU. Dadurch kann die EU den Bürgern nähergebracht werden.
In den Mitgliedstaaten der EU werden durch die Europäisierung der Rechtsord
nungen legislative Kompetenzen der nationalen Parlamente auf die europäische
Ebene übertragen.
Indirekt werden diese Kompetenzen auf die im Rat der EU vertretenen Regie
rungen übertragen, die dort legislativ tätig werden.
Je mehr Aufgaben und Befugnisse auf die Gemeinschaft übertragen und je be
deutender die Mehrheitsentscheidungen im Rat werden, desto höher ist die Not
wendigkeit einer parlamentarischen Legitimationsabstützung.
Ein Demokratiedefizit in der EU entsteht dadurch, dass die im Rat vertretenen
Regierungen der Mitgliedstaaten nur unzureichend demokratisch, d.h. durch die
nationalen Parlamente, kontrolliert werden. Diese sind oftmals nur einge
schränkt dazu in der Lage.
Ob die parlamentarische Beteiligung und Kontrolle der Europapolitik effektiv
ist, hängt oft von der jeweiligen Regierung ab, die Zeitpunkt und Umfang der
Informationen an das Parlament steuert und außerdem rechtlich meist nicht an
die Parlamentsbeschlüsse gebunden ist.
Die Unterschiede in der Mitwirkung der nationalen Parlamente ergeben sich in
erster Linie aus den unterschiedlichen Bestimmungen der Verfassungen der Mit
gliedstaaten.
Die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten haben auf den Prozess der Europäisie
rung reagiert und entsprechende Europa-Gremien innerhalb ihrer Struktur ge
schaffen.
Die Europa-Gremien der nationalen Parlamente der EU haben bisher nur im ge
ringem Umfang ihre Regierungen beeinflusst.
Die stärkste parlamentarische Kammer hinsichtlich der Mitwirkung in EU-An
gelegenheiten ist der dänische Folketing, der seiner Regierung ein konkretes
Verhandlungsmandat für das Auftreten im Rat der EU gibt, welches auch nicht
ohne Absprache geändert werden kann.
Das Informationsproblem der Parlamente besteht oftmals nicht in der Bereitstel
lung von Informationen, sondern in der Selektion der wirklich wichtigen aus der
riesigen Fülle an Informationen (Quantität, Qualität, Timing, Nutzung).
Eine umfassende und frühestmögliche Information des Parlamentes durch die
Regierung ist europäisch sowie meist auch innerstaatlich geregelt. Im Verfas
sungsvertrag wird sie nochmals vertieft. Wichtig ist jedoch vor allem die effekti
ve Umsetzung der schon heute bestehenden Rechte.
A) Thesen
•
•
•
•
•
•
•
•
Neben der Schaffung neuer Gesetze und Verfahren, um die Europatauglichkeit
der Parlamente zu verbessern, ist es besonders wichtig, dass die jeweiligen (na
tionalen) Akteure zuallererst ein eigenes europäisches Bewusstsein entwickeln.
Die nationalen Parlamente sollten mehr Eigeninitiative zeigen und die eigenen
Positionen gegenüber den nationalen Regierungen stärken, z.B. indem sie ihre
schon bestehenden Rechte effektiver wahrnehmen und größeren Einfluss auf ih
re Minister ausüben, bevor sie an den Verhandlungen des Rates der EU teilneh
men.
Wenn die Parlamente über ihre Regierungen auf die Entscheidungsfindung auf
EU-Ebene Einfluss nehmen wollen, können sie dies durch eine frühzeitige Stel
lungnahme erreichen.
Damit ein Parlament im EU-Entscheidungsprozess Einfluss nehmen kann, muss
es frühzeitig, gezielt und kompetent über die Aktivitäten der EU-Institutionen
und seiner Regierung informiert sein. Anschließend sind ausreichend personelle
und fachliche Ressourcen notwendig, diese Informationen auszuwerten und um
zusetzen. Dabei ist neben einer funktionierenden Kommunikation zwischen Re
gierung und Parlament auch die Kommunikation zwischen Abgeordneten und
Parlamentsmitarbeitern von großer Bedeutung. Nicht zu vergessen bei der Aus
gestaltung dieser Prozesse ist die Transparenz der Willensbildung für den Bür
ger.
Zukünftig ist wichtig, das Hintergrundwissen und den Informationszugang der
nationalen Parlamente zu verbessern. Dies ist auf verschiedenen Wegen mög
lich, z.B.: durch Verpflichtung der Regierung zu besserer Information, durch di
rekte Information von Seiten der EU-Institutionen oder durch Einrichtung eines
gemeinsamen Wissenschaftlichen Dienst für die nationalen Parlamente.
Änderungen in der Verwaltungsstruktur der nationalen Parlamente sind notwen
dig, um den zunehmenden Verpflichtungen gerecht zu werden. So sollte bei der
Rekrutierung der Parlamentsmitarbeiter besonders auf die Europakompetenz ge
achtet werden, eine Aufstockung im Europa-Bereich wäre sinnvoll.
Eine Verbesserung der Kontrolle der Regierungen durch die nationalen Parla
mente wäre erreichbar durch eine Fristverlängerung für die Erarbeitung von
Stellungnahmen zu EU-Vorlagen sowie eine Erhöhung der innerparlamentari
schen Ressourcen zur Bearbeitung der zugeleiteten Informationen. In fast allen
Mitgliedstaaten sind die EU-Gremien überlastet.
Die Zukunft der Mitbestimmung der nationalen Parlamente in EU-Angelegen
heiten liegt im nationalen Bereich und bei der Subsidiaritätskontrolle.
II. Situation im Deutschen Bundestag und Ansätze zur Verbesserung
•
•
Hauptprobleme des Bundestages bei der Bearbeitung von EU-Gesetzesvorlagen
sind die komplizierten, intransparenten und zeitaufwendigen bundestagsinternen
Verfahren der Zuleitung sowie Informationsdefizite bzw. Probleme bei der Se
lektion der Informationen.
Bisher kamen Entscheidungen des Bundestages zu EU-Angelegenheiten oftmals
zu spät, um tatsächlich den Entscheidungsprozess der EU zu beeinflussen, was
meist auf die schlechte Informationslage des Bundestages und zu lange Verfah
ren zurückzuführen war.
83
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
•
•
Die Arbeitsweise des EU-Ausschusses sollte durch mehr Öffentlichkeit und
Transparenz verbessert werden. Durch eine Erhöhung der personellen Kapazitä
ten (Parlamentsmitarbeiter) und der Fachkompetenz bei der Selektion der EUVorlagen könnte man die Mitbestimmung in EU-Angelegenheiten effektivieren.
Um die Bundesregierung bei den Verhandlungen im Rat an die Stellungnahme
des Bundestages zu binden, müsste verstärkt eine „maßgebliche“ Berücksichti
gung festgeschrieben werden.
III. Europäische Ebene: Zur aktuellen Situation und Perspektiven der parlamen
tarischen Mitbestimmung in der EU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
84
Die Rolle der nationalen Parlamente in der EU ist noch nicht definitiv festgelegt,
die Parlamente sind noch auf der Suche nach ihrem Platz im europäischen Insti
tutionengefüge.
In den Europäischen Verträgen ist eine zunehmende Normierung der Rolle und
Rechte der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten erkennbar. Der nächs
te Schritt in diese Richtung wäre das Inkrafttreten des Verfassungsvertrages.
Eine Möglichkeit der Mitwirkung der nationaler Parlamente im EU-Gesetzge
bungsprozess wird im Verfassungsvertrag durch die Rolle der nationalen Parla
mente als Subsidiaritätswächter im Frühwarnsystem aufgezeigt. (siehe Punkt IV.)
Durch die Mitwirkung der nationalen Parlamente in der EU sollten die Grund
strukturen der EU nicht verändert werden, d.h. die nationalen Parlamente sollten
zu keiner neuen Institution des europäischen Entscheidungsprozesses werden.
Die Einrichtung einer weiteren Institution bzw. einer parlamentarischen Kam
mer auf EU-Ebene wird nur noch von einer Minderheit der nationalen Parlamen
te befürwortet.
Das Verhältnis zwischen EP und nationalen Parlamenten hat sich von Konkur
renz zu Partnerschaft gewandelt und ist nun Grundlage einer noch enger wer
denden Kooperation.
Die nationalen Parlamente sollten zu Änderungsvorschlägen bei Vertragsände
rungen angehört werden. Die Konventsmethode wäre dabei eine mögliche Form.
Die nationalen Parlamente sollten auch auf europäischer Ebene in das sekundär
rechtliche Rechtssetzungsverfahren einbezogen werden. Bei Grundsatzfragen
der Gesetzgebung könnten sie z.B. an die Stelle des Rates treten.
Falls die Parlamente in den Verträgen mit unionsrechtlichen Kompetenzen aus
gestattet würden, müssten sie auch mit einem eigenständigen Klagerecht vor
dem EuGH ausgestattet werden. Im Verfassungsvertrag wird den nationalen Par
lamenten bei vermuteter Verletzung des Subsidiaritätsprinzips ein Klagerecht
vor dem EuGH eingeräumt.
Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene muss erreicht werden,
dass aufwendige Arbeit nicht doppelt erledigt wird, z.B. die Erstellung von Da
tenbanken.
A) Thesen
IV. Aufwertung der Rolle der nationalen Parlamente durch den Vertrag über eine
Verfassung für Europa
•
•
•
•
•
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa wertet die nationalen Parlamente
durch eine verbesserte Unterrichtung, das Frühwarnsystem und ihr neues Klage
recht vor dem EuGH deutlich auf.
Außerdem werden die Parlamente zu einer verstärkten interparlamentarischen
Kooperation aufgerufen und die Aufgaben der COSAC werden erweitert.
Der im Verfassungsvertrag festgelegt Frühwarnmechanismus, bei dem es den
nationalen Parlamenten bei einer ausreichend großen Zahl von Einsprüchen
möglich ist, eine Reaktion der Kommission zu erzwingen, sollte baldmöglichst
Anwendung finden, auch außerhalb des Verfassungsvertrages, wenn dieser nicht
ratifiziert wird. Gleiches gilt für die Klagemöglichkeit vor dem EuGH.
Es muss zukünftig sichergestellt werden, dass die nationalen Parlamente den
neuen, zusätzlichen Arbeitsaufwand bewältigen können.
Die stärkere Rolle der nationalen Parlamente im Verfassungsvertrag ergänzt die
Kompetenzen des EP und trägt zu einer Verringerung des Demokratiedefizits in
der EU bei.
V. Die Rolle der COSAC als wichtige Form der interparlamentarischen Koopera
tion
Neben der Stärkung des einzelnen Parlaments sollte die interparlamentarische Koope
ration auf allen Gebieten, zwischen den nationalen Parlamenten untereinander und
dem EP erhöht werden.
− Die COSAC ist ein einmaliges informelles Forum für die nationalen Parlamente, das
EP und die Parlamente der Beitrittskandidaten zum Meinungsaustausch und zur Kon
taktaufnahme. Sie ist auf europäischer Ebene fest etabliert.
− Die COSAC oder auch die Konferenz der Parlamentspräsidenten befassen sich ver
stärkt mit institutionellen Fragen, wohingegen sich die eher informellen Kooperatio
nen, wie z.B. die gemeinsamen Fachausschusssitzungen, mehr mit dem täglichen Ge
setzgebungsprozessen der EU beschäftigen.
− Die größten Erfolge der COSAC sind die Stärkung der nationalen Parlamente in EUAngelegenheiten sowie insbesondere die Aufnahme des Amsterdamer Protokolls über
die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in die Europäischen Verträge.
− Hauptprobleme der COSAC in Organisation und Ablauf sind die oft zu generellen De
batten, und die ungelöste Frage, wie Themen am besten vorbereitet werden.
− Die Generalität der Debatten ist oftmals auf die Unterschiede der nationalen Parla
mente und ihres Umgangs mit EU-Angelegenheiten zurückzuführen, z.B. die Unter
schiede in der parlamentarischen Kontrolle, verschiedene Festlegungen in den Verfas
sungen, unterschiedliches Informationsniveau der nationalen Parlamente.
− Dennoch erweitert die Debatte unter den nationalen und europäischen Parlamentariern
auf der COSAC die Dimension der parlamentarischen Arbeit und hilft, die Vorgänge
in den Nationalstaaten besser zu verstehen.
− Genauso wie die nationalen Parlamente schöpft auch die COSAC die ihr durch das
Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente zugesicherten Rechte nicht
voll aus.
−
85
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Die COSAC sollte, falls ein Bedeutungszuwachs erwünscht ist, mehr von ihrem Recht
Gebrauch machen, zu bestimmten Gesetzesinitiativen Beiträge an die Institutionen der
EU zu richten.
− Nur eine Minderheit der nationalen Parlamente befürwortet eine stärkere Rolle. Die
Mehrheit sowie das EP beschränken sich auf die Wahrnehmung der COSAC als infor
melles Gremium und wünschen keinen weiteren Ausbau bzw. Institutionalisierung.
− Durch die Einladung der COSAC, Beiträge zu Gesetzentwürfen zu liefern, wächst die
Zahl der Änderungswünsche, die von Kommission, EP und vom Rat bei seiner end
gültigen Entscheidung beachtet werden müssen. Da die Stellungnahmen aber nicht
bindend sind, kann der Rat die für seine Entscheidung geeigneten Argumente aus der
Vielzahl der Stellungnahmen der beteiligten Institutionen auswählen. Diese Situation
könnte dadurch geändert werden, dass den Stellungnahmen von bestimmten Institutio
nen (bspw. EP) Vorrang zukäme.
− Im Verfassungsvertrag wird die Rolle der COSAC erweitert. Sie wird erstens als Fo
rum des Informationsaustausches und des Austausches von best practice zwischen
den Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten und dem EP, einschließlich der Fachaus
schüsse, angesehen und zweitens wird die COSAC aufgerufen, interparlamentarische
Treffen zu bestimmten Themen einzuberufen, insbesondere zur gemeinsamen Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
− Die COSAC könnte neben ihrer zukünftigen Rolle bei der Wahrung des Subsidiari
tätsprinzips dazu genutzt werden, einheitliche Verfahren oder Standards für die Über
wachung der nationalen Regierungen zu schaffen.
−
86
B) Tabellen
Tabelle 1: Übersicht über die Grundlagen der Europa-Gremien in den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Österreich
− Nationalrat
Hauptausschuss
1995/2000 32 Mitglieder
Entscheidung für die Mandatserteilung
an die Regierung durch das Plenum
Österreich
− Bundesrat
EU-Ausschuss
1996
Entscheidung für die Mandatserteilung
durch das Plenum, aber Ausschuss kann
dem Plenum Bericht erstatten, das dann
entscheidet.
Belgien
− Abgeordnetenkam
mer und Senat
Beratender Bundesausschuss für
europäische Angelegenheiten
(Comité d'avis fédéral chargé de
Questions européennes)
(Federaal Adviescomité voor Eu
ropese Aangelegenheden)
1985/1990 30 Mitglieder: 10 Senatoren, Koordinierung und Förderung der Über
10 Mitglieder der Abgeordne wachung der Europäischen Entschei
tenkammer und 10 belgische dungsprozesse durch das Parlament
MEPs
Zypern
Ausschuss für europäische Angele 25. Februar 15 Mitglieder
genheiten (Ευρωπαϊκών
1999
Υποθέσεων)
Überwachung der Aktivitäten der Exeku
tive im Rahmen der Europäischen Ange
legenheiten. Einladung von Ministern zur
Beantwortung von Fragen.
Tschechische Repu
blik
− Abgeordnetenkam
mer
Ausschuss für europäische Angele 2004
genheiten
(Výbor pro evropské záležitosti)
Kontrolle von EU-Gesetzesvorlagen.
Kann Stellungnahmen an die Regierung
abgeben, die jedoch nicht bindend sind;
sie müssen jedoch berücksichtigt werden.
Kann Vorschläge an die Fachausschüsse
abgeben.
15 Mitglieder
21 Mitglieder, die die propor
tionale Stärke der politischen
Parteien in der Abgeordneten
kammer widerspiegeln
Funktion**
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Tschechische Repu
blik
− Senat
Ausschuss für europäische Angele 1998
genheiten
(Výbor pro evropské záležitosti)
11 Mitglieder, die die propor Verantwortlich für die Überwachung des
tionale Stärke der Gruppierun Abstimmungsverhaltens der Regierung
gen im Senat widerspiegeln
im Rat durch den Senat und die Untersu
chung von EU-Vorlagen sowie weiterer
wichtiger EU-Dokumente
Dänemark
Ausschuss für europäische Angele Oktober
genheiten
1972
(Europaudvalget)
17 Mitglieder
Generelle Kontrolle von EU-Angelegen
heiten sowie die Mandatserteilung an die
Regierung, bevor der Rat zu wichtigen
Richtlinien und Verordnungen abstimmt
Estland
Ausschuss für Angelegenheiten der Januar
Europäischen Union des Riigikogu 1997
(Riigikogu Euroopa Liidu asjade
komisjon)
mindestens 15 Mitglieder
Mandatserteilung an die Regierung
Finnland
Hauptausschuss
(Suuri valiokunta, Stora utskottet)
Frankreich
− Senat
Delegation des Senats für die Euro 6. Juli 1979
päische Union
(Délégation du Sénat pour l’Union
européenne)
1906, mit 25 Vollmitglieder und
den derzei 13 Stellvertreter, die teilneh
tigen Funk men und sprechen dürfen
tionen 1994
36 Mitglieder, die die propor
tionale Stärke der politischen
Gruppen im Senat widerspie
geln
Funktion**
Mandatserteilung an die Regierung auf
Basis von Vorschlägen der Fachaus
schüsse
Systematische Untersuchung der legisla
tiven EU-Vorlagen. Kann einen Vor
schlag für eine Resolution annehmen, die
dann entweder durch den zuständigen
Fachausschuss oder das Plenum des Se
nats angenommen werden kann.
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Frankreich
− Nationalversamm
lung
Delegation für die Europäische
Union
(La Délégation pour l’Union eu
ropéenne)
Deutschland
− Bundestag
Ausschuss für die Angelegenheiten September 33 Mitglieder des Bundesta
der Europäischen Union
1991/1994 ges und 16 MEPs ohne
Stimmrechte
Kontrolle der Regierung im Rat, Abgabe
von Stellungnahmen zu europäischen
Angelegenheiten
Deutschland
− Bundesrat
Ausschuss für Fragen der Euro
päischen Union
1957/1965 17 Mitglieder, davon je ein
Vertreter je Bundesland (Bay
ern entsendet derzeit 2 Vertre
ter); einige Mitglieder sind
Ministerpräsidenten, andere
sind Staatsminister für Euro
päische Angelegenheiten
Untersuchung und Diskussion aller EUDokumente vom Rat und der Kommissi
on, die für die Bundesländer wichtig
sind.
Griechenland
Ständiger (Sonder)ausschuss für
Europäische Angelegenheiten
(Ειδική Διαρκής Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)
Juni 1990
31 Mitglieder
Kann beratende Stellungnahmen zu jeder
Thematik seiner Zuständigkeiten an die
Regierung abgeben.
Ungarn
Ausschuss für Europäische Ange
legenheiten
(Európai ügyek bizottsága)
1992
21 Mitglieder, die die propor
tionale Stärke der politischen
Parteien im Parlament wider
spiegeln
Untersuchung von EU-Gesetzesvorlagen
und Beeinflussung der Position der Re
gierung zu diesen. Kann anstelle des
Plenums entscheiden.
6. Juli 1979 36 Mitglieder, die die propor
tionale Stärke der politischen
Gruppen in der Nationalver
sammlung widerspiegeln
Funktion**
Ausübung politischer Kontrolle über EUGesetzesvorlagen und über die Regierung
in Europäischen Angelegenheiten. Infor
mation der Abgeordneten in EU-Angele
genheiten. Kann über Beschlussempfeh
lungen zu europäischen Texten abstim
men, die dann an einen Fachausschuss
weitergeleitet werden.
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Irland
Gemeinsamer Ausschuss für Euro 1995 / 17.
päische Angelegenheiten
Okt. 2002
17 Mitglieder: 11 Mitglieder Der Unterausschuss für Europäische
des Dáil und 6 Mitglieder des Überwachung erhält und untersucht In
Senanad
formationen zu EU-Gesetzesvorschlägen
und anderen Dokumenten.
Italien
− Abgeordnetenkam
mer
Ausschuss für Europapolitik
1990/1996 Zusammengesetzt wie andere
(Commissione Politiche dell’Unio
ständige Ausschüsse der Ab
ne europea)
geordnetenkammer, derzeit 43
Mitglieder
Kann EU-Gesetzesvorlagen untersuchen
und sie an Fachausschüsse mit der Stel
lungnahme des EU-Ausschusses über
weisen.
14. Ständiger Ausschuss für Euro 1968/2003 derzeit 27 Mitglieder
papolitik
(14ª Commissione permanente Po
litiche dell’Unione europea)
Untersucht EU-Gesetzesvorlagen und die
Übereinstimmung von nationalen Vorla
gen mit den EU-Gesetzesvorlagen.
−
Italien
Senat
Funktion**
Lettland
Ausschuss für Europäische Ange
legenheiten
(Eiropas lietu komisija)
1995/2004 derzeit 17 Mitglieder, die die Annahme/ Bewilligung der Verhand
proportionale Stärke der parla lungsposition der Regierung
mentarischen Gruppen im Sei
ma widerspiegeln
Litauen
Ausschuss für Europäische Ange
legenheiten
(Europos reikalų komitetas)
18. Sept.
1997
Luxemburg
Ausschuss für Auswärtige und Eu 1989
ropäische Angelegenheiten, für
Verteidigung, für Zusammenarbeit
und für Immigration
(Commission des Affaires
étrangères et européennes, de la
Défense, de la Coopération et de
l’Immigration)
zwischen 15 und 25 Mitglie Abgabe einer Stellungnahme zur Mei
der, entsprechend der propor nung des Seimas zu EU-Vorlagen an die
tionalen Verteilung der politi Regierung
schen Parteien des Parlaments
11 Mitglieder, die die politi Verantwortlich für Dossiers im Rahmen
schen Gruppen des Parlaments seiner Kompetenzen (europäische Ange
repräsentieren
legenheiten, auswärtige Angelegenheiten,
Verteidigung, Entwicklung und Immigra
tion)
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Funktion**
Malta
Ständiger Ausschuss für Auswärti 1995/2003 9 Mitglieder
ge und Europäische Angelegenhei
ten
(Kumitat Permanenti dwar l-Affa
rijiet Barranin u Ewropej)
Analyse und Überwachung, dass die er
klärenden Mitteilungen (explanatory me
moranda) der Regierung die politischen,
ökonomischen und sozialen Effekte wi
derspiegeln
Niederlande
− Abgeordnetenhaus
Ausschuss für Europäische Ange 1986
legenheiten
(Commissie voor Europese Zaken)
27 Mitglieder, die die politi
schen Parteien des Abgeord
netenhauses repräsentieren
Kontrolle der Regierung bezüglich brei
terer, genereller und horizontaler Ent
wicklungen in der EU und institutioneller
Angelegenheiten. Kann Fachausschüsse
beraten.
Niederlande
− Senat
Ständiger Ausschuss für Europäi 9. Juni
sche Zusammenarbeit und Organi 1970
sation
(Vaaste Commissie voor Europese
Samenwerkings organisaties)
13 Mitglieder und 11 Stell
vertreter
Untersuchung aller Vorschläge der Kom
mission. Weitergabe von Vorschlägen an
Fachausschüsse für weitere Bearbeitung
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Funktion**
Polen
− Sejm
Ausschuss für Angelegenheiten
der Europäischen Union
(Komisja do Spraw Unii Europejs
kiej)
14. Mai
2004,
(zuvor hat
te der Sejm
einen Euro
paauss
chuss (Okt.
2001 bis
31. Juli
2004) und
davor einen
Ausschuss
für Euro
päische In
tegration
(seit 1993))
Nicht mehr als 46 Mitglieder
des Sejm (10% des Sejm). Die
Zusammensetzung sollte die
Zusammensetzung des Sejm
widerspiegeln
Kann Stellungnahmen zu legislativen
EU-Vorlagen abgeben, auf welche die
Regierung ihre Position im Rat stützen
muss.
Polen
− Senat
Ausschuss für Angelegenheiten
der Europäischen Union
(Komisja do Spraw Unii Europejs
kiej)
26. Nov.
1991 /
22. April
2004
Es gibt keine formalen Be
Nimmt Positionen ein und drückt Stel
schränkungen der Mitglieder lungnahmen zu legislativen EU-Vorlagen
zahl des Ausschusses
und anderen wichtigen EU-Dokumenten
aus. Kann Fachausschüsse um beratende
Hilfe bitten.
Portugal
Ausschuss für Europäische Ange
legenheiten
(Comissão de Assuntos Europeus)
33 Mitglieder, die die Stärke
der politischen Parteien des
Parlaments repräsentieren
Evaluiert die Interessen Portugals im
Rahmen der Europäischen Institutionen
oder der Kooperation zwischen den EUMitgliedstaaten, speziell die Aktivitäten
der Regierung bezüglich dieser Themen.
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Slowakische Repu
blik
Ausschuss des Nationalrates der
29. April
Slowakischen Republik für Euro 2004
päische Angelegenheiten
(Výbor Národnej rady Slovenskej
republiky pre európske záležitosti)
11 Mitglieder, die proportio Die Annahme bindender Positionen für
nal die Stärke der politischen die Regierung
Parteien des Parlaments reprä
sentieren
Slowenien
− Nationalversamm
lung
Ausschuss für Angelegenheiten der April 2004 14 Mitglieder, die proportio Diskussion und Formulierung der Positi
Europäischen Union
nal die Stärke der politischen on der Nationalversammlung
(Odbor za zadeve EU)
Parteien der Versammlung re
präsentieren
Slowenien
− Nationalrat
Kommission für Internationale Be 1993
ziehungen und Europäische Ange
legenheiten
(Sestava komisije za mednarodne
odnose in evropske zadeve)
Gemeinsamer Ausschuss für Euro 1986/19.
Spanien
− Kongress und Senat päische Angelegenheiten
Mai 1994
(Comisión Mixta para la Unión
Europea)
Schweden
Ausschuss für Angelegenheiten
der Europäischen Union
(Nämnden för Europeiska unio
nen)
Europäischer Kontrollausschuss
Großbritannien
− House of Commons (European Scrutiny Committee)
Funktion**
10 Mitglieder. Zusammenge
setzt aus den Vertretern der
Interessengruppen der slowa
kischen Gesellschaft
42 Mitglieder, entsprechend
der gemeinsamen Entschei
dung beider Kammern
Ist informiert über legislative EU-Vorla
gen und organisiert die Debatten über
diese. Kurze Berichte über EU-Angele
genheiten.
21. Dezem 17 Mitglieder und 33 Stellver Formulierung eines Mandats für die Re
ber 1994
treter. Alle Fachausschüsse
gierung
sind in dem Ausschuss vertre
ten.
1974
16 Mitglieder, die proportio
nal die Stärke der politischen
Parteien des HoC widerspie
geln
Berichterstattung an das HoC über die le
gislative und politische Bedeutung jedes
EU-Dokuments, Entscheidung, welche
Dokumente in ständigen Ausschüssen
oder im HoC debattiert werden sollten
Mitgliedstaat*
Bezeichnung des Europa-Gremi Grün
ums*
dungs
datum*
Zusammensetzung*
Funktion**
Großbritannien
− House of Lords
EU-Ausschuss
(European Union Committee)
ca. 18 Mitglieder, und weitere
52 in den sieben Unteraus
schüssen, d.h. 70 Mitglieder
sind insgesamt involviert
Beratung von EU-Dokumenten und ande
ren Angelegenheiten in Verbindung mit
der EU zusammen mit seinen sieben Un
terausschüssen
6. Mai
1974
* angelehnt an Table 1: European Affairs Committees of the parliaments of EU-25 and date of first establishment, in: COSAC: Third bi-annual Re
port: Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Luxembourg, May 2005. S. 8.
**angelehnt an Table2: Overview of the use of scrutiny reserves and involvement of sectoral committees in the scrutiny process, in: COSAC: Third biannual Report: Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Luxembourg, May 2005. S. 14.
Tabelle 2: Übersicht über die Kompetenzen, Mitwirkung von Fachausschüssen oder MEPs und Öffentlichkeit der Europa-Gremien der Parlamente
der EU-Mitgliedstaaten
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Österreich
− Nationalrat
Hauptausschuss
Ja, als Teil des Ja, als Teil des
Ja
Prozesses der Prozesses der
Mandatsertei Mandatserteilung
lung
Kann Debatten über die Ja
Jahres- und Mehrjähri
gen Programme des Ra
tes und der Kommission
führen
Ja, in der Re
gel
Österreich
− Bundesrat
EU-Ausschuss
Ja, als Teil des Ja, als Teil des
Ja
Prozesses der Prozesses der
Mandatsertei Mandatserteilung
lung
Ja
Ja, in der Re
gel
Belgien
− Abgeordne
tenkammer
und Senat
Beratender Bundesaus Nein
schuss für europäische
Angelegenheiten
(Comité d’avis fédéral
chargé de Questions eu
ropéennes)
(Federaal Adviescomité
voor Europese Aangele
genheden)
Nein
Ja
Ja. Fachausschüsse or Ja
ganisieren Anhörungen
zu spezifischen Themen
einschließlich EU-Ange
legenheiten und bitten
die Regierung um Infor
mationen zu ihrem
Kompetenzbereich.
Ja, in der Re
gel
Zypern
Ausschuss für europäi
sche Angelegenheiten
(Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων)
Nein
Nicht als
solche
Nein
Auf Einladung Ja, in der Re
gel
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Ja
Ja
Kann Stellungnahmen
Ja
nach der Überweisung
durch den Europaaus
schuss an die Regierung
übermitteln
Ja, in der Re
gel
Ja
Fachausschüsse können Ja
gebeten werden, Stel
lungnahmen abzugeben
Ja, in der Re
gel, kann aber
unter Aus
schluss der Öf
fentlichkeit ta
gen, wenn dies
ein Mitglied
des Ausschus
ses oder die
Regierung for
dert.
Fachausschüsse können Nein
Stellungnahmen zu EUVorlagen abgeben oder
Minister vor den Aus
schuss rufen.
Nein. Ge
schlossene Sit
zungen sind
die Regel, aber
es wurde be
schlossen, Tei
le der Sitzun
gen für die Öf
fentlichkeit zu
öffnen.
Tschechische
Republik
− Abgeordne
tenkammer
Ausschuss für europäi
sche Angelegenheiten
(Výbor pro evropské
záležitosti)
Ja
Tschechische
Republik
− Senat
Ausschuss für europäi
sche Angelegenheiten
(Výbor pro evropské
záležitosti)
Ja – aber ein Nein
geschränkt auf
35 Tage
Dänemark
Ausschuss für europäi
sche Angelegenheiten
(Europaudvalget)
Ja, als Teil des Ja, als Teil des
Ja
Prozesses der Prozesses der
Mandatsertei Mandatserteilung
lung
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Estland
Ausschuss für Angele
genheiten der Europäi
schen Union des Riigi
kogu
(Riigikogu Euroopa Lii
du asjade komisjon)
Finnland
Frankreich
− Senat
Subsidiaritäts
kontrolle****
Ja, als Teil des Nein
Prozesses der
Mandatsertei
lung
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Ja
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
fachausschüsse können Ja
Stellungnahmen zu EUVorlagen abgeben
Nein
Hauptausschuss
Ja, als Teil des Ja, als Teil des
Ja
(Suuri valiokunta, Stora Prozesses der Prozesses der
utskottet)
Mandatsertei Mandatserteilung
lung
Ausführen von detail
Nein
lierter Überprüfung von
EU-Vorlagen und Vor
schlag einer nationalen
Position
Nein
Delegation des Senats
Ja
für die Europäische Uni
on
(Délégation du Sénat
pour l’Union européen
ne)
Ja, als Teil der re Ja
gulären Überprü
fung der EU-Do
kumente
Kann Vorschläge und
Nein
Resolutionen untersu
chen, die der Europaaus
schuss an sie überwiesen
hat.
Nein
Delegation für die Euro Ja
Frankreich
− Nationalver päische Union
(La Délégation pour
sammlung
l’Union européenne)
Ja, als Teil der re Ja
gulären Überprü
fung der EU-Do
kumente
Kann Vorschläge für
Resolution der EU-De
legation untersuchen,
die sie dann annehmen,
ändern oder ablehnen
kann.
Auf Einladung Nein, in der
Regel ge
schlossene Sit
zungen, aber
bestimmte
Treffen sind
öffentlich.
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Deutschland
− Bundestag
Ausschuss für die Ange Nein
legenheiten der Euro
päischen Union
Nicht systema
Ja, abhän
tisch, nur verein gig vom
zelt
Thema
Fachausschüsse sind
Ja
verantwortlich für die
Behandlung von EUThemen bezüglich spe
zifischer, technischer
Aspekte der EU-Gesetz
gebung.
Nein. In der
Regel ge
schlossene Sit
zungen, aber
ca. ¼ der Sit
zungen sind
öffentlich.
Deutschland
− Bundesrat
Ausschuss für Fragen
der Europäischen Union
Ja
Nein, das
EUZBLG
gilt nicht
für die
GASP
fachausschüsse können
Empfehlungen zu EUVorlagen abgeben, die
an den EU-Ausschuss
weitergeleitet werden.
Nein
Nein
Nein
Ja, in der
Regel
Diskussion von EUJa
Vorlagen und Annahme
von beratenden Stel
lungnahmen über The
men in ihrem Kompe
tenzbereich
Ja, Sitzungen
sind öffentlich.
Ausschuss für Europäi Nein
sche Angelegenheiten
(Európai ügyek bizottsá
ga)
Nein
Nein
FAchausschüsse können Ja
Stellungnahmen zu EUVorlagen abgeben.
Nein, nicht
wenn die Posi
tion der Regie
rung verhan
delt wird,
sonst ja
Griechenland Ständiger (Sonder)aus
schuss für Europäische
Angelegenheiten
(Ειδική Διαρκής
Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων)
Ungarn
Nein
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Irland
Gemeinsamer Ausschuss Nein
für Europäische Angele
genheiten
Ja, als Teil der re Ja
gulären Überprü
fung der EU-Vor
lagen
Untersuchung von EU- Ja
Vorlagen, die vom EUAusschuss weitergeleitet
wurden
Ja, in der Re
gel
Italien
− Abgeordne
tenkammer
Ausschuss für Europapo Ja, aber einge
litik
schränkt auf
(Commissione Politiche 20 Tage
dell’Unione europea)
Ja, bei der Prü
Ja
fung des jährli
chen Arbeits- und
Legislativpro
gramms der
Kommission
fachausschüsse können
nach Überweisung
durch den EU-Aus
schuss EU-Vorlagen
prüfen und eine Stel
lungnahme dazu abge
ben
Nein
Ja, in der Re
gel
Italien
− Senat
14. Ständiger Ausschuss Ja, aber einge
für Europapolitik
schränkt auf
(14ª Commissione per 20 Tage
manente Politiche
dell’Unione europea)
Ja, bei der Prü
Ja
fung des jährli
chen Arbeits- und
Legislativpro
gramms der
Kommission
fachausschüsse können Nein
Stellungnahmen zu EUVorlagen abgeben, wenn
sie vom EU-Ausschuss
darum gebeten werden.
Ja, in der Re
gel
Lettland
Ausschuss für Europäi
sche Angelegenheiten
(Eiropas lietu komisija)
Ja, bei der Unter Ja
suchung der Posi
tion der Regie
rung
Absicht, Fachausschüsse Auf Einladung Ja
zu involvieren (Mitte
2005)
Nein
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Litauen
Ausschuss für Europäi
sche Angelegenheiten
(Europos reikalų komi
tetas)
Luxemburg
Ausschuss für Auswärti Nein
ge und Europäische An
gelegenheiten, für Ver
teidigung, für Zusam
menarbeit und für Immi
gration
(Commission des Affai
res étrangères et eu
ropéennes, de la Défen
se, de la Coopération et
de l’Immigration)
Malta
Subsidiaritäts
kontrolle****
Ja, als Teil des Ja
Prozesses der
Mandatsertei
lung
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Ja
fachausschüsse nehmen Ja
am Prozess der Vorbe
reitung und Evaluierung
von EU-Vorlagen teil
und geben Schlussfolge
rungen an den EU-Aus
schuss, den Auswärtigen
Ausschuss oder die
Kammer ab.
Ja, in der Re
gel
Nein
Nein
Ja, im Rahmen ihrer
Kompetenzen
Auf Einladung Nein. Die Sit
zungen sind
nicht öffent
lich, außer es
wurde anders
vom Aus
schuss be
schlossen.
Ständiger Ausschuss für Ja, aber weni Nein
Auswärtige und Europäi ger bindend
sche Angelegenheiten
(Kumitat Permanenti
dwar l-Affarijiet Barra
nin u Ewropej)
Nein
Nein
Ja
Nein
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Niederlande
− Abgeordne
tenhaus
Ausschuss für Europäi
sche Angelegenheiten
(Commissie voor Euro
pese Zaken)
Nein, aber es Ja, entsprechend
gibt spezielle der sog. FicheRegeln im Be Prozedur
reich der In
nenpolitik
Ja
Kontrolle der Regierung Ja
hinsichtlich der Ent
wicklungen in Brüssel
im Rahmen ihres Poli
tikfeldes
Ja
Niederlande
− Senat
Ständiger Ausschuss für
Europäische Zusammen
arbeit und Organisation
(Vaaste Commissie voor
Europese Samenwer
kings organisaties)
Nein, aber es Ja
gibt spezielle
Regeln im Be
reich der In
nenpolitik
Nein
Kann Stellungsnahmen Nein
an die Regierung abge
ben oder schriftlich Fra
gen stellen oder Plenar
debatten mit der Teil
nahme der Regierung
organisieren.
Nein
Polen
− Sejm
Ausschuss für Angele
genheiten der Europäi
schen Union
(Komisja do Spraw Unii
Europejskiej)
Ja, als Teil des Nein
Prozesses der
Mandatsertei
lung
Ja
Nein
Ja, außer der
Ausschuss ent
scheidet etwas
anderes.
Polen
- Senat
Ausschuss für Angele
genheiten der Europäi
schen Union
(Komisja do Spraw Unii
Europejskiej)
Ja, als Teil des Nein
Prozesses der
Mandatsertei
lung
Bisher
Berät nach Überweisung Ja
noch nicht den EU-Ausschuss in
EU-Angelegenheiten
Ja
Ja, in der Re
gel
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Portugal
Ausschuss für Europäi
sche Angelegenheiten
(Comissão de Assuntos
Europeus)
Nein
Nein
Ja
Die Fachausschüsse
Auf Einladung
können auf Verlangen
des EU-Ausschusses
formale Stellungnahmen
zu EU-Vorlagen oder
anderen Dokumenten
abgeben.
Ja, außer der
Ausschuss ent
scheidet etwas
anderes
Slowakische
Republik
Ausschuss des National
rates der Slowakischen
Republik für Europäi
sche Angelegenheiten
(Výbor Národnej rady
Slovenskej republiky pre
európske záležitosti)
Ja, als Teil des Nein
Prozesses der
Mandatsertei
lung
Ja
fachausschüsse können Ja
gebeten werden, ihre
Stellungnahme zur Posi
tion der Regierung abzu
geben
Ja, außer der
Ausschuss ent
scheidet etwas
anderes
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Nein
Kommission für Interna Nein
tionale Beziehungen und
Europäische Angelegen
heiten
(Sestava komisije za
mednarodne odnose in
evropske zadeve)
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja
Ausschuss für Angele
Slowenien
− Nationalver genheiten der Europäi
schen Union
sammlung
(Odbor za zadeve EU)
Slowenien
− Nationalrat
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Nein
Nein
Nein
Nein
Spanien
− Kongress
und Senat
Gemeinsamer Ausschuss Nein
für Europäische Angele
genheiten
(Comisión Mixta para la
Unión Europea)
Schweden
Ausschuss für Angele
genheiten der Europäi
schen Union
(Nämnden för Europeis
ka unionen)
Ja, als Teil des Ja, als Teil des
Ja
Prozesses der Überprüfungspro
Mandatsertei zesses
lung
Überwachung von EUAngelegenheiten in ih
rem Themenbereich
Nein
Nein. Sitzun
gen sind in der
Regel nicht öf
fentlich, außer
Sitzungen vor
Treffen des
Europäischen
Rates
Großbritanni
en
− House of
Commons
Europäischer Kon
trollausschuss
(European Scrutiny
Committee)
Ja
fachausschüsse untersu Nein
chen EU-Themen auf ei
genen Initiative.
Nein. Sitzun
gen sind in der
Regel nicht öf
fentlich, wenn
jedoch Anhö
rungen von
Ministern
stattfinden,
sind sie öffent
lich.
Ja, als Teil der re Ja
gulären Überprü
fung der Kom
missionsdokum
ente und legislati
ven Vorschläge
Mitgliedsstaat Bezeichnung des Euro Parlaments
pa-Gremiums*
vorbehalt**
Subsidiaritäts
kontrolle****
Großbritanni EU-Ausschuss
(European Union Com
en
mittee)
− House of
Lords
Ja, als Teil der re Ja
gulären Überprü
fung der Kom
missionsdokum
ente und legislati
ven Vorschläge
Ja
Überwa Einbeziehung
chung der von Fachausschüss
GASP ## en**
Nein
Teilnahme
Öffentlichkeit
von MEPs an der Sitzun
den EU-Aus gen***
schuss-Sit
zungen #
Nein
Die Sitzungen
sind öffentlich,
wenn Anhö
rungen statt
finden. Aber
sie sind ge
schlossen,
wenn sich der
Ausschuss be
rät
***angelehnt an Table 4: Public access to meetings and documents in the national parliaments, in: Third bi-annual Report: Developments in European
Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Luxembourg, May 2005. S. 16.
****angelehnt an Table3: Current systems in national parliament for monitoring the subsidiarity principle, in: Third bi-annual Report: Developments
in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Luxembourg, May 2005. S. 78.
# angelehnt an Table 9: Participation of MEPs in the work of national parliaments, in: Third bi-annual Report: Developments in European Union Pro
cedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Luxembourg, May 2005. S. 99.
## angelehnt an Table 1: Scrutiny of CFSP/ESDP in the national parliaments, in: COSAC: Fourth bi-annual Report: Developments in European Union
Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. London, October 2005a.
Bei freigelassenen Feldern lagen keine Angaben vor.
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
I. Rechtsgrundlagen Deutschland
1. Grundgesetz, Art. 23 und 45
2. Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundes
tag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG)*
3. Vereinbarung zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung
über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union in Aus
führung des § 6 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung
und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union (noch
nicht in Kraft)*
4. Geschäftsordnung des Bundestages, § 93 und 93a
5. Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der
Europäischen Union (EUZBLG)
6. Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder
über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union in Aus
führung von § 9 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern
in Angelegenheiten der Europäischen Union (Bund-Länder-Vereinbarung)
7. Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des
Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 17. November
2005
* nachfolgend abgedruckt
105
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
1. Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundes
tag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG)
Datum: 12. März 1993
Fundstelle: BGBl I 1993, 311
(Stand: Geändert durch Art. 2 Abs. 1 G v. 17.11.2005 I 3178)
EUZBBG Eingangsformel
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
EUZBBG § 1
In Angelegenheiten der Europäischen Union wirkt der Bundestag an der Willensbildung
des Bundes mit.
EUZBBG § 2
Der Bundestag bestellt einen Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union.
Der Bundestag kann den Ausschuss ermächtigen, für ihn Stellungnahmen abzugeben.
EUZBBG § 3
Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag umfassend und zum frühestmöglichen
Zeitpunkt über alle Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union, die für die Bundes
republik Deutschland von Interesse sein könnten.
EUZBBG § 4
Die Bundesregierung übersendet dem Bundestag insbesondere die Entwürfe von Richt
linien und Verordnungen der Europäischen Union und unterrichtet den Bundestag zu
gleich über den wesentlichen Inhalt und die Zielsetzung, über das beim Erlass des ge
planten Rechtsetzungsakts innerhalb der Europäischen Union anzuwendende Verfahren
und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Befassung des Rates, insbesondere den voraus
sichtlichen Zeitpunkt der Beschlussfassung im Rat. Sie unterrichtet den Bundestag un
verzüglich über ihre Willensbildung, über den Verlauf der Beratungen, über die Stel
lungnahmen des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission, über die
Stellungnahmen der anderen Mitgliedstaaten sowie über die getroffenen Entscheidun
gen.
EUZBBG § 5
Die Bundesregierung gibt vor ihrer Zustimmung zu Rechtsetzungsakten der Europäi
schen Union dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Frist zur Stellungnah
me muss so bemessen sein, dass der Bundestag ausreichend Gelegenheit hat, sich mit
der Vorlage zu befassen. Die Bundesregierung legt die Stellungnahme ihren Verhand
lungen zugrunde.
EUZBBG § 6 Bundestag-Bundesregierung-Vereinbarung Einzelheiten der Unterrich
tung und Beteiligung des Bundestages nach diesem Gesetz bleiben einer Vereinbarung
zwischen Bundestag und Bundesregierung vorbehalten.
106
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
EUZBBG § 7
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Gründung der Europäischen Union in Kraft. Die
ser Tag ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. Abweichend von Satz 1 tritt § 6 am
1. Januar 1993 in Kraft.
107
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
2. Vereinbarung zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung
über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union in Ausfüh
rung des § 6 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union
SPD-Bundestagsfraktion
16. Wahlperiode
16/
Beschlussvorlage
Stand 22. Juni 2006
Vereinbarung
zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung über die Zusam
menarbeit in Angelegenheiten der Europäischen Union in Ausführung des § 6 des
Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundes
tag in Angelegenheiten der Europäischen Union
I. Unterrichtung des Bundestages
1. Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag frühzeitig, fortlaufend
und in der Regel schriftlich über alle Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union
(siehe Anlage 1, Liste Vorhaben (S.112)).
Dazu gehört auch die Unterrichtung über die Gemeinsame Außen- und Sicherheits
politik sowie die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Unterrich
tung über Maßnahmen bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit und die
Handelspolitik.
Weiterhin unterrichtet die Bundesregierung im Vorfeld auch über bi- und multilate
rale völkerrechtliche Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Mit
gliedstaaten der Europäischen Union, die eine engere Kooperation in Politikberei
chen normieren, die auch in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen.
Darüber hinaus informiert die Bundesregierung den Deutschen Bundestag über aktu
elle politische Entwicklungen im Rahmen der Europäischen Union, auch im Wege
der politischen Frühwarnung.
2. Dies geschieht gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von
Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen
Union (EUZBBG) insbesondere durch Übersendung von der Bundesregierung vor
liegenden
a) Dokumenten
• der Kommission und ihrer Dienststellen, soweit sie an den Rat gerichtet oder der
Bundesregierung auf sonstige Weise offiziell zugänglich gemacht worden sind.
Das jeweils federführende Ressort in der Bundesregierung trägt dafür Sorge,
dass dem Bundestag auch dem Ressort vorliegende vorbereitende Papiere der
Kommission zur Verfügung gestellt werden, die für die Meinungsbildung des
108
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
Bundestages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für inoffizielle Doku
mente (sog. „non papers“);
• des Europäischen Rates, des Rates, der informellen Ministertreffen und der
Ratsgremien.
b) Berichten und Mitteilungen von Organen der Europäischen Union für und über
Sitzungen
• des Europäischen Rates, des Rates und der informellen Ministertreffen;
• des Ausschusses der Ständigen Vertreter und sonstiger Ausschüsse oder Arbeits
gruppen des Rates;
• der Beratungsgremien bei der Kommission.
c) Berichten der Ständigen Vertretung über
• Sitzungen des Rates und der Arbeitsgruppen des Rates, der informellen Minis
tertreffen und des Ausschusses der Ständigen Vertreter;
• Sitzungen des Europäischen Parlaments und seiner Ausschüsse;
• Entscheidungen der Kommission,
• geplante Rechtsakte,
• Frühwarnberichte (zu geplanten Rechtsakten),
wobei der Deutsche Bundestag für eine vertrauliche Behandlung Sorge trägt.
d) Dokumenten und Informationen über förmliche Initiativen, Stellungnahmen und
Erläuterungen der Bundesregierung für Organe der Europäischen Union, ein
schließlich der Sammelweisung für den AStV und förmliche Initiativen der Regie
rungen anderer Mitgliedstaaten gegenüber Rat und Kommission, die der Bundesre
gierung offiziell zugänglich gemacht werden, wobei der Bundestag für eine ver
trauliche Behandlung sorgt, die dem besonderen Schutzbedürfnis laufender ver
traulicher Verhandlungen Rechnung trägt.
Unter Arbeitsgruppen des Rates fallen insbesondere die Gruppe „Freunde der Präsident
schaft“ sowie die „Antici-Gruppe“, der Koordinierungsausschuss nach Art. 36 EU, der
Ausschuss nach Art. 133 EG und der Sonderausschuss Landwirtschaft.
Über die Sitzungen der Eurogruppe, des Politischen und Sicherheitspolitischen Komi
tees sowie des Wirtschafts- und Finanzausschusses unterrichtet die Bundesregierung die
zuständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages mündlich.
Die Unterrichtung bezieht sich auch auf Vorhaben, die auf Beschlüsse der im Rat verei
nigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten gerichtet sind. Im Übrigen oder
ergänzend erfolgt die Unterrichtung mündlich in ständigen Kontakten.
3. Vor Sitzungen des Europäischen Rates und des Rates erhalten die zuständigen Aus
schüsse des Deutschen Bundestages eine umfassende Unterrichtung. Diese umfasst
zu jedem Beratungsgegenstand die Grundzüge des Sach- und Verhandlungsstandes
sowie der Verhandlungslinie der Bundesregierung. Nach Ratssitzungen unterrichtet
die Bundesregierung über die Ergebnisse.
4. Mit der Unterrichtung gem. § 4 EUZBBG übermittelt die Bundesregierung dem
Deutschen Bundestag die Angaben der Kommission und die ihr vorliegenden Anga
ben der Mitgliedstaaten im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung zu den Folgen
109
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
des Vorhabens insbesondere in rechtlicher, wirtschaftlicher, finanzieller, sozialer und
ökologischer Sicht.
5. Die Bundesregierung übermittelt zu Vorhaben einen Bericht gemäß Anlage 2 (Be
richtsbogen). Bei Rechtsetzungsakten übermittelt sie zudem eine umfassende Bewer
tung. Diese Bewertung wird auf der Grundlage der der Bundesregierung zur Verfü
gung stehenden Informationen erstellt. Neben der Prüfung der Zuständigkeit der Eu
ropäischen Union zum Erlass des vorgeschlagenen Rechtsetzungsaktes sowie der Be
achtung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips enthält diese Bewer
tung im Rahmen einer umfassenden Abschätzung der Folgen für die Bundesrepublik
Deutschland Aussagen insbesondere in rechtlicher, wirtschaftlicher, finanzieller, so
zialer und ökologischer Sicht zu Regelungsinhalt, Alternativen, Kosten, Verwal
tungsaufwand und Umsetzungsbedarf. Bei Vorhaben, die Rechtsetzungsakte vorbe
reiten, und sonstigen Vorhaben erfolgt die Bewertung auf Anforderung des Deut
schen Bundestages.
Der Berichtsbogen ist binnen 10 Arbeitstagen nach Übermittlung des Vorhabens zu
übersenden, die umfassende Bewertung spätestens bis zu Beginn der Beratungen in
Ratsgremien. Bei eilbedürftigen Vorlagen verkürzen sich die Fristen so, dass eine
rechtzeitige Unterrichtung und die Gelegenheit zur Stellungnahme für den Deutschen
Bundestag gewährleistet sind. Bei einem Vorhaben, das eine besonders umfangrei
che Bewertung erforderlich macht, kann die Frist mit Zustimmung des Deutschen
Bundestages verlängert werden.
6. Die Bundesregierung übersendet die Unterlagen dem Deutschen Bundestag zum frü
hestmöglichen Zeitpunkt und auf dem kürzesten Weg.
7. Die Ministerien des Bundes eröffnen dem Deutschen Bundestag im Rahmen der gel
tenden Datenschutzvorschriften Zugang zu Datenbanken zu Vorhaben im Rahmen
der Europäischen Union. Die Bundesregierung eröffnet dem Deutschen Bundestag
auch den Zugang zu EU-Datenbanken, die den Regierungen der Mitgliedstaaten zu
gänglich sind.
8. a) Über nicht unter Nr. 1 fallende Maßnahmen von grundsätzlicher Bedeutung oder
erheblicher Auswirkung auf die Interessen der Bundesrepublik Deutschland unter
richtet die Bundesregierung den Deutschen Bundestag.
b) Dabei werden in diese Unterrichtung auch Informationen über eigene Initiativen,
Initiativen aus den Bundesländern und des Bundesrates sowie Initiativen von Mit
gliedstaaten, die für die Willensbildung des befassten Organs der Europäischen
Union entscheidungsfördernd sind, einbezogen.
9. Die Bundesregierung hat eine geeignete politische Vertretung in den Ausschüssen
des Deutschen Bundestages sicherzustellen.
II. Stellungnahme des Deutschen Bundestages
1. Die Bundesregierung gibt dem Deutschen Bundestag in einem frühen Verhandlungs
stadium Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Frist zur Stellungnahme muss so be
messen sein, dass der Deutsche Bundestag ausreichend Gelegenheit hat, sich mit der
Vorlage zu befassen. Je nach Verhandlungslage teilt die Bundesregierung dem Deut
110
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
schen Bundestag auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt eine Stellungnahme wegen der
sich aus dem Verfahrensablauf der Europäischen Union ergebenden zeitlichen Vor
gaben noch berücksichtigt werden kann.
2. Die Bundesregierung legt die Stellungnahme des Deutschen Bundestages ihren Ver
handlungen zugrunde.
3. Der Deutsche Bundestag kann seine Stellungnahme im Verlauf der Beratung des
Vorhabens in den Gremien der Europäischen Union anpassen und ergänzen. Zu die
sem Zweck unterrichtet die Bundesregierung den Deutschen Bundestag durch ständi
ge Kontakte über wesentliche Änderungen bei diesen Vorhaben.
4. Macht der Deutsche Bundestag von der Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß Arti
kel 23 Absatz 3 Satz 1 GG Gebrauch, wird die Bundesregierung im Rat einen Parla
mentsvorbehalt einlegen, wenn der Beschluss des Deutschen Bundestages in einem
seiner wesentlichen Belange nicht durchsetzbar ist. Vor der abschließenden Ent
scheidung im Rat bemüht sich die Bundesregierung, Einvernehmen mit dem Deut
schen Bundestag herzustellen. Das Recht der Bundesregierung, in Kenntnis der Vo
ten des Deutschen Bundestages aus wichtigen außen- oder integrationspolitischen
Gründen abweichende Entscheidungen zu treffen, bleibt hiervon unberührt.
5. Nach der Beschlussfassung im Rat unterrichtet die Bundesregierung den Deutschen
Bundestag unverzüglich, insbesondere über die Durchsetzung seiner Stellungnahme.
Sollten nicht alle Belange der Stellungnahme berücksichtigt worden sein, so legt die
Bundesregierung die Gründe hierfür dar. Die Unterrichtung hat auch zu erfolgen,
wenn die Beschlussfassung im Rat nicht zum Abschluss des Verfahrens führt.
III. Information über europäische Rechtsakte
Nach Erlass eines europäischen Rechtsaktes unterrichtet die Bundesregierung den Deut
schen Bundestag hierüber. Bei Richtlinien und Rahmenbeschlüssen informiert die Bun
desregierung über die zu berücksichtigenden Fristen für die innerstaatliche Umsetzung
und den Umsetzungsbedarf.
IV. Verfahren vor den Europäischen Gerichten
Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag unverzüglich über Vor
abentscheidungsverfahren und Gutachtenverfahren und diejenigen Verfahren vor dem
Europäischen Gerichtshof und dem Gericht Erster Instanz, bei denen die Bundesrepu
blik Deutschland Verfahrensbeteiligte ist. Zu Verfahren, an denen sich die Bundesregie
rung beteiligt, übermittelt sie die entsprechenden Dokumente. Dies gilt auch für Urteile
zu Verfahren, an denen sich die Bundesregierung beteiligt.
V. Übergang zu Mehrheitsentscheidungen
Beabsichtigt der Rat, einen Beschluss zum Übergang von der Einstimmigkeit zu Mehr
heitsentscheidungen zu fassen, informiert die Bundesregierung den Deutschen Bundes
tag und unterrichtet über ihre Willensbildung. Der Vorschlag oder die Initiative für die
sen Beschluss ist ein Vorhaben im Sinne dieser Vereinbarung.
111
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
VI. Beitritt und Vertragsrevision
Beabsichtigt der Rat, einen Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen zur Vorberei
tung von Beitritten zur Europäischen Union sowie zur Aufnahme von Verhandlungen
zu Änderungen der vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union zu fassen, infor
miert die Bundesregierung den Deutschen Bundestag und unterrichtet über ihre Wil
lensbildung. Diese Verhandlungen sind Vorhaben im Sinne dieser Vereinbarung.
Vor der abschließenden Entscheidung im Rat bemüht sich die Bundesregierung, Einver
nehmen mit dem Deutschen Bundestag herzustellen. Das Recht der Bundesregierung, in
Kenntnis der Voten des Deutschen Bundestages aus wichtigen außen- oder integrations
politischen Gründen abweichende Entscheidungen zu treffen, bleibt hiervon unberührt.
VII. Zusammenarbeit zwischen Ständiger Vertretung und Verbindungsbüro des
Deutschen Bundestages
Die Bundesregierung unterstützt über die Ständige Vertretung und gegebenenfalls die
bilaterale Botschaft im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und soweit erforderlich
das Büro des Deutschen Bundestages in Einzelfragen im Hinblick auf seine Aufgaben.
VIII. Vertraulichkeit
Die Unterlagen der Europäischen Union werden im Allgemeinen offen weitergegeben.
Mitteilungen der EU-Organe über eine besondere Vertraulichkeit werden vom Deut
schen Bundestag beachtet. Eine für diese Unterlagen oder für andere im Rahmen dieser
Vereinbarung an den Deutschen Bundestag zu übermittelnde Dokumente eventuell er
forderliche nationale VS-Einstufung wird vor Versendung von der Bundesregierung
vorgenommen. Die Gründe für die Einstufung sind auf Anforderung zu erläutern.
IX. Schlussbestimmungen
Der Deutsche Bundestag kann auf die Übersendung von oder Unterrichtung zu Vorha
ben verzichten. Der Verzicht kann nicht gegen den Widerspruch einer Fraktion oder
fünf Prozent der Mitglieder des Bundestages erklärt werden.
Anlage 1 (Liste Vorhaben)
Außer den in I.2 Buchstabe d letzter Absatz, V. und VI. der Vereinbarung genannten
Vorhaben sind Vorhaben im Sinn der Vereinbarung:
Vorschläge für Rechtsetzung in der 1. Säule (einschließlich geänderter Vor
schläge)
Mitteilungen/Stellungnahmen der KOM
Berichte
Aktionspläne
Grünbücher
Weißbücher
Politische Programme
Vorschläge für Rechtsetzung in der 3. Säule (einschließlich geänderter Vor
schläge)
Empfehlungen
Institutionelle Vereinbarungen
112
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
-
EU-Haushalt und Finanzplanung
Anlage 2 (Berichtsbogen)
Thema:
Sachgebiet:
Rats-Dok.-Nr.:
KOM.-Nr.:
EP-Nr.:
BRat-Nr.:
Nachweis der Zulässigkeit für europäische Regelungen:
(Prüfung der Rechtsgrundlage)
Nachweis der Notwendigkeit für europäische Regelungen:
(Subsidiaritätsprüfung)
Zielsetzung:
Inhaltliche Schwerpunkte:
Politische Bedeutung:
Was ist das besondere deutsche Interesse?
Bisherige Position des Bundestages:
Position des Bundesrates:
Position des EP:
Meinungsstand im Rat:
Verfahrensstand (Stand der Befassung):
finanzielle Auswirkungen:
Zeitplan für die Behandlung im
a) Deutschen Bundestag:
entsprechend Art. 23 GG und dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregie
rung und Deutschem Bundestag im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi
schen Union
b) Bundesrat:
c) EP:
d) Rat:
113
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
II. Rechtsgrundlagen der Europa-Gremien
der Parlamente in Frankreich, Tschechien und Polen
1. Frankreich:
− Französische Verfassung, Art 88-4
− Gesetz vom 6. Juli 1979 (Nr. 79-564), erweitert durch die Gesetze vom 10. Mai 1990
(Nr. 90-385) und 10. Juli 1994 (Nr. 94-476)
2. Polen:
− Artikel 110 der Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997
− Gesetz vom 11.03.2004 über die Zusammenarbeit des polnischen Ministerrates mit
dem Sejm und dem Senat in Angelegenheiten bezüglich der Mitgliedschaft Polens in
der Europäischen Union. In: Dziennik Ustaw 2004, Nr. 52, item 515.(geändert durch
Gesetz vom 28. Juli 2005 zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit des
polnischen Ministerrates mit dem Sejm und dem Senat in Angelegenheiten bezüglich
der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union. in: Dziennik Ustaw 2005, Nr.
160, item 1342.)(englisch)*
− Geschäftsordnung des Sejm der Republik Polen: Official Journal – Monitor Polski
2002, No. 23, item 398 – with changes.
− Geschäftsordnung des Senats
3. Tschechien:
− Artikel 10b der Verfassung der Tschechischen Republik
− Gesetz vom 7. Mai 2004 zur Änderung der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkam
mer Tschechiens
− Geschäftsordnung des Senat Tschechiens
* nachfolgend abgedruckt
114
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
Gesetz vom 11.03.2004 über die Zusammenarbeit des polnischen Ministerrates mit
dem Sejm und dem Senat in Angelegenheiten bezüglich der Mitgliedschaft Polens
in der Europäischen Union (Dziennik Ustaw (Journal of Laws), No. 52, item 515)
The ACT
on Cooperation of 11 March 2004 of the Council of Ministers
with the Sejm and the Senate in Matters Related to the Republic of Poland’s
Membership in the European Union with amendments
Chapter 1
General Provisions
Article 1.
This Act sets out the principles for the Council of Ministers’ cooperation with the Sejm
and the Senate in matters related to the Republic of Poland’s membership in the Euro
pean Union.
Article 2.
The Council of Ministers is obliged to cooperate with the Sejm and the Senate in mat
ters referred to in Article 1.
Article 3.
1. At least once every six months, the Council of Ministers shall present the Sejm and
the Senate with information about the Republic of Poland’s participation in the activi
ties of the European Union.
2. At the request of the Sejm, the Senate, a body competent under the rules of procedure
of the Sejm or a body competent under the rules of procedure of the Senate, The
Council of Ministers shall present – respectively – to the Sejm or the Senate, informa
tion on any matter related to the Republic of Poland’s membership in the European
Union.
Chapter 2
Cooperation in the making of European Union law
Article 4.
The Council of Ministers shall deliver to the Sejm and the Senate, immediately upon re
ceipt thereof, documents of the European Union, subject to consultation with Member
States, in particular White Papers, Green Papers and Communications of the European
Commission, as well as evaluations thereof made by competent institutions or other bo
dies of the European Union.
Article 5.
The Council of Ministers shall deliver to the Sejm and the Senate, immediately upon re
ceipt thereof, operational programmes of activities of the Council of the European Uni
on, the European Commission’s annual legislative plans and evaluations of annual le
gislative plans made by the European Parliament and the Council of the European Uni
on.
115
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
Article 6.
1. The Council of Ministers shall deliver to the Sejm and the Senate:
(1) legislative proposals of the European Union immediately upon receipt thereof;
(2) the Council of Ministers’ draft positions, referred to in subparagraph 1, taking into
consideration time limits under European Union law, but no later than within 14 days
of the date the proposals, referred to in subparagraph 1, were received.
2. The Council of Ministers shall append to its draft position, referred to in paragraph 1
subparagraph 2:
(1) a substantiation thereof, including an evaluation of the anticipated legal conse
quences of the legislative act of the European Union for the Polish legal system as
well as its social, economic and financial consequences for the Republic of Poland;
(2) information on the kind of the procedure concerning the adoption of a legislative act
of the European Union as specified in the provisions of the Treaty establishing the
European Community and the procedure for voting within the Council of the Euro
pean Union.
3. The organ competent under the rules of procedure of the Sejm, and the organ compe
tent under the rules of procedure of the Senate, may express its opinion on legislative
proposals of the European Union within 21 days of date the Council of Ministers’
draft position was delivered.
4. If the time limit specified by the European Commission for expressing an opinion is
less than 42 days, the Council of Ministers shall present a legislative proposal of the
European Union, along with the Council of Ministers’ draft position immediately, so
that the organ competent under the rules of procedure of the Sejm and the organ com
petent under the rules of procedure of the Senate has at least 2/3 of the time limit,
specified by the European Commission for the Member States of the European Uni
on, for expressing its opinion.
5. Failure to express an opinion within the time limit referred to in paragraphs 3 or 4,
shall be deemed as an absence of comments to the proposal.
Article 7.
The Council of Ministers shall deliver to the Sejm and the Senate, immediately upon re
ceipt thereof:
(1) draft international agreements to which the European Union, the European Commu
nities or their Member States are to be the parties;
(2) draft decisions of representatives of the governments of the Member States, assemb
led in the Council of the European Union;
(3) draft acts of the European Union having no legal effect, particularly proposals of
guidelines for the economic and monetary union as well as employment;
(4) European Union acts bearing significance on the interpretation or application of Eu
ropean Union law.
Article 8.
(1) The Council of Ministers shall inform the Sejm and the Senate, in writing, about the
progress achieved in the process of making EU law and the positions taken by the
116
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
Council of Ministers in this process.
(2) The organ competent under the rules of procedure of the Sejm and the organ compe
tent under the rules of procedure of the Senate may express their opinions on positi
ons of the Council of Ministers, referred to in paragraph 1, within 21 days following
the delivery of those positions
Article 9.
1. Prior to considering a legislative proposal in the Council of the European Union, the
Council of Ministers shall seek the opinion of the organ competent under the rules of
procedure of the Sejm and the opinion of the organ competent under the rules of pro
cedure of the Senate, and shall present written information on the position the Council
of Ministers intends to take during the consideration of the proposal in the Council of
the European Union.
2. The Council of Ministers shall append, to the information referred to in paragraph 1,
a substantiation of its position and an evaluation of the anticipated legal consequences
of a given legislative act for the Polish legal system as well as its social, economic and
financial consequences for the Republic of Poland.
3. Due to the work organisation of the European Union bodies, with the exception of
matters in which the Council acts unanimously and matters which substantially burden
the State budget, the Council of Ministers may take a position without seeking opini
ons referred to in paragraph 1. In such a case, a member of the Council of Ministers
shall be obliged to present to the organ competent under the rules of procedure of the
Sejm and to the organ competent under the rules of procedure of the Senate the positi
on taken and to explain the reasons for failing to seek opinions.
Article 9a.
1. Prior to the meeting of the Council of the European Union, the Council of Ministers
shall deliver the agenda of that meeting to the organ competent under the rules of pro
cedure of the Sejm and to the organ competent under the rules of procedure of the Se
nate.
2. After the meeting of the Council of the European Union, the Council of Ministers
shall immediately deliver the report of the meeting of the Council to the organ compe
tent under the rules of procedure of the Sejm and to the organ competent under the ru
les of procedure of the Senate.
Article 10.
1. If the organ competent under the rules of procedure of the Sejm has taken a decision
on a matter referred to in Article 6 paragraph 3, Article 8 paragraph 2 or Article 9 pa
ragraph 1, such decision should constitute the basis for the Council of Ministers’ posi
tion.
2. In the event that the Council of Ministers’ position, referred to in paragraph 1, does
not take into consideration the opinion of the organ competent under the rules of pro
cedure of the Sejm, a member of the Council of Ministers shall be obliged to explain
to the organ competent under the rules of procedure of the Sejm the reasons for such
discrepancy.
117
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
Chapter 3
Cooperation in the making of Polish law implementing European Union law
Article 11.
1. The Council of Ministers shall submit to the Sejm a bill implementing European Uni
on law no later than three months before the expiration of the time limit for implemen
tation under EU law.
2. If the time limit for implementation, referred to in paragraph 1, exceeds six months,
the Council of Ministers shall submit to the Sejm a bill implementing European Union
law no later than five months before the expiration of this time limit.
3. In exceptionally justified cases, the Council of Ministers may, upon seeking an opini
on from the organ competent under the rules of procedure of the Sejm, submit a bill
implementing European Union law without observing the time limits referred to in pa
ragraphs 1 or 2.
Chapter 4
Cooperation in expressing opinion on candidates for certain posts in the European
Union
Article 12.
The organ competent under the rules of procedure of the Sejm shall express its opinion
on candidatures to the following posts:
(1) a member of the European Commission;
(2) a member of the Court of Auditors;
(3) a judge of the European Court of Justice and the Court of First Instance;
(4) an advocate general of the European Court of Justice;
(5) a member of the Economic and Social Committee;
(6) a member of the Committee of the Regions;
(7) a director in the European Investment Bank;
(8) a representative of the Republic of Poland to the Committee of Permanent Represen
tatives of the European Union.
Article 13.
1. The Council of Ministers shall present proposed candidatures for the posts referred to
in Article 11, taking into consideration time limits under EU law.
2. The organ competent under the rules of procedure of the Sejm may express its opini
on within 21 days of the day the Council of Ministers presented its proposed candida
tures.
3. The Council of Ministers shall not designate any candidates for the posts referred to
in Article 12 before the expiration of the time limit for expressing an opinion by the
organ competent under the rules of procedure of the Sejm, unless an opinion on this
matter has been expressed beforehand.
Chapter 5
The final provision
Article 14.
This Act shall enter into force on 31 March 2004.
118
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
III. Rechtsgrundlagen auf europäischer Ebene
1. Erklärungen 13 und 14 in der Schlussakte zum Vertrag über die Europäische Union,
unterzeichnet am 7. Februar 1992. Amtsblatt Nr. C 191 vom 29. Juli 1992. (Vertrag
von Maastricht)
2. Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente zum Vertrag von Amsterdam zur
Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften*
3. Erklärung zur Zukunft Europas zum Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrages
über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemein
schaften
4. Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union, Proto
koll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßig
keit zum Vertrag über eine Verfassung für Europa
5. Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
6. Geschäftsordnung der COSAC*
7. „Kopenhagener Parlamentarische Leitlinien“ – Leitlinien für die Beziehungen zwi
schen Regierungen und Parlamenten bei Gemeinschaftsangelegenheiten (wünschens
werte Mindeststandards)
* nachfolgend abgedruckt
119
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 56
Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente zum Vertrag von Amsterdam
zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender
Rechtsakte
Protokolle
− Protokolle über die Europäische Union und zu den Vertragen zur Gründung der Euro
päische Gemeinschaft, der Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der
Europäische Atomgemeinschaft
− Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union
Amtsblatt Nr. C 340 vom 10/11/1997 S. 0113
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN EINGEDENK dessen, dass die Kontrolle der jeweiligen Regierungen durch die einzel
staatlichen Parlamente hinsichtlich der Tätigkeiten der Union Sache der besonderen
verfassungsrechtlichen Gestaltung und Praxis jedes Mitgliedstaats ist,
IN DEM WUNSCH jedoch, eine stärkere Beteiligung der einzelstaatlichen Parlamente
an den Tätigkeiten der Europäischen Union zu fördern und ihnen bessere Möglichkeiten
zu geben, sich zu Fragen, die für sie von besonderem Interesse sein können, zu äußern SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die
Europäische Union und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
beigefügt sind:
I. UNTERRICHTUNG DER PARLAMENTE DER MITGLIEDSTAATEN
1. Alle Konsultationsdokumente der Kommission (Grün- und Weißbücher sowie Mittei
lungen) werden den Parlamenten der Mitgliedstaaten unverzüglich zugeleitet.
2. Die Vorschläge der Kommission für Akte der Gesetzgebung, wie sie vom Rat nach
Artikel 151 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
festgelegt werden, werden rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so dass die Regierung
jedes Mitgliedstaats dafür Sorge tragen kann, dass ihr einzelstaatliches Parlament sie
gegebenenfalls erhält.
3. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Vorschlag für einen Rechtsakt oder ein Vor
schlag für eine Maßnahme nach Titel VI des Vertrags über die Europäische Union
dem Europäischen Parlament und dem Rat in allen Sprachen von der Kommission
unterbreitet wird, und dem Zeitpunkt, zu dem er zur Beschlussfassung entweder zur
Annahme als Rechtsakt oder zur Festlegung eines gemeinsamen Standpunkts nach
Artikel 189 b oder Artikel 189 c des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft auf die Tagesordnung des Rates gesetzt wird, liegt ein Zeitraum von sechs
Wochen, außer in dringenden Fällen, die in dem Rechtsakt oder gemeinsamen Stand
punkt zu begründen sind.
120
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
II. KONFERENZ DER EUROPA-AUSSCHÜSSE
4. Die am 16./17. November 1989 in Paris gegründete Konferenz der Europa-Ausschüs
se, im folgenden als "COSAC" bezeichnet, kann jeden ihr zweckmäßig erscheinenden
Beitrag für die Organe der Europäischen Union leisten, und zwar insbesondere auf
der Grundlage von Entwürfen für Rechtstexte, deren Übermittlung an die COSAC
von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten in Anbetracht der behandelten
Frage gegebenenfalls einvernehmlich beschlossen wird.
5. Die COSAC kann Vorschläge oder Initiativen im Zusammenhang mit der Errichtung
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts prüfen, die möglicherweise
unmittelbare Auswirkungen auf die Rechte und Freiheiten des einzelnen nach sich
ziehen. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden über die
von der COSAC nach dieser Nummer geleisteten Beiträge unterrichtet.
6. Die COSAC kann dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission jeden
ihr zweckmäßig erscheinenden Beitrag über die Gesetzgebungstätigkeiten der Union,
insbesondere hinsichtlich der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, des Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sowie der die Grundrechte betreffenden Fra
gen vorlegen.
7. Die Beiträge der COSAC binden in keiner Weise die einzelstaatlichen Parlamente
und präjudizieren in keiner Weise deren Standpunkt.
121
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
Geschäftsordnung der COSAC
123
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
124
C) Überblick über die Rechtsgrundlagen
125
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
126
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abl. EG/EU
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften/ der Europäischen Union
Abs.
Absatz
Art.
Artikel
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
COSAC
Conférence des Organes Spécialisés en Affaires Communautaires et Europée
nes des Parlements de l'Union européenne (Konferenz der Europaausschüsse
der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Par
laments)
COX
Cooperation and Exchange Programme (Austauschprogramm zwischen dem
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaa
ten)
EAGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
ECPRD
European Center for Parliamentary Research and Documentation (Europäi
sches Zentrum für parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation)
EG
Europäische Gemeinschaft
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
EP
Europäisches Parlament
EU
Europäische Union
EUV
Vertrag über die Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EUZBLG
Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in den Angelegenhei
ten der Europäischen Union
EUZBBG
Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bun
destag in Angelegenheiten der Europäischen Union
GASP
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
GG
Grundgesetz
GO-BT
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages
IPEX
Interparliamentary EU Information Exchange (Arbeitsgruppe für interparla
mentarische EU Information)
IPU
Interparlamentarische Union
MdB
Mitglied des Deutschen Bundestages
MEP
Mitglied(er) des Europäischen Parlaments
OSZE
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
PJZS
Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
WEU
Westeuropäische Union
WP
Wahlperiode
127
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Literatur- und Quellenverzeichnis
Literatur
Assemblée Nationale: Die Delegation der Nationalversammlung für die Europäische
Union. Paris, November 2003.
BARRAU, ALAIN Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires
(COSAC). Une expression collective des parlements nationaux sur les questions
européennes. Rapport d’information déposé par la Délégation de l'Assemblée
Nationale pour l’Union Européenne (1), sur la XXIIIème Conférence des Organes
Spécialisés dans les Affaires Communautaires des Parlements de l’Union Européenne
(COSAC), tenue à Versailles les 16 et 17 octobre 2000, et présenté par MM. Alain
Barrau, Député. Paris 2000.
Conference of Speakers of National Parliaments: What is the Speakers Conference?
[http://www.eu-speakers.org/en/about/; Zugriff am 17.6.2006].
Conference of Speakers of National Parliaments: Calendar.
[http://www.eu-speakers.org/en/calendar; Zugriff am 17.6.2006].
COSAC: Fifth bi-annual Report: Developments in EuropeanUnion Procedures and
Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Vienna, May 2006.
COSAC: Fourth bi-annual Report: Developments in European Union Procedures and
Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. London, October 2005a.
COSAC: Third bi-annual Report: Developments in European Union Procedures and
Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. Luxembourg, May 2005b.
COSAC: Second bi-annual Report: Developments in European Union Procedures and
Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny. The Hague. November 2004a.
COSAC: Report on Developments in European Union Procedures and Practices Rele
vant to Parliamentary Scrutiny. Dublin, May 2004b.
COSTA, OLIVIER / LATEK, MARTA Paradoxes et Limites de la Coopération Interparlemen
taire dans l’Union Européenne, in: European Integration, 23, 2001, S. 139–164.
National Parliaments in an Integrated Europe. An Anglo-German Per
spective. The Hague 2001.
CYGAN, ADAM JAN
D'ESTAING,
GISCARD Europas letzte Chance, in: Süddeutsche Zeitung, 23. Juli 2002, S. 9.
Deutscher Bundestag: Ausschüsse. Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi
schen Union. Aufgaben und Arbeit. Berlin 2006a.
[http://www.bundestag.de/ausschuesse/a21/aufgaben.html; Zugriff am 03.08.2006].
Deutscher Bundestag: Ausschüsse. Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi
schen Union. Aufgaben des Sekretariats und des Europabüros. Berlin 2006.
[http://www.bundestag.de/ausschuesse/a21/darstellung.html; Zugriff am 03.08.2006].
Deutscher Bundestag: Ausschüsse. Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi
schen Union. Grußwort des Vorsitzenden. Berlin 2006c.
[http://www.bundestag.de/ausschuesse/a21/grusswort.html; Zugriff am 03.08.2006].
128
Literatur
Deutscher Bundestag: Deutscher Bundestag stärkt Europatauglichkeit. Pressemitteilung
vom 22.06.2006.
[http://www.bundestag.de/aktuell/presse/2006/pz_0606223.html].
Deutscher Bundestag: Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.
Aufgaben und Arbeit. Berlin 2004/2005.
Deutscher Bundestag: Europäisches Forum des Informationsaustausches. Kurzbericht
zur XX. COSAC im Berliner Reichstagsgebäude. Berlin 1999.
Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union:
COSAC – Die Konferenz der Europaausschüsse im Wandel. Texte und Materialien.
Berlin 2003a.
Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union: Eu
ropaausschuss 1998 bis 2002. Der Europaausschuss in der 14. Wahlperiode des Deut
sches Bundestages (1998–2002). Berlin, August 2002a.
Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union: Eu
ropaausschuss 2001. Berlin 2002b.
Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union:
Gemeinsame Sitzung des Europaausschusses mit dem Ausschuss für auswärtige An
gelegenheiten und europäische Integration des polnischen Sejm am 16. Mai 2001 in
Slubice. Berlin 2001a.
Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union: Eu
ropaausschuss 2000. Berlin 2001b.
Deutscher Bundestag / Fuchs, Michael: Ausschuss für die Angelegenheiten der Euro
päischen Union. Parlamentarische Behandlung der Europapolitik. Berlin, 2002.
Deutscher Bundestag / Sekretariat des Ausschusses für die Angelegenheiten der Euro
päischen Union: Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union des
Deutschen Bundestages. 2. Auflage, Bonn 1998.
Deutscher Bundestag / Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: Der Ak
tuelle Begriff. Behandlung von Unionsvorlagen im Deutschen Bundestag. Nr. 01/05,
Berlin 22.12.2004.
Deutscher Bundestag / Wissenschaftlicher Dienst/ Schoof, Eberhard: Konferenz der Eu
ropaausschüsse – COSAC. Berlin 1999.
Deutscher Bundesrat: Ausschuss für Fragen der Europäischen Union. Berlin 2006a.
[http://www.bundesrat.de/cln_050/nn_9028/DE/organe-mitglieder/ausschuesse/eu/eunode.html_nnn=tru; Zugriff am 9.7.2006].
Deutscher Bundesrat: Ausschuss für die Fragen der Europäischen Union. Aufgaben.
Berlin 2006b.
[http://www.bundesrat.de/cln_050/nn_9076/DE/organe-mitglieder/ausschuesse/eu/euinhalt.html; Zugriff am 9.7.2006]
129
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Deutscher Bundesrat: COSAC. Konferenz der Europaausschüsse der Parlamente der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments. Berlin
2006c.
[http://www.bundesrat.de/Site/Inhalt/DE/5_20Europa-Internationales/5.4_20Parla
mentarische_20Beziehungen/5.4.1_20Gremien_20und_20Konferenzen/5.4.1.4__CO
SAC/HI/COSAC,templateId=renderUnterseiteKomplett.html; Zugriff 08.05.2006].
Deutscher Bundesrat: Parlamentarische Beziehungen. Berlin 2006d.
[http://www.bundesrat.de/Site/Inhalt/DE/5_20Europa-Internationales/5.4_20Parla
mentarische_20Beziehungen/5.4.1_20Gremien_20und_20Konferenzen/5.4.1.2_PKK/
HI/Parlamentspräsidentenkonferenz,templateId=renderUnterseiteKomplett.html; Zu
griff 8.5.2006].
Deutscher Bundesrat: Europakammer. Berlin 2006e. [http://www.bundesrat.de/cln_050/
nn_8330/DE/organe-mitglieder/europakammer/europakammer-node.html_nnn=true;
Zugriff am 9.7.2006].
Deutscher Bundesrat: Bundesrat begrüßt stärkere Einbindung der nationalen Parlamen
te. Pressemitteilung vom 7.7.2006.
[http://www.bundesrat.de/cln_050/nn_6898/DE/presse/pm/2006/093-2006.html_nnn=
true; Zugriff am 9.7.2006].
DIERINGER, JÜRGEN / STUCHLIK, ANDREJ Die Europäisierung der Parlamentsarbeit in Ungarn
und der Tschechischen Republik. Nationale Parlamente als Mitläufer oder Gestalter
des Integrationsprozesses? 2004.
ECPRD: About us. 2006.
[http://www.ecprd.org/Public/aboutus.asp, Zugriff am 19.7.2006].
Europäische Kommission: Das Arbeitsprogramm der Kommission. Brüssel 2006
[http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_de.htm; Zugriff am 24.5.2006].
Europäisches Parlament: Die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten der Mitglied
staaten.
[http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=58&page
Rank=1&language=de; Zugriff am 20.6.2006].
Europäisches Parlament: Beziehungen zu den nationalen Parlamenten. Aufgabenbe
schreibung der Direktion.
[http://www.europarl.europa.eu/natparl/mission_statement_de.htm; Zugriff am
20.6.2006].
European Parliament: Relations with national parliaments. Joint parliamentary mee
tings.
[http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/10; Zugriff 20.6.2006].
European Parliament: Relations with national parliaments. Joint committee meetings.
[http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/11; Zugriff am 20.6.2006].
European Parliament: Relations with national parliaments. Cooperation and Exchange
Programme.
[http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/13; Zugriff am 20.6.2006].
130
Literatur
European Parliament: Relations with national parliaments. Contact a national parlia
ment. [http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/18/cache/offonce; Zu
griff am 20.6.2006].
European Parliament / Committee on Economic and Monetary Affairs: Interparliamen
tary debate with National Parliaments: How to raise growth in the Euro area? 20.–21.
February 2006. Brussels.
FABIUS, LAURENT Les Parlements Eurpéens dans la Perspective de l'Europe de 1993, le
Traitement des Affaires coummunautaires et la Collaboration entre les Chambres. Ma
drid, Mai 1989.
FISCHER, JOSEPH Vom Staatenbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der Eu
ropäischen Integration. Vortrag an der Humboldt-Universität zu Berlin am 12. Mai
2000.
[http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/2000/000 512EuropaeischeIntegration.html; Zugriff am 12.06.2006]
FRAGA, ANA After the Convention: The Future Role of National Parliaments in the
European Union (And the day after ... nothing will happen), in: Journal of Legislative
Studies, Vol. 11, Nr. 3–4, October/ December 2005, S. 490–507.
Bundestag pocht auf Mitwirkung die EU-Beschlüssen, in: Frankfurter Allgemeine Zei
tung vom 14.06.2006.
FUCHS, MICHAEL Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union des
Deutschen Bundestages, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 35, 2004, Heft 1. S. 3–
24.
FUCHS, MICHAEL Art.23 GG in der Bewährung – Anmerkungen aus der Praxis, in: Die
Öffentliche Verwaltung, 2001, Heft 6, S. 233–240.
GRUNERT, THOMAS Die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den na
tionalen Parlamenten – auf dem Wege zu einer neuen Partnerschaft?, in: Busek, Er
hard / Hummer, Waldemar (Hg.): Etappen auf dem Weg zu einer europäischen Ver
fassung. Wien u.a. 2004, S. 395–430.
HÖLSCHEIDT, SVEN Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten
der Europäischen Union, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzei
tung „Das Parlament“, 2000, Nr. 28, S. 31 ff.
HOURQUEBIE, FABRICE Les Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires des
Parlements Nationaux. Les cas français et allemands. Paris 1999.
House of Lords: Briefing. Scrutinising European Legislation – The European Union
Committee. London 2005.
HUBER, PETER M. Die Rolle der nationalen Parlamente bei der Rechtssetzung der Euro
päischen Union. Zur Sicherung und zum Ausbau der Mitwirkungsrechte des Deut
schen Bundestages. München 2001. = aktuelle analysen / Akademie für Politik und
Zeitgeschehen, Hanns Seidel Stiftung, Nr. 24.
IPEX: IPEX Informs. IPEX – A Presentation. Factsheet Nr. 1. January 2006.
[http://www.eu-speakers.org/upload/application/pdf/5a86db2f/ipex%20informs%20
fakta%20nr%201.pdf, Zugriff am 3.6.2006].
131
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
JANOWSKI, CORDULA AGNES Die nationalen Parlamente und ihre Europa-Gremien. Legiti
mationsgarant der EU? Baden-Baden 2005.
KABEL, RUDOLF Die Mitwirkung des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der Eu
ropäischen Union. Gedanken zur Umsetzung der Art. 23 und 45 GG in die Geschäfts
ordnung des Deutschen Bundestages, in: Randelhofer, Albrecht / Scholz, Rupert /
Wilke, Dieter: Gedächtnisschrift für Eberhard Grabitz. München 1995, S. 241–270.
KAMANN, HANS-GEORG Die Mitwirkung der Parlamente der Mitgliedstaaten an der euro
päischen Gesetzgebung. National-parlamentarische Beeinflussung und Kontrolle der
Regierungsvertreter im Rat der Europäischen Union im Spannungsfeld von Demokra
tie und Funktionsfähigkeit des gemeinschaftlichen Entscheidungsverfahrens. Frank
furt a.M. 1997.
KIETZ, DANIELA Der Bundestag in der Europapolitik. Bestehende Potentiale und vom
Verfassungsvertrag eröffnete Möglichkeiten besser nutzen. SWP-Aktuell 19, Mai
2005.
LEONARDY, UWE Bundestag und Europäische Gemeinschaft: Notwendigkeit und Umfeld
eines Europa-Ausschusses, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 20, 1989. Heft 4.
LIGOT, MAURICE / CATALA, NICOLE / HOGUET, PATRICK Les Parlements nationaux dans
l’Union européenne: acteurs ou spectateurs? Rapport d’information déposé par la
Délégation de l'Assemblée Nationale pour l’Union Européenne (1), sur la XIVème
Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires (COSAC),
tenue à Rome les 23 et 24 juin 1996, et présenté par M. Maurice Ligot, Mme Nicole
Catala et M. Patrick Hoguet, Députés. Paris 1996.
MAURER, ANDREAS Mehrebenenparlamentarismus: Das Europäische Parlament und die
nationalen Parlamente als Quellen demokratischer Legitimität im Vorfeld des Kon
vents, in: Busek, Erhard / Hummer, Waldemar (Hg.): Etappen auf dem Weg zu einer
europäischen Verfassung. Wien u.a. 2004. S. 203–262.
MAURER, ANDREAS Parlamentarische Demokratie in der Europäischen Union. Der Beitrag
des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente. Baden-Baden 2002.
MAURER, ANDREAS / WESSELS WOLFGANG (Hg.) National Parliaments in their Ways to
Europe: Losers or Latecomers? Baden-Baden 2001.
NALLET, HENRI / LIGOT, MAURICE / BARRAU, ALAIN Rencontres parlementaires européennes.
XVIIe Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires
(COSAC). Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée Nationale
pour l’Union Européenne (1), sur la XVIIème Conférence des Organes Spécialisés
dans les Affaires Communautaires des Parlements de l’Union Européenne (COSAC),
tenue à Luxembourg les 13 et 14 novembre 1997, et présenté par MM. Henri Nallet,
Maurice Ligotet Alain Barrau, Députés. Paris 1997.
NEUNREITHER, KARLHEINZ The European Parliament and National Parliaments: Conflict or
Cooperation?, in: Journal of Legislative Studies, 11, 2005, Nr. 3–4, S. 466–489.
OLSON, DAVID M. / NORTON, PHILIP The New Parliaments of Central and Eastern Europe.
London 1996.
PANDRAUD, ROBERT Rencontres parlementaires européennes. Xe Conférence des instances
européennes des Parlements de l’Union (C.O.S.A.C.). Rapport d'information déposé
132
Literatur
par la Délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européenne (1), sur la Xème
Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires des Parle
ments de l’Union Européenne, tenue à Athènes les 9 et 10 mai 1994, et présenté par
M. Robert Pandraud, Député. Paris 1994.
Parlamentarisches Institut Tschechien: Homepage des Instituts.
[http://www.psp.cz/kps/pi/EN/index.htm; Zugriff am 20.07.2006]
PFLÜGER, FRIEDBERT Die fortschreitende europäische Integration und der Europaausschuss
des Deutschen Bundestages, in: Integration 2000, Heft 4, S. 229–244.
PÖHLE, KLAUS Das Demokratiedefizit der Europäischen Union und die nationalen Parla
mente. Bietet COSAC einen Ausweg?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 29, 1998,
S. 77–89.
PÖHLE, KLAUS Europäische Union à la Maastricht. Eine ernste Herausforderung für die
Parlamente in der EG, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 24, 1993, S. 49–63.
RANGE, TATJANA Europäische Verfassung: Neue EU-Kompetenzen für den Deutschen
Bundestag. Befugnisse und Handlungsoptionen. Sankt Augustin, Juli 2004.
ROTH, MICHAEL Aus der Praxis des Deutschen Bundestages. In: Dieringer, Jürgen /
Mauerer, Andreas / Györi, Enikö (Hg.): Europapolitische Entscheidungen kontrollie
ren. Nationale Parlamente im Ost-West-Vergleich. Dresden 2005, S. 111–114.
SACH, ANNETTE Bundestag errichtet Horchposten in Brüssel. Vereinbarung mit der Bun
desregierung soll Mitbestimmungsrechte des Parlaments stärken, in: Das Parlament,
Nr. 27, 03.07.2006.
SATTLER, KARL-OTTO Abgeordnete wollen Gras wachsen hören, in: das Parlament, Nr.
13, 27.03.2006.
SCHÄFER, AXEL Der Deutsche Bundestag sollte europäisch werden, in: Frankfurter Rund
schau vom 17.06.2006.
Sejm of the Republic of Poland: European Union Affairs Committee of the Sejm of the
Republic of Poland. Tasks.
[http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?topic=komisja_ue &id=main&col=1&newlang
=english; Zugriff am 7.7.2006].
Sejm of the Republic of Poland: Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Podkomisje.
[http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/pkom4?OpenAgent&SUE; Zugriff am 7.7.2006].
Sejm of the Republic of Poland: Komisje stałe. Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
[http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladkom4?OpenAgent&SUE; Zugriff am 7.7.2006].
Senate of the Czech Republic: Senate and European Union. Committee on EU Affaires.
[http://www.senat.cz/evropa/index-eng.html; Zugriff am 7.7.2006].
Senate of the Czech Republic: Main focus of the EU Affaires Committee. [http://www.
senat.cz/evropa/ veu_zamer-eng.html, Zugriff am 7.7.2006].
Sénat de la Republique Francaise: Présentation de la Délégation pour l’Union
Européenne.
[http://senat.fr/europe/dpue-histo.html; Zugriff am 9.7.2006].
133
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
Senate of the Republic of Poland: European Union Affaires Committee.
[http://www.senat.gov.pl/ue/comm.htm; Zugriff am 9.7.2006].
TÖLLER, ANNETTE ELISABETH Dimensionen der Europäisierung – Das Beispiel des Deut
schen Bundestages, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 35, 2004, Heft 1, S. 25–50.
TORDORFF, LORD The Conference of European Affaires Committees: A Collective Voice
for National Parliaments in the European Union. In: The Journal of Legislative Stu
dies. Volume 6, Winter 2000, Number 4, S. 1–8.
TOORNSTRA, DICK / ECPRD (Hg.): European Affairs Committees. The influence of na
tional parliaments on European policies. Brussels 2003.
WEBER-PANARIELLO, PHILIPPE A. Nationale Parlamente in der Europäischen Union. Eine
rechtsvergleichende Studie zur Beteiligung nationaler Parlamente an der innerstaatli
chen Willensbildung in Angelegenheiten der Europäischen Union im Vereinigten Kö
nigreich, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland. Baden-Baden 1995.
WIEBER, RICHARD GEORG Die Stellung des französischen Parlaments im europäischen
Normsetzungsprozess gemäß Art. 88–4 der französischen Verfassung der V. Repu
blik. Frankfurt a.M. 1999.
Quellen
Amtsblatt der Europäischen Union: 2. Protokoll über die Anwendung der Grundsätze
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 16.12.2004. (2004 / C 310 / 207–209).
(Anhang zum Vertrag über eine Verfassung für Europa, von den Staats- und Regie
rungschefs unterzeichnet am 29.10.2004).
Amtsblatt der Europäischen Union: 1. Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamen
te in der Europäischen Union. 16.12.2004. (2004/C 310/204–206). (Anhang zum Ver
trag über eine Verfassung für Europa, von den Staats- und Regierungschefs unter
zeichnet am 29.10.2004).
Amtsblatt der Europäischen Union: Europäisches Parlament: Geschäftsordnung der
Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europa-Angelegenheiten der Par
lamente der Europäischen Union. 4.11.2004. (2004/C 270/01). (wurde auf der XXIX.
COSAC vom 6. Mai 2003 in Athen angenommen)
Amtsblatt der Europäischen Union: „Kopenhagener Parlamentarische Leitlinien“. Leit
linien für die Beziehungen zwischen Regierungen und Parlamenten bei Gemein
schaftsangelegenheiten (wünschenswerte Mindeststandards). Verabschiedet auf der
XXVIII. Konferenz der Gemeinschafts- und Europaauschüsse der Parlamente der Eu
ropäischen Union (COSAC), Brüssel, 27. Januar 2003. Veröffentlicht am 2.7.2003
(2003/C 154/01).
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften: Entschließung des Europäischen Parla
ments zu den Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den einzel
staatlichen Parlamenten im Rahmen des Europäischen Aufbauwerks (2001/2023(INI))
(Napolitano-Bericht). Veröffentlicht am 21.11.1002 (2002/C 284 E/288).
134
Quellen
Amtsblatt der Europäischen Union: Erklärung zur Zukunft Europas zum Vertrag von
Nizza zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union, der Verträge zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängen
der Rechtsakte. Amtsblatt Nr. C 80 vom 10. März 2001.
Amtsblatt der Europäischen Union: Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parla
mente in der Europäischen Union zum Vertrag von Amsterdam zur Änderung des
Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften. Amtsblatt Nr. C 340 vom 10.11.1997, S. 0113.
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften: Europäisches Parlament: Entschließung
des Europäischen Parlaments zur Funktionsweise des EUV vom 17. Mai 1995, Amts
blatt der EG Nr. C 151/63.
Amtsblatt der Europäischen Union: Erklärung 13 und 14 in der Schlussakte zum Ver
trag über die Europäische Union, unterzeichnet am 7. Februar 1992. Amtsblatt Nr. C
191 vom 29. Juli 1992. (Vertrag von Maastricht).
Bundesanzeiger: Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der
Länder über die Zusammenarbeit in EU-Angelegenheiten vom 29.10.1993, Bundesan
zeiger Nr. 226/1993, S. 10425.
Bundesgesetzblatt: Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Bekanntmachung
vom 2. Julli 1980 (BGBl. I S. 1237), zuletzt geändert laut Bekanntmachung vom 12.
Juli 2005 (BGBl. I S. 2512).
Bundesgesetzblatt: Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundesta
ges und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 17. No
vember 2005. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 71, ausgegeben zu Bonn am
25. November 2005, S. 3178.
Bundesgesetzblatt: Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deut
schem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12.3.1993. Bun
desgesetzblatt 1993 I, S. 311. (EUZBBG).
Bundesgesetzblatt: Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angele
genheiten der Europäischen Union vom 12.3.1993. Bundesgesetzblatt 1993 I, S. 313.
(EUZBLG).
Bundesrat / Sénat Frankreichs: Treffen am 20. Januar 2006 – Strasbourg. Gemeinsame
Erklärung.
Bundesverfassungsgericht: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 89, 155. Urteil
des Zweiten Senats vom 12. Oktober 1993. (Maastricht-Urteil).
Conference of Speakers of National Parliaments: Guidelines: Interparlamentary Coope
ration in the European Union. 3. July 2004.
Conference of Speakers: Conclusion of the conference of speakers of the parliaments of
the EU. Madrid 1989.
COSAC: Contribution adopted by the XXXV COSAC Vienna, 22–23 May 2006.
COSAC: Minutes of the COSAC Chairpersons Meeting. Vienna, 20 February 2006.
135
OSTEUROPA-INSTITUT MÜNCHEN Mitteilung Nr. 58
COSAC: Minutes of the Meeting of the Presidential Troika of COSAC. Vienna, 20
February 2006.
COSAC: Report on the results of COSAC’s Pilot project on the 3rd Railway Package to
test the „Subsidiarity early warning mechanism“. Luxembourg 2005.
COSAC: The European affairs Committees of EU-25.
[http://www.cosac.eu/en/info/scrutiny/eac/, Zugriff am 4.5.2006]
COSAC: Models of scrutiny in national parliaments.
[http://www.cosac.eu/en/info/scrutiny/scrutiny/; Zugriff am 4.5.2006]
COSAC: Contribution adopted by the XXIX COSAC. Athens, 4–6 May 2003.
COSAC: Contribution from the XXVIII COSAC. Brussels, 27 January 2003.
COSAC: Contribution adopted by the XXVIII COSAC. Copenhagen, October 2002
COSAC: Concluding Minutes of the COSAC chairmen’s meeting, 16. September 2002
in Copenhagen.
COSAC: Contribution from the XXIVth COSAC in Stockholm to the European Coun
cil. May 22, 2001.
COSAC: Conclusion adopted by the I COSAC. Paris, 1989.
Deutscher Bundestag: Beschlussvorlage: Vereinbarung zwischen dem Deutschen Bun
destag und der Bundesregierung über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Eu
ropäischen Union. 16. Wahlperiode. Stand 22. Juni 2006.
Deutscher Bundestag: Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für die Ange
legenheiten der Europäischen Union (20. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf […] Ent
wurf eines Gesetzes über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages
und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union. […] 15. Wahlperi
ode. Drucksache 15/5492, Berlin 11.05.2005.
Deutscher Bundestag: Unterrichtung durch den Präsidenten des Deutschen Bundesta
ges. Bericht über die internationalen Aktivitäten und Verpflichtungen des Deutschen
Bundestages. 15. Wahlperiode. Drucksache 15/5056. 09.03.2005.
Deutscher Bundestag, Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union/ As
semblée Nationale, Délégation pour l’Union Europeénne: Gemeinsame Erklärung der
Délégation pour l’Union Européenne der Assemblée Nationale und des Ausschusses
für die Angelegenheiten der Europäischen Union des Deutschen Bundestages über die
Regierungskonferenz und die Europäische Verfassung. 2003.
Deutscher Bundestag / Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union: Be
richt des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union (22. Aus
schuss) gemäß § 93 a Abs. 4 der Geschäftsordnung zu den Schlussfolgerungen der
XV. COSAC (Konferenz der Sonderorgane für EU-Angelegenheiten) am 16. Oktober
1996 in Dublin – CONF/3973/96 – und zum Beratungsdokument der Regierungskon
ferenz zur Revision des Maastrichter Vertrages – Aufzeichnung des irischen Vorsitzes
vom 19. November 1996 – CONF/3985/96 – Drucksache 13/6357 Nr. 3.1 und 3.2. –.
13. Wahlperiode. Drucksache 13/6891. 3. Februar 1997.
136
Quellen
Deutscher Bundestag / Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union:
Stellungnahme des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union des
Deutschen Bundestages gemäß Artikel 45 GG in Verbindung mit § 2 des Gesetzes
über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angele
genheiten der Europäischen Union vom 12. März 1993 in Verbindung mit § 93 a Abs.
3 Satz 2 GO-BT, abgegeben in seiner 21. Sitzung am 4. Juni 2003 zum Vermerk des
Präsidiums für den Konvent: Organe – Entwurf von Artikeln für Titel IV des Teils I
der Verfassung (CONV691/03). Berlin, 27. Juni 2003.
ECPRD: Satzung des ECPRD, angenommen am 7.6.1996 in Budapest.
[http://www.ecprd.org/Public/statuteDE.asp].
Europäischer Rat: Schlussfolgerungen des Vorsitzes. (Ratsdok. 10633/06). 15./16. Juni
2006 in Brüssel.
Europäisches Parlament: Geschäftsordnung des EP, 16. Auflage vom 4.7.2006 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht; Stand: 20.7.2006).
[http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PROG=RULESEP&L=DE&REF=TOC; Zugriff am 20.7.2006].
Frankreich
Artikel 88-4 der Französischen Verfassung.
Gesetz vom 6. Juli 1979 (Nr. 79–564), erweitert durch die Gesetze vom 10. Mai 1990
(Nr. 90–385) und 10. Juli 1994 (Nr. 94–476).
Polen
Artikel 110 der Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997.
Gesetz über die Zusammenarbeit des polnischen Ministerrates mit dem Sejm und dem
Senat in Angelegenheiten bezüglich der Mitgliedschaft Polens in der EU., in: Dzien
nik Ustaw 2004, Nr. 52, item 515. erweitert durch das Gesetz vom 28. Juli 2005.
Gesetz vom 28. Juli 2005 zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit des pol
nischen Ministerrates mit dem Sejm und dem Senat in Angelegenheiten bezüglich der
Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union, in: Dziennik Ustaw 2005, Nr. 160,
item 1342.
Sejm: Geschäftsordnung des Sejm der Republik Polen: Official Journal – Monitor
Polski 2002, No. 23, item 398 – with changes.
Senat: Geschäftsordnung des Senats
Tschechien
Artikel 10b der Verfassung der Tschechischen Republik.
Abgeordnetenkammer: Gesetz vom 7. Mai 2004, was das Gesetz Nr. 90/1995 zu der
Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer erweitert.
Senat: Geschäftsordnung des Senat Tschechiens.
137
- Item sets